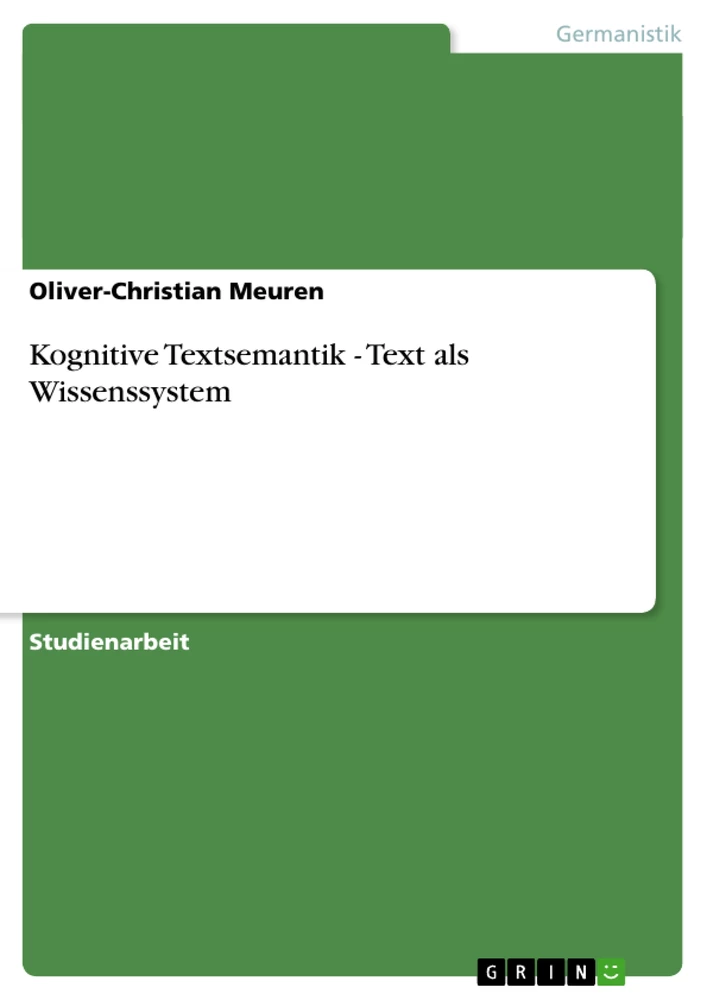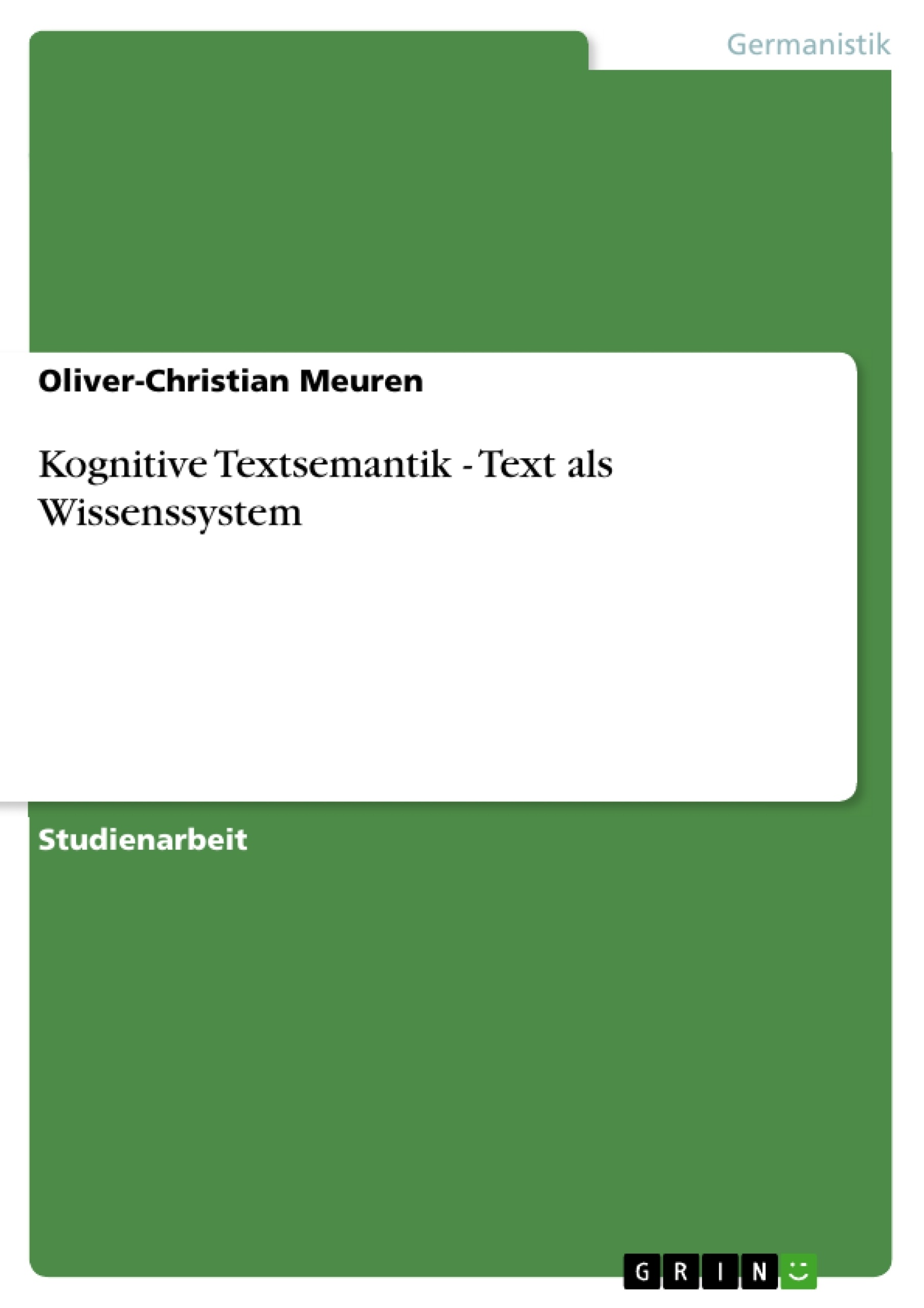In einer Welt, in der Worte mehr sind als bloße Zeichen, eröffnet dieses Buch eine faszinierende Reise in die Tiefen der Textsemantik und enthüllt die verborgenen Kräfte des soziokulturellen Hintergrundwissens (S-k HGW). Es ist eine Einladung, die unsichtbaren Fäden zu erkennen, die Texte miteinander und mit unserer kollektiven Erfahrung verweben. Die Essenz des Textverstehens liegt nicht allein in der Entschlüsselung der Worte, sondern im Erfassen des komplexen Zusammenspiels von Kontext, Kultur und individueller Interpretation. Dieses Werk seziert die vielschichtige Natur der Bedeutung, von den grundlegenden Auffassungen über Sinn und Referenz bis hin zu den subtilen Nuancen von Konnotation und Präsupposition. Es beleuchtet, wie unser S-k HGW als Schlüssel dient, um die verborgenen Botschaften zu entschlüsseln, die in Texten eingebettet sind. Anhand von Modellen wie dem hierarchischen Netzwerkmodell und der Theorie der Aktivierungsverbreitung wird die interne Organisation semantischen Wissens im menschlichen Bewusstsein ergründet. Dabei wird deutlich, wie Wörter und ihre Bedeutungen durch ein komplexes Netz von Relationen miteinander verbunden sind. Die Analyse von Texten, insbesondere der Novellen Theodor Fontanes, demonstriert, wie Denotatsnominationen und Intertextualität eingesetzt werden, um einen reichhaltigen soziokulturellen Kontext zu erschaffen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich für die Kunst des Textverstehens, die Kraft der Sprache und die Bedeutung des kulturellen Kontexts interessieren. Es bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Werkzeuge, um die Vielschichtigkeit der Textsemantik zu entschlüsseln und die tieferen Bedeutungsebenen von Texten zu erschließen. Ein tiefgreifendes Verständnis des S-k HGW ermöglicht es uns, Texte nicht nur zu lesen, sondern sie in ihrer vollen kulturellen und historischen Tragweite zu erleben. Es fordert uns heraus, unsere eigenen Vorstellungen und Interpretationen zu hinterfragen und eine tiefere Verbindung zu den Texten und der Welt, die sie repräsentieren, aufzubauen. Dieses Buch ist somit ein Muss für Sprachwissenschaftler, Literaturinteressierte und alle, die sich für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Sprache, Kultur und Kognition begeistern. Es zeigt auf, wie das Zusammenspiel verschiedener Bedeutungsebenen – denotativ, konnotativ, präsuppositiv – das Verständnis von Texten und ihren tieferen kulturellen Implikationen beeinflusst. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Textsemantik und entdecken Sie die verborgenen Dimensionen des Verstehens.
Einleitung
Textsemantik ist beschreibbar über den Begriff der Kohärenz, diese ,,bewirkt den inneren Zusammenhang eines Textes" (Brinker S.21). Aus diesem Zusammenhang läßt sich die Bedeutung eines Textes erschließen. Doch der Prozeß des Textverstehens ist ein integratives Zusammenwirken von vielen Faktoren. Er schließt soziolinguistische und psycholingistische Prozesse mit ein, ,,Verstehen umfaßt die Integration von Informationen aus verschiedenen Sätzen, die Organisation und Vervollständigung dieser Informationen durch Schlußfolgerungen aus dem, was man bereits weiß, und nicht bloße Interprationen dessen, was direkt durch den Satz ausgedrückt wird."(Kintsch 82, S.283)
Um auf verschiedene Ansätze zur Repräsentation von Bedeutung einzugehen, werde ich zuerst versuchen den Begriff Bedeutung genauer zu charakterisieren und auf die Spezifik des Wissens eingehen. Im Anschluß daran, will ich die Kategorie des sozio-kulturellen Hintergrundwissens als wichtiges Element zum Textverstehen beschreiben. Dabei werde ich über die Eigenschaften des Kontexts, der Präsentation von Wörtern im menschlichen Bewußtsein und der Relationen, die zwischen diesen bestehen oder während der Kommunikation hergestellt werden, eingehen. Im dritten Teil werde ich von verschiedenen Theorien der semantischen Repräsentationen in Texten berichten. Abschließend werde ich die Kategorie des sozio-kulturellen Hintergrundwissens in Abgrenzung zu anderen Kategorien der Bedeutung, wie Konnotation, Präsupposition und denotativer Bedeutung betrachten. Zuletzt folgt die Vorgehensweise einer Analyse von Texten in Bezug auf ihren sozio- kulturellen Hintergrund und die dazu relevanten Konstituenten im Text.
1. Grundlagen
1.1 Grundauffassungen zu Bedeutung und Sinn
1.1.1 Textsinn wird mit Bezug auf eine psycholinguistische Bestimmung verstanden als ,,die Existenzform der Bedeutung in der individuellen Psyche, die stets durch das System der Beziehungen des Individuums zur Wirklichkeit vermittelt ist" (Leontjew 75, zitiert nach Pohl I, S.256)
1.1.2 ,,Die Textsemantik ergibt sich als eine Bedeutungskomplexität aus den in den Text eingebrachten und im Rahmen des konkreten Texts organisierten Zeichenbedeutungen." (Pohl I, S. 256) Das heißt, man muß auf die Wortbedeutung eingehen um die konstituierneden Elemente der Bedeutung zu erschließen.
1.1.3 Wortbedeutungen haben jedoch keinen festen Charakter, sondern unterschiedliche Kontexte und Situationen aktivieren unterschiedliche Wissenselemente. ,,Wortbedeutungen werden bestimmt als Wissenskomplexe, die durch Widerspiegelung des Bezeichnungsobjekts, seiner Bewertung durch die Sprachträger und durch das Operieren mit Lexemen entstehen." (Pohl I, S.258) Das heißt Wortbedeutungen werden auch durch die Gesellschaftlich geprägt, somit folgt auch der Charakter der Bedeutung zumindest zum Teil dem gesellschaftlichen Wandel.
1.2 Unterschiedliche Arten von Bedeutung
Zu untersuchen ist nun der Charakter der Bedeutung, dabei wurden folgende Aussagen getroffen. Ausgegangen wird von unterschiedlichen Arten der Bedeutung. Man spricht von der Bedeutung als eine komplexe Erscheinung. Sie besteht aus mehreren Komponenten. In der Linguistik wird vorwiegend folgende Unterteilung vorgenommen:
1.2.1 Seit Erdmann wird die Bedeutung dargestellt als ,,komplexes Erscheinungsbild, die sich aus den Komponenten Vorstellungs- und Begriffsgehalt, Nebensinn, Gefühlswert und Stimmungsgehalt zusammensetzt, deren Kern begrifflich verallgemeinerte Abbildelemente vom Denotat darstellen." (zitiert nach Pohl I, S.262f)
1.2.1 Neubert unterscheidet folgende Bedeutungsarten: ,,referentiell, stilistisch, grammatisch, konnotativ, expressiv, kollokationelle, übertragene" (zitiert nach Pohl I, S.262f) Er spricht bei der Bewältigung dieser Bedeutungserschließung durch den Rezipienten von dessen ,,semantischer Kompetenz". Neubert geht davon aus , das erst durch das Zusammenwirken mehrerer Ebenen von Bedeutung die Realität durch die Sprache abgebildet werden kann. ,,Konnotation und Übertragungen, Stilverfärbungen und funktional-stilistische Indizes geben Auskünfte, die über die deskriptiven Bedeutungsinhalte nicht nur hinausgehen, sondern ihnen erst ihr kommunikativ ädäquates Profil geben." (Neubert 78, S.22)
1.2.2 Eine Einteilung in Bedeutungsarten unter Berücksichtigung einer sozialen Komponente nimmt Lyons vor: ,,the descriptive, the social and the expressive" (zitiert nach Pohl I, S.262f). Damit weist er bereits auf die gesellschaftlich-soziale Determiniertheit des Wortschatzes hin.
1.2 Bestimmung der sprachlichen Spezifik des Wissens
Bereits oben habe ich erwähnt, daß die Beschreibung der Wortbedeutung als Wissenskomplex ihrem offenen Charakter entspricht. Um zu klären , welche Arten von Wisssen zur Bestimmung der Wortbedeutung wichtig sind, gehe ich kurz auf verschiedene Wissensarten ein.
1.2.1 Weltwissen oder enzyklopädisches Wissen ist all das Wissen, über das die Menschheit verfügt. ,,Die außersprachliche, auf allgemeiner Weltkenntnis beruhende, Erfahrung." (Brinker, S. 43)
1.2.2 ,,Sprachwissen erfaßt Bedeutungswissen und Wissenselemente, die sich auf das Formativbild beziehen.
1.2.3 Bedeutungswissen ist insgesamt zu beziehen auf die Bedeutung von kodifizierten sprachlichen Einheiten, also Le in absentia (als gespeicherte Größen) und in praesentia (im Text als Allosem) und Bedeutung von Makrozeichen, wie Satz und Text.
1.2.4 Lexikalisches Wissen umfaßt Bedeutungswissen und Formativwissen. Lexikalisches Wissen versucht im Sinne eines Sprachhandlungswissens semantische und sonstige Teilaspekte eingebettet in den umfassenden kommunikativen Beschreibungshintergrund sprachimmanent darzustellen." (Pohl I, S. 259f)
1.2.5 Es läßt sich zusammenfassend festhalten, daß für das Textverständnis des einzelnen ,,das für die Kommunikation erforderliche Sachwissen, bereichert um systembedingtes kommunikatives Regelwissen erforderlich ist." (Schippan 84, S.154)
1 Die Theoretische Fundierung des sozio-kulturellen Hintergrundwissens
2.1 Soziokulturelle Markierung als Kontexteigenschaft
Ich gehe aus von der Betrachtung des Kontexts als wichtiges Element zur semantischen Analyse. Kontexte bilden wichtige Verständnishilfe in Texten, da die Bedeutung einer lexikalischen Einheit sich oft nur durch Kontext erschließen läßt. Er dient zur Markierung der für die aktuelle Kommunikationssituation relevanten Wissensteile des Lexems.
2.1.1 ,,Ammer beschreibt diesen als Kulturkontext, wenn er eine Verständnishilfe aus dem Wissen um unsere gemeinsame Kultur ist." (zitiert nach Pohl I, S.263f)
2.1.2 Shippan definiert den Kulturkontext als ,,Erfahrungen einer Sprachgemeinschaft, die sich aus dem Zusammenleben, aus den gemeinsamen gesellschaftlichen Bedingungen, der gemeinsamen Kultur, der Tradition, usw. ergeben". (zitiert nach Pohl I, S.263f)
2.1.3 Es stellt sich die Frage, ob der Kontext alleine verantwortlich ist für die Bestimmung der Bedeutung, oder ob das Lexem an sich einen eigenen invarianten Bedeungskern hat. Nach Lewandowski ,,werden im Kontext keine neuen Bedeutungen geschaffen, sondern nur die in der Langue angelegten Möglichkeiten aktualisiert". (zitiert nach Pohl I, S.263f) Und Wotjak meint dazu, ,,daß dies zu einer Negierung der Bedeutungsforschung führen würde, da ein Lexem dann in der unendlichen Zahl der möglichen Kontexte ja jeweils eine andere Bedeutung besitzen würde." (Wotjak 71, S. 83) Das heißt, daß den Worten ein Bedeutungskern zugrunde gelegt werden kann, der auch Träger von gesellschaftlich-sozial geprägten Merkmalen ist. Daraus folgt für das sozio-kulturelle Hintergrundwissen (im folgenden nur noch s-k HGW), daß es an das Lexem gebunden ist.
2.2 Interne Organisation semantischen Wissens
2.2.1 Um zu klären in welcher Weise Wörter und ihre Bedeutung im Bewußtsein miteinander verknüpft sind, kam man in der psychologischen Forschung zur Modellierung von Merkmals- und Netzwerkmodellen. Demnach sind Wörter und ihre Bedeutungen im Bewußtsein ähnlich einem Netzwerk durch Relationen miteinander verknüpft. Der Inhalt, also die Bedeutung eines Lexems ergibt sich aus den Beziehungen, in denen dieses zu anderen Lexemen steht. ,,Richtungsweisend war das hierarchische Netzwerkmodell von Collins & Quillian (69). Es stellt dar wie sich Bedeutungen in Netzwerken repräsentieren, die aus Knoten (zwei Arten: für Konzepte und Eigenschaften) und Kanten (ist- und hat-Kanten) bestehen. Diese Unterscheidung von Knoten und Kanten/Relationen ermöglicht den Bedeutungsrahmen von Sememen abzustecken." (Pohl I, S.265f) Semem ist die Beschreibungseinheit auf der Inhaltsebene. ,,Ein sprachliches Zeichen wird verstanden als Einheit von Formativ (Lautkomplex) und Wortbedeutung (Semem)." (Wotjak 71, S.31)
2.2.2 George A. Miller gibt uns ein Beispiel für ein einfaches semantisches Netzwerk:
Abbildung 1: Einfaches semantisches Netzwerk
In dem Schaubild werden mehrere semantische Relationen angezeigt.Die Beziehung zwischen Blumeund Bedecktsamer wird durch einen gestrichelten Pfeil mit dicker Spitze symbolisiert.Es handelt sich hierbei um eine "ist ein"-Relation.Durch eine solche Relation wird die Zugehörigkeit der mit einem Begriff bezeichneten Lexeme (Blume) zu einer allgemeinen Klasse (Bedecktsamer) dargestellt. Hierarchisch organisierte Wissensstrukturen können auf diese Weise abgebildet werden.Bei solchen hierarchischen Wissensstrukturen werden Eigenschaften einer Oberkategorie auf untergeordnete Kategorien vererbt. Die Eigenschaften der Oberkategorie gelten dann automatisch für alle verbundenen Unterkategorien.
Eine weitere , im Schaubild durch Pfeile mit dünner Spitze realisierte Relation ist die inverse "ist_ein"-Relation. Hierwird eine Klasse (Blume) in Beziehung zu einzelnen Exemplaren (Rose) dieser Klasse gesetzt.
Als drittes läßt sich die "hat"-Relation anführen. Durch Verwendung der "hat"-Relation können den einzelnen Lexemen Merkmale bzw. Eigenschaften zugewiesen werden,die für alle Klassenmitglieder Gültigkeit haben: EineVertreterin der Klasse Blume verfügt über Staubfaden, Stempel etc. Besagte Merkmale gelten für sämtliche Vertreter dieser Klasse. Eine weitere, im Schaubild nicht realisiert Beziehung ist die assoziative. So könnte beispielsweise eine assoziative Beziehung zwischen den Lexemen Rose und Liebe realisiert sein. Gerade die assoziative Beziehung ist geprägt vom sozialen Umfeld, welches diese Beziehungen konditioniert..
2.2.3 Dieses Netzwerkmodell gibt nun Aufschluß darüber, wie die vielfältigen Bedeutungsvarianten gespeichert werden. Um zu klären, welche der möglichen Varianten für die aktuelle Kommunikationssituation relevant ist, entwickelte man das Modell der Aktivierungsverbreitung (Collins & Loftus 75). ,,Die Bedeutung eines Wortes ergibt sich demnach aus jenen Teilen eines Netzwerks, die in der sprachliche Tätigkeit aktiviert werden." (Pohl I, S.266) Die Aktivierung vollzieht sich durch Assoziationen, d.h. ,,bestimmte Stimuli erzeugen semantisch ,,benachbarte" Wörter als Reaktion". (Schippan 84, S.196) Diese lexikalischen Assoziationen sind abhängig bzw. werden geprägt von dem sozio-kulturellen Umfeld des Einzelnen.
2.2 Ereignisbestimmte semantische Relationen
Es gilt nun zu klären, welche Arten von Relationen und zu was für bestimmmten Zwecken diese Relationen im Sprachgebrauch erzeugt werden. ,,Der Aufruf eines Ereignisbegriffes bzw. des semantischen Kerns (d.h. eines Teils der typischen Struktur ereignisbestimmten Wissens) regt semantische Relationen zu anderen, nicht explizit dargebotenen Begriffen dieser Konfiguration intern an und macht sie verfügbar".(Ebd. zitiert nach Pohl I, S. 267f) Dies bedeutet , daß Verbindungen zwischen einzelnen Begriffen bestehen, die sie als Elemente eines Schemas charakterisieren. Dieses Schema, Rahmen oder Frame ist eine gegliederte Repräsentation von Wissens über irgendein Konzept, eine Handlung oder ein Ereignis. ,,Kommt es nun zum Aufruf eines Begriffs, der Element eines Schemas ist, wird durch Prozesse des Mustervergleichs und der Mustervervollständigung das gesamte Schema aktiviert."(Kintsch 82, S. 319) Hierbei werden zwei Gruppen ereignisbestimmter semantischer Relationen unterschieden:
2.3.1 ,,Ereignisgebundene Relationen - Dazu zählen wir die Handlungsträger-, die Lokations-, die Rezipient-, Objekt- und die Instrumentalbeziehung. Sie stehen in engem Zusammenhang zum semantischen Kern und machen ähnlich einem Merkmalssatz bei Objektbegriffen dessen Bedeutung aus.
2.3.2 Ereignisverweisende Relationen - Dazu zählen wir die Relationen mit höherem begrifflichen Vernetzungsgrad (z.B. Finalität, Kausalität, Konditionalität). Sie verweisen in der Regel auf einen anderen Ereignisbegriff und regen einen breiteren Ausschnitt semantischen Wissens an" (Ebd. zitiert nach Pohl I, S. 267f)
2.3.3 Die Relationen werden dabei nach einen bestimmten Muster entwickelt. Der Mensch versucht meist einen höheren Verallgemeinerungsgrad zu erreichen. Er folgt dabei Mustern, die durch sein gesellschaftliches Leben konditioniert werden. Weil Sprache an Gedächtnis gebunden ist, betreffen Erklärungsgrundlagen der Sprache immer auch bestimmte Gedächtnisleistungen. Deshalb möchte ich kurz die Modellvorstellung von Informationsverarbeitung von Klix (77) anführen. ,,Vom Kurzzeitspeicher (seinen Inhalten) können Suchprozesse im Langzeitgedächtnis ausgelöst werden. Der im Langzeitgedächtnis ausgelöste Suchprozeß aktiviert gespeicherte Informationen, die dann im Kurzzeitgedächtnis wirksam werden und dabei der Rekonstruktion teilweise verlorener Informationen dienen."(Klix 77, S.70) Diese Prozesse stehen im engen Zusammenhang mit den Modell der Aktivierungsverbreitung von Collins und Loftus und verdeutlichen wie semantische Relationen durch kognitive Prozesse zustande kommen.
2.3.4 S-k HGW stellt uns das Wissen zur Verfügung diese semantischen Relationen zu
realisieren, es läßt uns erkennen, welche Lexeme in Verbindung zu anderen stehen, und in welcher sprachlichen Situation eine Verknüpfung stattfindet. Denn s-k HGW stellt uns das nötige Wissen um die in unserem sozio-kulturellen Umfeld bestehenden Schemata zur Verfügung. Das Verständnis um diese Relationen ist determiniert vom individuellen s-k HGW des Rezipienten.
2 Textsemantik allgemein
Textsemantik konstituiert sich als ein komplexes Phänomen, deshalb stelle ich im folgenden zwei Theorien zur semantischen Repräsentation vor, die die einzelnen Elemente, die zum Textverständnis führen, nochmals in ihrem Zusammenhang aufzeigen. Im Anschluß gehe ich ein auf die verschiedenen linguistischen Kategorien der Bedeutung.
3.1 Das Phänomen der Textwelt
3.1.1 Beaugrande/Dressler nennen die einem Text zugrundeliegenden Konzepte und Relationen Textwelt. Wobei Konzepte als eine ,,Konstellation von Wissen" definiert wird, ,,welches mit mehr oder weniger Einheitlichkeit und Konsistenz aktiviert und wieder ins Bewußtsein gerufen werden kann". (Beaugrande/Dressler 1981-89, zitiert nach Pohl III, S. 51)
3.1.2 Hierbei gilt, daß ,,durch die kommunikative Verwendung von sprachlichen Ausdrücken ein aktiver Speicher im Gedächtnis aufgerufen wird, der sich aus solchen Konzepten und Relationen zusammensetzt, wie sie den aktuellen Bedürfnissen einer Kommunikationsaufgabe entsprechen." (Pohl III, S. 52) Das bedeutet für den Produzenten oder Rezipienten des Textes, daß bei ihm ein gewisses Maß an deklarativem und prozeduralen Wissen vorausgesetzt wird, um die Textwelt zu verstehen. Die Konzepte stehen in dieser Theorie für die bereits oben erwähnten Frames oder Schemata, die durch unsere Erkenntnis- und Kommunikations- bedürfnisse geprägt wurden.
3.1.3 Auch hier dient das Prinzip der Aktivierungsverbreitung den Relations-zusammenhang zu erklären, der ausgelöst wird durch den Prozeß des Mustervergleichs und der Mustervervollständigung, ausgehend von einem semantischen Kern zu einer größeren Wissenseinheit. ,,Dieses Prinzip erklärt, weshalb bei Textrezeption Assoziationen zu anderen Konzepten hergestellt werden, es erlaubt Voraussagen zu treffen, Hypothesen aufzustellen, gedankliche Vorstellungen zu entfalten, all dies weit über die expliziten Aussagen des Oberflächentexts hinaus." (Pohl III, S.52)
3.2 Oberflächen- und Tiefenstruktur
Die Generative Grammatik hat für die natürlichen Sprachen, wenn man die phonetische Struktur ausklammert, drei Strukturebenen charakterisiert: Die syntaktische Oberflächenstruktur, die syntaktische Tiefenstruktur und die semantische Struktur. Ausgehend von dieser Struktureinteilung wurden für die semantische Analyse folgende Aussagen getroffen:
3.2.1 Es besteht ein Zusammenhang von Oberflächen- und Tiefenstruktur. An der sprachlichen Oberfläche sind nicht alle Informationseinheiten eines Texts sprachlich realisiert, diese sind jedoch in der Tiefenstruktur komplex mehrdimensional vernetzt. In Untersuchungen zum Satzgedächtnis wurde die Annahme bestätigt, ,,daß die Tiefenstrukturinformation relevanter für die Gedächtnisleistung ist als die Oberflächenform."(Bierwisch 77, S.198)
3.2.2 ,,Bedeutungspräzisierung oder Bedeutungsbestimmung erfolgt demnach im und durch den Äußerungskontext." (Pohl III, S.54) Der Äußerungskontext ist jedoch nicht auf den oberflächlichen Teil begrenzt, sondern findet in der Tiefenstruktur des Textes seine Ergänzung durch außertextliche Relationen.
3.2.3 P. v. Polenz, der untersuchte, welche Arten von Wissen sich sprachlich realisieren lassen, stellte fest, daß ,,die Bedeutungspräzisierung durch
a) den textlichen Kontext und
b) den außertextlichen Kontext erfolgt.
Er kam zum Schluß, daß textlicher Kontext im Sinne satzinterner und satzübergreifender (Topiks) Kompatibilitätsbeziehungen wirken kann. Außertextlicher Kontext stellt hierbei den kontextuellen Bezugsrahmen als Teil des allgemeinen Bezugswissens dar."(Pohl III, S 54f) Dieser Bezugsrahmen entspricht den von Beaugrande/Dressler beschriebenen Konzepten. Er definiert was in einer bestimmten Wissenseinheit zusammengehört bzw. welche der möglichen Bedeutungen im konkreten Falle abgebildet werden soll. Dies zeigt das auch das s- k HGW, welches uns Aufschluß gibt über die möglichen Relationen zwischen den Lexemen und die damit verbundenen Auslegungsmöglichkeiten, nicht nur in der denotatsbeschreibenden Semantik im Vordergrund gebunden ist, sondern seinen Ursprung findet als ein Teil des Bedeutungswissens.
3.2.4 Obwohl vorwiegend von der Bedeutung des Kontexts für die semantiscxhe Analyse ausgesagt wurde, zeigt sich bei dieser Theorie, daß man auch hier nicht auf eine gewisse Invarianz der Wortbedeutung verzichten kann. ,,Die semantische Interpretation eines Satzes ist determiniert durch den inneren semantischen Inhalt lexikalischer Elemente und die Art, in welcher Weise sie auf der Ebene der Tiefenstruktur in Beziehung gesetzt werden,."(Chomsky 78, S.55) Die Funktion der syntaktischen Tiefenstruktur besteht folglich in der Vermittlung zwischen Semantik und Oberflächenform von Sätzen. Das s-k HGW dient dabei den Textproduzenten oder Rezipienten dazu, Elemente der Textoberfläche mit sprachlichem und außersprachlichem Wissen zu kombinieren, um den Textsinn zu erhellen.
3.3 Die Kategorie s-k HGW in Abgrenzung von der denotativen Bedeutung, der konnotativen Bedeutung und von der Präsupposition.
Als Abschluß zu meinen allgemeinen Betrachtungen zur Textsemantik gehe ich auf einige linguistische Kategorien der Bedeutung ein. (vgl. Hartung 94, S.77ff) Jede einzelne dieser Kategorien eröffnet andere Betrachtungsebenen der Bedeutung, und spiegelt somit die Bedeutungskomplexität (siehe unter 1.1.2) der Textsemantik wieder.
3.3.1 Die denotative Bedeutung ist das durch ein Wort getragene Wissen von verschiedenen Bereichen der Welt. Es stellt einen gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt an Wissen vom Bezeichneten dar und zeigt sich im usuellen Gebrauch des Wortes.
3.3.2 An der Grenze zwischen Sachwissen und denotativen Wissen läßt sich die Kategorie s-k HGW einordnen. Es umfaßt die jeweilige spezifische kulturelle, soziale, historische Situation, in die ein Denotat eingebettet ist bzw. sein kann. Soziokulturelles Hintergrundwissen ist Wissen über den Sprachgebrauch einer sozialen Gruppe, oder über eine Kulturtradition in ihrer historischen Variabilität, welches sich mit dem Denotat verbindet.
3.3.3 Die konnotative Bedeutung umfaßt die kommunikativen Rahmenbedingungen eines Wortes. Ein Wort kann durch seine Konnotation u.a. sozial, zeitlich, regional, politisch eingeordnet werden. Brinker ,,versteht unter der konnotativen Bedeutung eines Wortes den Komplex von Begleit- und Nebenvorstellungenwertender und emotionaler Art." (Brinker, S.114)
3.3.3.1 Wenn man die enge Gebundenheit soziokulturellen Hintergrundwissens an die denotative Bedeutung bedenkt, so ist festzustellen, daß das Vorhandensein soziokulturellen Hintergrundwissens die Ausprägung von Konnotationen bedingen kann, andererseits Konnotationen auf soziokulturelles Hintergrundwissen verweisen. Die Konnotation regelt beispielsweise die ,,Lesart" des Textes in Bezug auf seinen sozio-kulturellen Hintergrund.
3.3.4 Präsupppositionen sind Verstehensvoraussetzungen, die in der Äußerung mitgedacht werden, sowohl aus Produzenten- wie auch aus Rezipientenperspektive. Sie gehören zum nichtenzyklopädischen gegenstandskonstitutiven Bedeutungswissen und regeln den Sprachgebrauch in bezug auf Präferenzen und Restriktionen.
3.3.4.1 Da Präsuppositionen wie auch s-k HGW bedeutungskonstitutiv sind , Bestandteile der denotativen Bedeutung sein können, so kann eine Präsupposition soziokulturell bedingt sein, anderseits kann s-k HGW präsuppositiv wirken.
3 Analyse - An welche Texteinheiten s-k HGW gebunden ist
Im folgenden werde ich kurz die Vorgehensweise der semantischen Analyse in Bezug auf s-k HGW in Novellen von Theodor Fontane erläutern (vgl. Pohl II, S.25ff). Ich gehe zum einen ein auf die Untersuchung einzelner lexikalischer Einheiten, zum anderen auf die Technik der Intertextualität, die es ermöglicht zwischen Texten semantische Relationen herzustellen.
3.1 Semantik lexikalischer Einheiten
3.1.1 Denotatsnominationen, die eine besondere Affinität zum s-k HGW haben, bauen in den Fontanenovellen den soziokulturellen Hintergrund auf. So schreibt auch Schippan einigen Lexemen die Fähigkeit zu, ,,neben rationalen Sachverhalts-abbildmerkmalen auch wertende oder emotionale Merkmale zu enthalten". (Schippan 84, S.147) Eine Methode zum Auffinden dieser semantisch aufgeladenen Einheiten gibt es jedoch nicht. Sie können nur individuell durch unser Sprachgefühl ermittelt werden.
3.1.1.1 ,,Der Text wird aufgebaut, indem durch lexikalische Einheiten bestimmte systemhafte Beziehungen hergestellt werden" (Schippan 84, S.201) Im folgenden nun eine Aufzählung von Denotatsnominationen und Topikpartner aus Novellen von Theodor Fontane (erstgenannte Beispiele zu ,,L'Adultera", zweitgenannte Beispiele zu ,,Mathilde Möhring"), die die semantischen Verflechtungen darstellen:
Festlichkeiten: - Ball, Subskriptionsball;
- Silvesterball, Maskenball;
Mahlzeiten/Speisen: - erstes, zweites Frühstück, kleines Gabelfrühstück, Diner, kleines Mahl
- deutsches Beafsteak, eine Jauersche (Wurst) essen, Moospastillen;
Wohnung/Räune: -Stadtwohnung, Vorderhaus, Galerie, Musikzimmer;
- Entree, Wohnstube, einfenstriges Mittelzimmer;
Bekleidung: - Frack;
- Umschlagetuch, schwarzer Schleier, Haubenschnebbe, Jagdstiefel;
3.1.2 ,,In einer weiteren sprachwissenschaftlichen Analyse werden aus dem Bedeutungsrahmen der Nominationen solche Wissensbestandteile verallgemeinert ermittelt, die Aufschluß geben über Invarianten eines bestimmten Kulturkreises. (In den untersuchten Novellen wird Auskunft gegeben über ein Berliner Lebens- und Gesellschaftsbild am Ausgang des 19. Jh.)" (Pohl II, S. 27)
3.1.3 ,,So steckt der Bedeutungsrahmen zum Lexem ,,Diner" in ,,L´Adultera" ab, welche Wissensbestandteile für diesen Text gelten; die Konnotation /Deutschland, Ausgang des 19. Jahrhunderts/ regelt die Lesart." (vgl. Pohl II S. 27)
/Deutschland, Ausgang des 19. Jahrhunderts/
Sitzordnung im kommerzienratlichen Hause durch Plazierungs -
karten festgelegt
Eintritt in die Galerie Gäste: dem Hause
nach dem Öffnen der nächststehender Kreis
Flügeltüren im paar- - Major von Gryczinski
weisen Aufmarsch - Baron Duquede, Legationsrat a.D. DINER - Polizeirat Reiff
- Maler
Landschafter Arnold Gabler
Portrait- u. Genremaler Elimar Schulze
Tischreden Tischgespräche
Reihenfolge der Speisen Eigentümlichkeiten preußischer Politik und Getränke Bismarck
die Suppe Kunst
Montefiascone (Malerei: Murillo Tizian) Mehrere Gänge (Musik: Wagner) Champagner Religion
Kaffee
Abbildung 2: Bedeutungsrahmen zum Lexem Diner
Der Rezipient der Novelle muß erst diese Wissensbestandteile aktivieren, um die Handlung im entsprechenden sozio-kulturellen Kontext zu sehen. Dies geschieht wie oben erwähnt durch Prozesse des Mustervergleichs, nur so kann er die sozio-kulturelle Bedeutung entschlüsseln, die im Zusammenhang mit der in Wörterbüchern angeführten denotativen Bedeutung steht.
3.1.3.1 Aus der Analyse ist ersichtlich, daß in den Bedeutungsrahmen mehr Wissensbestandteile eingehen, als in Wörterbucheintragungen nachlesbar ist.
3.1.3.2 Ausgegangen werden muß folglich von einer weiten Bedeutungsauffassung, die zwar einen invarianten Bedeutungskern gewährleistet, deren Randbereiche aber genügend Raum für soziale, kulturelle und historische Varitäten bieten. Nur so besteht genügend Erklärungskraft für die Integration verschiedener Wissensarten, die sozusagen den Randbereich der Bedeutung strukturieren.
3.2 Intertextualität
(vgl. Pohl II, S.36ff)
3.2.1 Durch den Aufruf von Fremdtexten bzw. Zitaten, die selbst Kernstück eines Ausgangstextes mit Textsemantik und Textsinn darstellen, werden semantische Relationen zu anderen nicht explizit dargebotenen Ereignissen anregt.
3.2.2 Die Sinnerschließung ist dabei determiniert vom literarischen Vorwissen des Textrezipienten. Vom Rezipienten des Zieltextes wird ein doppeltes ,,Übersetzungsverhältnis" abverlangt.
3.2.3 Sozio-Isotopieketten begünstigen bspw. den Aufbau literarischer Figuren, sowie verdeutlichen die Konstellation der Personen untereinander.
3.2.3.1 Eine Subkette läßt sich zur Figur Ezel van der Straatens ermitteln, in der die ,,Schuld des Weibes" und das ,,Unrecht desjenigen, der eine bestehende Liebesbeziehung stört", evoziert werden.
Beleg aus der Fontanenovelle ,,L´Adultera" (Aufbauverlag Berlin und Weimar 1981, S. 19.): Ezel von der Straaten zu Melanie
,,Ich werde michübrigens davor hüten, den Mohren der Weltgeschichte, das ihr seid, weißwaschen zu wollen".
Ausgangstext Verweise aus der Mohrenwäsche im Buch der Propheten des Alten Testament bei Jeremia, Kapitel 13, Vers 23:
,,Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Flecken? So könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewöhnt seid"
(vgl. Pohl II, S.36)
Literaturverzeichnis:
Ammer, K. Einführung in die Sprachwissenschaft. Band I. Halle(Saale). 1958.
Beaugrande, Robert-Alain de, Wolfgang-Ulrich Dressler. Einführung in die Textlinguistik. (=Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft). Tübingen 1981.
Beckmann, Ulrich: text und Textwelten. Zur Problematik der Bedeutungskonstituierung zu Texten. (=Papiere zur Textlinguistik Bd. 67) Hamburg. 1991.
Bierwisch, Manfred. Sprache und Gedächtnis: Ergebnisse und Probleme. In: Klix, Friedhart, Hubert Sydow (Hg.).zur Psychologie des Gedächtnisses. Berlin 1977. S.117-149
Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin 1997
Chomsky, Noam. Studien zu Fragen der Semantik. Frankfurt /M.. 1978.
Collins, A.M. A spreading-activation theory of semantic processing. In Collins, A. M. & Loftus, F.F.. Psychological Review. 82 (1975). S.407-428
Collins, A.M..Retrieval time from semantic memory. In Collins, A.M. & Quillian, M.R.. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1969. S. 240-247.
Dobrovol´skij, Dimitri. Kognitive Aspekte der Idiomsemantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. (Eurogermanistik Bd.4). Tübingen. 1995.
Erdmann, O. Die Bedeutung eines Wortes. Leipzig. 1925.
Hartung, Diana. Zur semantiktheoretischen Beschreibung soziokulturellen
Hintergrundwissens. In Inge Pohl. Wort und Wortschatz. Frankfurt/M. 1995. S. 77-85.
Hertel, Volker, Irmhild Barz, Regine Metzler, Brigitte Uhlig (Hg.). Sprache und
Kommunikation im Kulturkontext. Beiträge zum Ehrenkolloquium aus Anlaß des 60. Geburtstags von Gotthard Lerchner. Frankfurt/M.. 1996 (Sprach- und Kommunikationsgeschichte Bd.4)
Kintsch, Walter. Gedächtnis und Kognition. Springer Verlag Berlin. 1982.
Klix, Friedhart, Hubert Sydow (Hg.).zur Psychologie des Gedächtnisses. Berlin 1977
Leontjew, A.A.. Zur Psychologie der sprachlich-kommunikativen Einflußnahme. In: Probleme der Psycholinguistik. Berlin. 1975.
Lewandowski, Th.. Linguistisches Wörterbuch 2. Heidelberg, Wiesbaden. 1990. Lyons, J. Semantics. Cambridge. 1977.
Miller, G. A.: Wörter. Streifzüge durch die Psycholinguistik.Heidelbergu.a. 1993 Neubert, A. Arten der lexikalischen Bedeutung. In: LS/ZISW/A. 1978. S.1-23.
Pohl, Inge-I: Identifikation und Wirkungsweise der semantischen Implikation soziokulturelles Hintergrundwissen (Teil I). In Pohl, Inge, Gerhard Bartels (Hg.): Sprachsystem und sprachliche Tätigkeit: Festschrift zu 65. Geburtstag von Prof. Dr. phil.habil. Karl-Ernst Sommerfeldt. Frankfurt /M. 1991. (Sprache - System und Tätigkeit Bd.2) S. 255-271.
Pohl, Inge-II: Identifikation und Wirkungsweise der semantischen Implikation soziokulturelles Hintergrundwissen (Teil II). In Pohl, Inge, Gerhard Bartels (Hg.): Studien zur Semantik. Frankfurt /M. 1992. (Sprache - System und Tätigkeit Bd.4) S. 17-42.
Pohl, Inge-III: Komplexe Textsemantik und soziokulturelles Hintergrundwissen. In : KarlErnst Sommerfeldt (Hg.): Vom Satz zum Text. Frankfurt /M. 1992. (Sprache - System und Tätigkeit Bd.7) S. 41-64.
Pohl, Inge (Hg.). Semantik von Wort, Satz und Text. Beiträge des Kolloquiums ,,Semantik von Wort, Satz und Text" in Rostock, 1994. Frankfurt/M.. Verlag Lang. 1995. (Sprache - System und Tätigkeit Bd. 14)
Pohl, Inge, Horst Ehrhardt (Hg.).Wort und Wortschatz. Beiträge zur Lexikologie. Tübingen. 1995.
Polenz, Peter von. Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. (=Sammlung Göschen 2226). Berlin. New York. 1985.
Rickheit, Gert, Hans Strohner. Grundlagen der kognitiven Sprachverarbeitung. Tübingen. 1993.
Schippan, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig. 1984.
Spiller, Bernd (Hg.). Sprache: Verstehen und Verständlichkeit. Kongreßbeiträge zur 25. Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik GAL e.V. (Forum angewandte Linguistik Bd. 28). Frankfurt/M.. 1995.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Textsemantik laut dieser Analyse?
Textsemantik wird über den Begriff der Kohärenz beschrieben, die den inneren Zusammenhang eines Textes bewirkt. Die Bedeutung eines Textes lässt sich aus diesem Zusammenhang erschließen. Textverstehen ist ein integratives Zusammenwirken vieler Faktoren, einschließlich soziolinguistischer und psycholinguistischer Prozesse.
Welche Grundauffassungen zu Bedeutung und Sinn werden diskutiert?
Textsinn wird psycholinguistisch als die Existenzform der Bedeutung in der individuellen Psyche verstanden, die stets durch das System der Beziehungen des Individuums zur Wirklichkeit vermittelt ist. Textsemantik ergibt sich als eine Bedeutungskomplexität aus den in den Text eingebrachten und im Rahmen des konkreten Texts organisierten Zeichenbedeutungen. Wortbedeutungen sind Wissenskomplexe, die durch Widerspiegelung des Bezeichnungsobjekts, seiner Bewertung durch die Sprachträger und durch das Operieren mit Lexemen entstehen.
Welche unterschiedlichen Arten von Bedeutung werden unterschieden?
Erdmann unterscheidet Vorstellungs- und Begriffsgehalt, Nebensinn, Gefühlswert und Stimmungsgehalt. Neubert unterscheidet referentielle, stilistische, grammatische, konnotative, expressive, kollokationelle und übertragene Bedeutungsarten. Lyons teilt in deskriptive, soziale und expressive Bedeutung ein.
Wie wird die sprachliche Spezifik des Wissens bestimmt?
Verschiedene Wissensarten sind wichtig: Weltwissen (enzyklopädisches Wissen), Sprachwissen, Bedeutungswissen (Le in absentia und in praesentia) und lexikalisches Wissen. Für das Textverständnis ist das für die Kommunikation erforderliche Sachwissen, bereichert um systembedingtes kommunikatives Regelwissen, erforderlich.
Wie wird soziokulturelle Markierung als Kontexteigenschaft betrachtet?
Der Kontext ist ein wichtiges Element zur semantischen Analyse, da die Bedeutung einer lexikalischen Einheit sich oft nur durch Kontext erschließen lässt. Ammer beschreibt diesen als Kulturkontext, wenn er eine Verständnishilfe aus dem Wissen um unsere gemeinsame Kultur ist. Shippan definiert den Kulturkontext als Erfahrungen einer Sprachgemeinschaft, die sich aus dem Zusammenleben, aus den gemeinsamen gesellschaftlichen Bedingungen, der gemeinsamen Kultur, der Tradition usw. ergeben.
Wie ist semantisches Wissen intern organisiert?
Wörter und ihre Bedeutung sind im Bewusstsein ähnlich einem Netzwerk durch Relationen miteinander verknüpft. Der Inhalt, also die Bedeutung eines Lexems, ergibt sich aus den Beziehungen, in denen dieses zu anderen Lexemen steht. Collins & Quillian stellen ein hierarchisches Netzwerkmodell dar, das aus Knoten (für Konzepte und Eigenschaften) und Kanten (ist- und hat-Kanten) besteht.
Welche ereignisbestimmten semantischen Relationen gibt es?
Ereignisgebundene Relationen (Handlungsträger-, Lokations-, Rezipient-, Objekt- und Instrumentalbeziehung) stehen in engem Zusammenhang zum semantischen Kern. Ereignisverweisende Relationen (Finalität, Kausalität, Konditionalität) verweisen in der Regel auf einen anderen Ereignisbegriff.
Was ist das Phänomen der Textwelt?
Beaugrande/Dressler nennen die einem Text zugrundeliegenden Konzepte und Relationen Textwelt. Konzepte sind Konstellationen von Wissen, die mit mehr oder weniger Einheitlichkeit und Konsistenz aktiviert werden können. Ein aktiver Speicher im Gedächtnis wird durch die kommunikative Verwendung von sprachlichen Ausdrücken aufgerufen.
Wie hängen Oberflächen- und Tiefenstruktur zusammen?
An der sprachlichen Oberfläche sind nicht alle Informationseinheiten eines Texts sprachlich realisiert, diese sind jedoch in der Tiefenstruktur komplex mehrdimensional vernetzt. Die Tiefenstrukturinformation ist relevanter für die Gedächtnisleistung als die Oberflächenform. Bedeutungspräzisierung erfolgt im und durch den Äußerungskontext.
Wie grenzt sich die Kategorie sozio-kulturelles Hintergrundwissen (s-k HGW) von anderen Bedeutungsarten ab?
Die denotative Bedeutung ist das durch ein Wort getragene Wissen von verschiedenen Bereichen der Welt. S-k HGW umfasst die jeweilige spezifische kulturelle, soziale, historische Situation, in die ein Denotat eingebettet ist. Die konnotative Bedeutung umfasst die kommunikativen Rahmenbedingungen eines Wortes. Präsuppositionen sind Verstehensvoraussetzungen, die in der Äußerung mitgedacht werden.
An welche Texteinheiten ist s-k HGW gebunden?
S-k HGW baut in den Fontanenovellen den soziokulturellen Hintergrund auf. Es wird die Semantik lexikalischer Einheiten und die Technik der Intertextualität untersucht. Denotatsnominationen haben eine besondere Affinität zum s-k HGW.
Was ist Intertextualität?
Durch den Aufruf von Fremdtexten bzw. Zitaten werden semantische Relationen zu anderen nicht explizit dargebotenen Ereignissen angeregt. Die Sinnerschließung ist dabei determiniert vom literarischen Vorwissen des Textrezipienten.
- Quote paper
- Oliver-Christian Meuren (Author), 1999, Kognitive Textsemantik - Text als Wissenssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95583