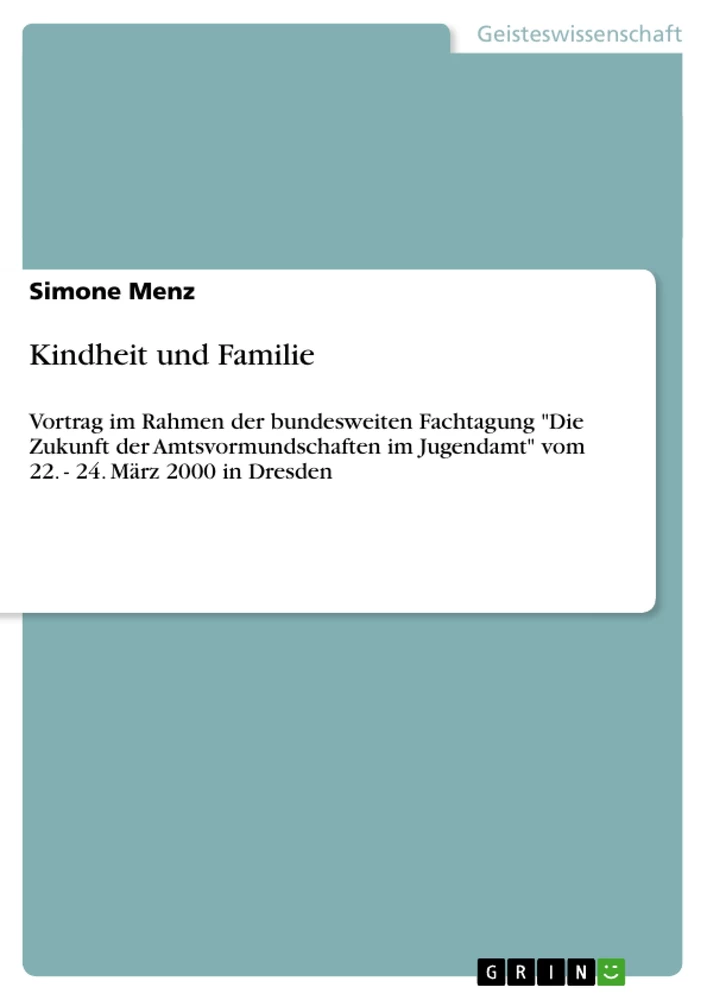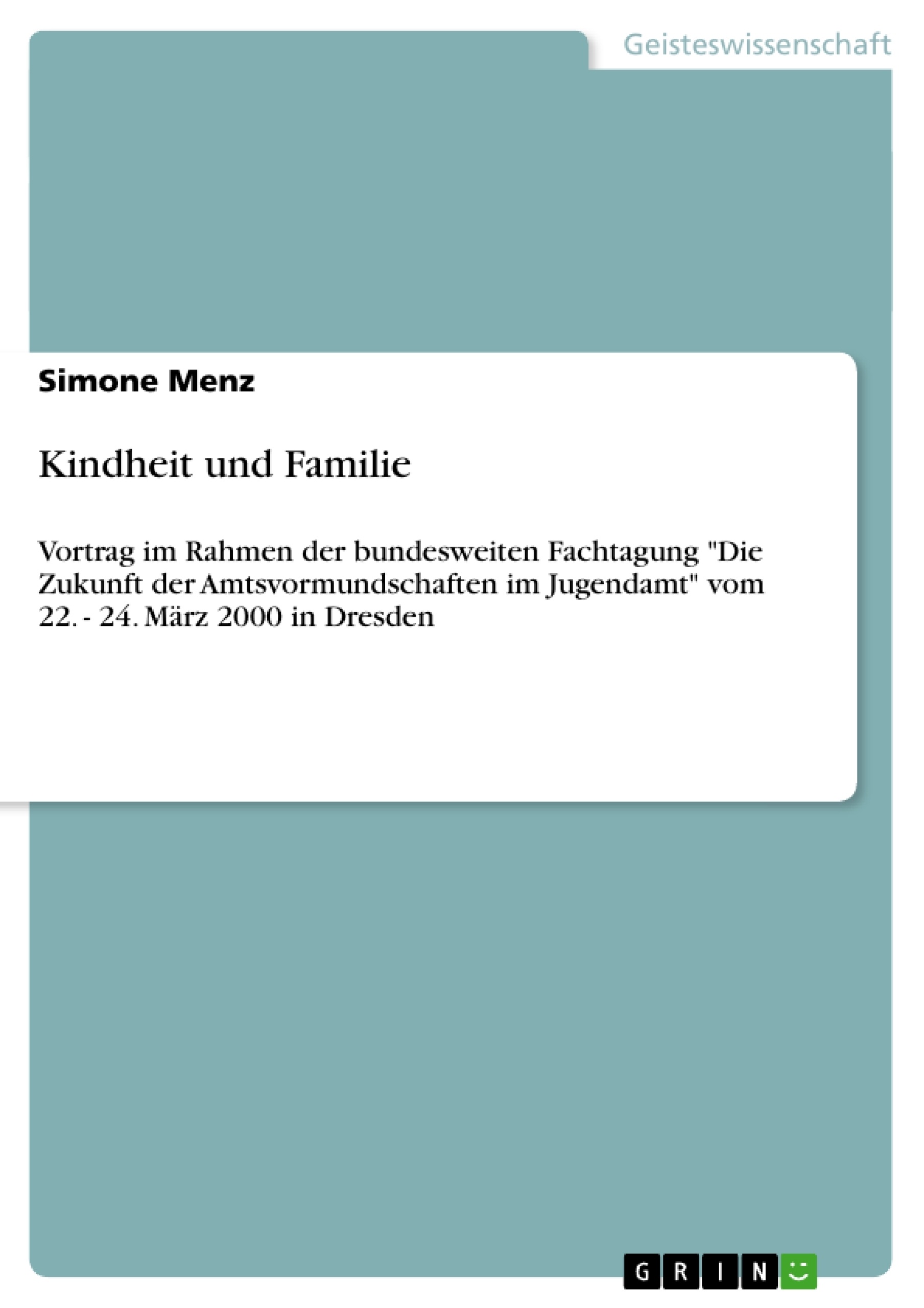Vortrag im Rahmen der bundesweiten Fachtagung
"Die Zukunft der Amtsvormundschaften im Jugendamt" vom 22. - 24. März 2000 in Dresden
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Tagungsmitglieder,
im Rahmen der Vorbereitung einer durch die Stadt selbst angeregten Bewährungsstudie, welche ehemalige Mündel des Jugendamtes Dresden und Umgebung zu deren Lebensläufen vor dem Hintergrund einer Amtsvormundschaft befragen wird, wurde ich gebeten, einen inhaltlichen Beitrag für diese Tagung zu leisten. Den Veranstalterinnen und Veranstaltern möchte ich für diese Möglichkeit und ihr Vertrauen danken. (Bevor ich den Beitrag präsentieren werde, stelle ich meine Person vor.) Seit Oktober vergangenen Jahres arbeite ich mit einer halben Stelle als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Sozialpädagogik, mit der anderen halben Stelle bin ich Sozialarbeiterin in einer gemeinnützigen Gesellschaft für Jugendhilfe in der Äußeren Neustadt in Dresden. Auf diese Weise kopple ich in meiner beruflichen Tätigkeit Theorie und Praxis, über meine praktische Arbeit verfüge ich über einen direkten Zugang zur Thematik der Fachtagung. Ich betreute eine junge noch unvolljährige Frau, deren Tochter aufgrund des noch unmündigen Rechtsstatus der Mutter eine Amtsvormundschaft zugeteilt wurde.
Trotz dieser und weiterer Verbindungen zum konkreten Gegenstand werde ich meinen Vortrag auf einer allgemeineren Ebene ansiedeln. Allerdings weist das Thema meines Referates, "Kindheit und Familie", auf eine Weite und Fülle von theoretischen und forschungsrelevanten Ansätzen, so dass auch ich gezwungen bin, mich inhaltlich einzugrenzen. Inhaltlich werde ich mich insbesondere auf die Autoren und Autorinnen Michael-Sebastian Honig, Lothar Böhnisch und Elisabeth Breck-Gernsheim beziehen.
Mögliche Bedeutungen und Folgerungen für Fragestellungen der Tagung ergeben sich dennoch, die Kategorie Kindheit unter den Bedingungen einer sich modernisierenden Gesellschaft bietet den Kontext vielfältiger Verläufe von Kindsein. In dem durch mich favorisierten Entwurf stellt ein kindlicher Lebenslauf vor dem Hintergrund einer Amtsvormundschaft ein mögliches Muster von Kindheit dar, ich verorte dieses Muster im gelingenden Sinn neben weiteren Möglichkeiten traditioneller, flexibler bis origineller Modelle moderner Kindheit.
Meinen Beitrag werde ich entlang folgender Punkte entwickeln:
1. Einbettung der Thematik in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs
2. Versuch einer Definierung von Kindheit
3. Die modernisierte Familie als eine wichtige Bedingung gelingender Kindheit
4. Schlussbetrachtung
Kindheit und Familie
Vortrag im Rahmen der bundesweiten Fachtagung
”Die Zukunft der Amtsvormundschaften im Jugendamt” vom 22. - 24. März 2000 in Dresden
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Tagungsmitglieder, im Rahmen der Vorbereitung einer durch die Stadt selbst angeregten Bewährungsstudie, welche ehemalige Mündel des Jugendamtes Dresden und Umgebung zu deren Lebensläufen vor dem Hintergrund einer Amtsvormundschaft befragen wird, wurde ich gebeten, einen inhaltlichen Beitrag für diese Tagung zu leisten. Den Veranstalterinnen und Veranstaltern möchte ich für diese Möglichkeit und ihr Vertrauen danken. (Bevor ich den Beitrag präsentieren werde, stelle ich meine Person vor.) Seit Oktober vergangenen Jahres arbeite ich mit einer halben Stelle als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Sozialpädagogik, mit der anderen halben Stelle bin ich Sozialarbeiterin in einer gemeinnützigen Gesellschaft für Jugendhilfe in der Ä ußeren Neustadt in Dresden. Auf diese Weise kopple ich in meiner beruflichen Tätigkeit Theorie und Praxis,über meine praktische Arbeit verfüge ichüber einen direkten Zugang zur Thematik der Fachtagung. Ich betreute eine junge noch unvolljährige Frau, deren Tochter aufgrund des noch unmündigen Rechtsstatus der Mutter eine Amtsvormundschaft zugeteilt wurde.
Trotz dieser und weiterer Verbindungen zum konkreten Gegenstand werde ich meinen Vortrag auf einer allgemeineren Ebene ansiedeln. Allerdings weist das Thema meines Referates, ”Kindheit und Familie”, auf eine Weite und Fülle von theoretischen und forschungsrelevanten Ansätzen, so dass auch ich gezwungen bin, mich inhaltlich einzugrenzen. Inhaltlich werde ich mich insbesondere auf die Autoren und Autorinnen Michael-Sebastian Honig, Lothar Böhnisch und Elisabeth Breck- Gernsheim beziehen.
Mögliche Bedeutungen und Folgerungen für Fragestellungen der Tagung ergeben sich dennoch, die Kategorie Kindheit unter den Bedingungen einer sich modernisierenden Gesellschaft bietet den Kontext vielfältiger Verläufe von Kindsein. In dem durch mich favorisierten Entwurf stellt ein kindlicher Lebenslauf vor dem Hintergrund einer Amtsvormundschaft ein mögliches Muster von Kindheit dar, ich verorte dieses Muster im gelingenden Sinn neben weiteren Möglichkeiten traditioneller, flexibler bis origineller Modelle moderner Kindheit.
Meinen Beitrag werde ich entlang folgender Punkte entwickeln:
1. Einbettung der Thematik in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs
2. Versuch einer Definierung von Kindheit
3. Die modernisierte Familie als eine wichtige Bedingung gelingender Kindheit
4. Schlussbetrachtung
1 Einbettung der Thematik in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs
Die von mir favorisierte Sicht auf Kindheit und Kinderleben folgt der aktuellen kritischen Forschungsdebatte innerhalb der Sozialwissenschaften. Die Diskussion verortet sich zwischen den Extremen, Kinder zu beschützen bzw. zu emanzipieren. Dahinter stehen gesellschaftliche Wahrnehmungen von Kindern als Opfer westlicher Moderne bis hin zu Ideen von Kindern als autonome, mit eigenen Rechten ausgestattete Subjekte. Doch treffen sich diese z.T. kontroversen Ansätze, Konzepte und Themen in den gemeinsamen Aussagen, Kinder als Mitglieder der Gesellschaft zu betrachten und somit Kindern einen einflussreicheren Subjektcharakter zu ermöglichen. Diese Aussagen scheinen zunächst nicht originell, wurden sie doch im nun ausgehenden ”Jahrhundert des Kindes” ins Zentrum pädagogischer Bemühungen und gesellschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt. Es wurde die ”Kindheit” als Phase der Entwicklung „entdeckt“, treffender formuliert wurde die moderne Kindheit konstruiert. Historisch gesehen, hat sich Kindheit als geschützte Lebensphase zumindest im abendländischen Kulturkreis etabliert. Michael-Sebastian Honig versucht sich an einer Strukturierung des Forschungsfeldes in seinem neuen Buch: Entwurf einer Theorie der Kindheit. In seiner Einleitung heißt es: ” ... es (das 20.Jahrhundert, S.M.)... begreift sich als eine Epoche der Humanisierung... Zur Bilanz gehört die Durchsetzung der Schulpflicht und das Verbot der Kinderarbeit, der Siegüber die Säuglingssterblichkeit; Elternschaft statt Ehe wurde zum Kern von Familie. Die Kindheit ist als Lebensphase des Spielens und Lernens zu einer kulturellen Selbstverständlichkeit geworden; Kinder sind als Personen ‚ in Entwicklung ’ anerkannt (Honig 1999). Doch genau diese Selbstverständlichkeit gerät im neuen Kindheitsdiskurs unter Kritik. Das Konzept der ”Erziehungskindheit” (ebenda) reproduziert unreflektiert das normierte und hierarchische Generationenverhältnis. Nicht dem Kind selbst, sondern dem finalen Wunschbild des ”werdenden Erwachsenen” galt das eigentliche Interesse der Gesellschaft. Innerhalb der Institution Familie besitzt das eigene Kind (natürlich) einen hohen emotionalen Wert. Eltern und Familie sind aufgerufen, ihre Kinder im Hier und Jetzt zu lieben, zu schützen und zu befähigen. Die gewachsene Aufmerksamkeit auf individueller Ebene entspricht dem Konzept des sich entwickelnden Wesens. Es stellt Kinder zwar unter den sorgenden Schutz der Gemeinschaft, sozial in der Form der Kernfamilie organisiert, gleichzeitig jedoch wurden und werden Kinder ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Der durchaus zum Wohle der Kinder gedachte Ausschluss derselben aus dem produktiven Bereich verwehrt den Heranwachsenden jegliche gesellschaftliche Definitionsmacht. Kinder werden innerhalb des privaten Bereiches der Familie unter den Vorgaben des modernen Sozialstaates verortet. Es entstanden Räume und Orte für Kinder. Innerhalb dieser Inseln (Konzept der ”verinselten Lebensräume” von Zeiher/Zeiher 1994 ) wurden und werden durchaus Interessen und Bedürfnisse von Kindern gelebt und befriedigt. Außerhalb dieses Schutzraumes endet jedoch die Definitions- und Gestaltungskraft der noch nicht Mündigen. Das Kind in Entwicklung gilt der neueren Sozialwissenschaft als ”Metapher der Bevormundung” (Honig 1999). Die ”Erziehungskindheit” (ebenda) in der Tradition des vernunftbegabten Bürgers ist die normative Vorstellung moderner Kindheit, dessen eigene Beschränktheit nun sichtbar wird. Kinder können und sollen zu selbstbewussten Subjekten heranwachsen, der Entwurf und der Weg dorthin sind jedoch gesellschaftlich vorgezeichnet. Und genau das macht den originellen Wert der neueren Kindheitsforschung aus, auf Widersprüche, Brüche, Chancen und Grenzen des modernen Kindseins hinzuweisen, in idealer Weise Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe der Kinder selbst aufzuspüren bzw. zu legitimieren.
2 Versuch einer Definierung von Kindheit
Demzufolge macht es Sinn, eine Definition von Kindheit auf einer gesellschaftlichen Ebene vorzunehmen. Die zur Selbstverständlichkeit gewordene soziale Ordnung zwischen den Generationen stellt den historisch konkreten Modus der Vergesellschaftung dar. Honig fasst ”Kindheit” im bereits erwähnten Buch folgendermaßen: ” Kindheit ist nicht Inbegriff von Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen, sondern selektiver Kontext und sozialer Code, der Entwicklungsprozesse normiert und den Kinder ihrerseits strukturieren... (ebenda 1999, S. 84)” und interaktiv erzeugen. Kindheit bildet ein normatives Konstrukt. Es werden die sozialen Praktiken, Handlungsmuster, Institutionen und Instrumente zur Gestaltung und Reproduktion von Kindheit und der hierfür geschaffenen generationalen Ordnung thematisierbar. Kindsein muss interaktiv hergestellt werden. Kindheit bildet somit den Kontext von Kinderleben. Das Kind wird zum sozialen Akteur, es kann sich der jeweiligen sozialen, kulturellen und materiellen Ressourcen seiner konkreten sozialen Umwelt bedienen, gleichsam ist es auf interaktive und kommunikative Angebote und Auseinandersetzung im Rahmen des Generationenverhältnisses, aber auch in Auseinandersetzung mit seinesgleichen angewiesen, um eigene Handlungsfähigkeit und Handlungsentwürfe herzustellen und zu gestalten. Dies heißt nicht, dass Kindheit beliebig konstruierbar oder egoistischer geworden ist. Lebensentwürfe fallen heute insgesamt vielfältiger aus, diese Dynamik hat auch kindliches Sein und Werden erfasst.
In den Sozialwissenschaften rücken Alltag und Kultur der Kinder ins Zentrum der Aufmerksamkeit; die Analyse realer Verhältnisse und deren Sinnzuschreibungen, aber auch der Wandel derselben, wenn möglich aus der Perspektive der Kinder, entsprechen der neuen Programmatik der Kindheitsforschung. Die Selbstverständlichkeit der generationalen Ordnung und der implizierten Machtkonstellation zwischen Erwachsenen und Kindern kann hinter fragt werden, das Kind ist als Konstrukteur seiner eigenen Geschichte an gefragt, erziehungswissenschaftlich werden Determinanten einer ”gelingenden Alltagsbewältigung” junger Menschen interessant.
Kindheit kann heute kaum mehr als ”homogene Altersphase” (ebenda, S. 97) definiert werden, ein normaler Kindheitsentwurf existiert nicht mehr und dennoch ist keine andere Alterskategorie in dem hohen Maß institutionalisiert, wie diese. Der Sozialstaat verregelt das Leben der heranwachsenden Generation von der Geburt bis ins Jugendalter. Kleinkinder wachsen in privaten und verhäuslichten Verhältnissen auf, der Besuch eines Kindergartens wird für viele Kinder ab dem 3. Lebensjahr (für einige bereits der Besuch der Kinderkrippe ab dem ersten Lebensjahr) zum strukturierenden Moment ihres Alltags, ab der mittleren Kindheit dominiert die Schule den Tagesrhythmus der Mädchen und Jungen. Allerdings gerät die Schule als gesellschaftliche Einrichtung der Erziehung und Vorbereitung der Heranwachsenden selbst in die Kritik. In ihrem institutionellen Charakter zwingt Schule den Kindern genau jenes hierarchische Verhältnis auf, welches Kinder über Attribute der Unmündigkeit, Unfähigkeit und Unfertigkeit definiert, welche es über Förderung und Bildung der jungen Menschen abzubauen gilt. Im Alltag der Kinder stellt die Schule einen zentralen Lebensort dar . ” ... die Schule hat zwar vordergründig immer noch eine beherrschende Stellung inne, aber die ‘ Schulkinder ” führen häufig schon einen Alltag, dessen Zeitökonomie und Planungsrationalität mit dem vertrauten Bild von ‘ Spielen und Lernen ’ nicht mehr viel zu tun hat ” (ebenda, S. 97). Spätestens im Alter der ”Kids” (Böhnisch 1992) verschwimmen die Grenzen zwischen Kindsein und Jugend, diese Altersgruppe wird zumindest durch die Medien- und Konsum-Kultur in ihrer Eigenständigkeit erkannt und gewollt. Kindsein heißt nun, sich zwischen den verschiedenen Rollenerwartungen und institutionellen Vorgaben zu bewegen, den geeigneten Habitus im ”richtigen” Moment zu beherrschen: ein Mädchen vereint in ihrer Person am Vormittag die lernbereite Schüle rin, am Nachmittag die aufgeklärte Konsumentin und am Abend die Tochter ihrer Eltern zu sein. Ebenso entwerfen Jungen verschiedene soziale Praktiken. Über Kindheit zu diskutieren heißt deshalb, verschiedene Muster von Kindheiten zu umreißen, welche jeweils durch gesellschaftliche Kategorien, wie Geschlecht, Schicht-, Kultur- und ethnische Zugehörigkeit, Alter und Region determiniert werden. Ein handlungsfähiges und gestaltendes Subjekt zu werden (und bereits als Kind zu sein) ist unter anderem über das interaktive Handlungsmuster Erziehung, aber wesentlicher über die subjektive Leistung jedes Kindes hinsichtlich der täglichen Bewältigung des Lebens (der Spannung zwischen Systemintegration und eigenem Lebensentwurf, vgl. ebenda) erklärbar.
Am Ende dieses Jahrhunderts lässt sich Kindheit nur in einer Vielzahl verschiedener Entwürfe denken. Das Verhältnis von Kindheit, Kultur, Familie und Staat entspricht dem bürgerlichen Denkmuster, gleichzeitig unterliegt dieses Muster dem gesellschaftlichen Modernisierungstrend. Kindheit konstruiert und dekonstruiert sich innerhalb eines dynamischen Prozesses. Der soziale Status der Kinder ist in einem hohen Maß von Gegensätzlichkeiten geprägt, welcher gleichzeitig freisetzend und einbindend wirkt: Kindheit soll in die gesellschaftliche Mitte rücken, Kinder werden von den Straßen verdrängt, Kindheit wird kommunikativ erzeugt, Kinder verfügen über keine eigene öffentliche Stimme, Kindheit wird rationalisiert, Kinder werden in ihren Familien nicht selten emotional überfordert.
Honig charakterisiert den Status des Kindes durch drei grundlegende, in sich widersprüchliche Elemente:
Auf einer rechtlichen Ebene ist das Verhältnis von Kindern zu Erwachsenen als ein hierarchisches Verhältnis institutionalisiert. Der Rechtsstatus von Kindern und Jugendlichen umfasst deren Rechte auf Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit. Dieser Anspruch auf einen gesellschaftlichen Schonraum ist der Vergangenheit kontinuierlich ausgebaut worden, er gilt als soziale Errungenschaft der Moderne. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sichert jungen Menschen zunehmend (wenn auch bescheidene) Teilhaberechte.
Für eine gesellschaftliche Verortung der Kindheit ist ebenso die ökonomische Dimension von Wichtigkeit. Die soziale Gruppierung der Kinder ist vom produktiven Bereich ausgeschlossen. Kinder stellen gesellschaftlich keine Arbeitskraft zur Verfügung und leben aufgrund dessen in einem existentiell notwendigen Abhängigkeitsverhältnis verwandtschaftlicher und/oder sozialstaatlicher Art. Die Freistellung von der Erwerbsarbeit ist allerdings gebunden an die Erwartung, dass sich die heranwachsende Person die für die Sozialintegration notwendige Kultur und Bildung aneignet.
Als dritte grundlegende Dimension beschreibt Honig eine habituelle Ebene moderner Kindheit. Soziale Praktiken von Kindern sind durch eine sonderbare Mischung aus Selbständigkeit und Selbstverständnis einerseits und andererseits durch die Eingebundenheit in die generationale Ordung zwischen Erwachsenen und Kindern gekennzeichnet. Das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern stellt eine wesentliche Grundlage hinsichtlich der Befähigung und Gestaltung eines eigenen Habitus dar. Die Familie mit ihrem kulturellen, materiellen und kommunikativen Fundus bleibt eine grundlegende, doch nicht einzige Bedingung eines erfolgreichen Subjektentwurfs (vgl. ebenda, S. 97ff).
Die modernisierte Kindheit bildet den Rahmen für individuelles Kindsein. Mit dieser Aussage fasse ich den zweiten Teil meines Vortrages zusammen.
3 Die modernisierte Familie als eine wichtige Bedingung gelingender Kindheit
Im dritten Teil thematisiere ich Inhalte und Formen der ebenfalls von der Modernisierungsdynamik erfassten Institution Familie, welche ich soeben als eine wesentliche Grundlage von Kindheit und in den meisten Kindheitsverläufen als reichste Ressource und Chance für eine zufriedene Selbstverwirklichung definierte. Aber auch die Institution Familie erhält eine gesellschaftlich nicht unbedeutende Legitimierung durch ihre Kinder. Die Familie soll der heranwachsenden Generation die notwendigen Ressourcen stellen und vermitteln. Mit der Etablierung der modernen Gesellschaft und der hiermit verbundenen Zweiteilung derselben in einen öffentlichen und einen privaten Bereich verlor die Familie ihre produktiven ökonomischen Funktionen, gleichzeitig sind ihr Fortpflanzung und Sorge um die Nachkommen zugewiesen (vgl . Metz-Göckel/Nyssen 1990, S. 182/183 u. Beck-Gernsheim 1994). Wenn sich die ökonomische Bestimmung der Familie relativiert, bedarf es neuer Sinngehalte, wie z.B. Heim, Haushalt und Kinder.
Auch die Institution Familie unterliegt einem historischen Wandel. Besonders in den westlich industrialisierten Ländern erlebte sie in der Nachkriegsphase eine Renaissance traditionaler Werte und Ordnung, welche ihre Entsprechung in Staat, Recht und Sozialpolitik fand. Familie wird als wichtigste Sozialisationsinstanz geschützt und kontrolliert. Die nächste Generation entlarvte die Familie als reproduktiven Ort sozialer Ordnung und Machtdemonstration. In diesem Sinn wurde Familie nun in Frage gestellt. Neue Modelle jenseits von Autorität und Entfremdung wurden entworfen, seltener wirklich gelebt. Ähnlich dem Forschungsdiskurs über Kindheit und Kindsein folgte die wissenschaftliche Auseinandersetzung über Familie dem gesamtgesellschaftlichen Wertungen und Definitionen. Genau genommen gingen die Diskussionen über Familie denen über Kindheit voraus. Lange Zeit subsumierte die Familienforschung Gedanken über Kindsein und Kindheit.
Heute können Kindheit und Familie nur im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses beschrieben werden. Einen klaren Standpunkt vertritt die Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Beck-Gernsheim in ihrem Aufsatz: Auf dem Weg in die postfamiliale Familie - Von der Notgemeinschaft zur Wahlverwandtschaft aus dem Jahr 1994. Sie schreibt: ” Als Ergebnis der historischen Entwicklung also tritt ein Trend in Richtung Individualisierung hervor. Er kennzeichnet zunehmend auch das Binnenverhältnis der Familienmitglieder, erzeugt dabei eine Dynamik eigener Art. (...) Zusammengefasst: Eine ‚ Inszenierung des Alltags ‘ setzt ein. Um die auseinanderstrebenden Einzelbiographien zusammenzuhalten, wird immer mehr Abstimmung nötig. (...) Die Folge ist, dass sich der Charakter des Familienalltags allmählich verändert. Während man früher auf eingespielte Regeln und Muster zurückgreifen konnte, werden jetzt mehr und mehr Entscheidungen fällig. Immer mehr muss ausgehandelt, geplant, in eigener Regie hergestellt werden ” (ebenda, S. 123/124). Ein neuer Begriff wurde geprägt: die ”Bastelexistenz”, dieser meint ”ein zur Freiheit verurteiltes Leben... im Sinne massenhafter banaler Alltagserfahrungen” (Hitzler/Honer 1994, S. 307), welche individuell koordiniert und bewertet werden müssen.
Postmoderne Familien bestehen aus Männern und Frauen, Müttern und Vätern, ”neuen” Vätern und arbeitenden Müttern, Kindern und Geschwistern, aus Töchtern und Söhnen, welche sich neben diesen generationalen Konstruktionen auch als Mädchen und Jungen entwerfen. Das System Familie umfasst eine Gruppe individualisierter Wesen unter strukturellen Bedingungen, welche ” ...eher gegen als für familiales Zusammenleben und Zusammenhalt wirken. Die meisten Rechte, Anspruchsvoraussetzungen für Unterstützungsleistungen des Wohlfahrtsstaates sind... auf Individuen zugeschnitten, nicht auf Familien. Sie setzen in vielen Fällen Erwerbsbeteiligung... voraus. Erwerbsbeteiligung wiederum setzt Bildungsbeteiligung, beides Mobilität und Mobilitätsbereitschaft voraus, alles Anforderungen, die nichts befehlen, aber das Individuum dazu auffordern, sich gefälligst als Individuum zu konstituieren... ” (Beck/ Beck-Gernsheim 1994, S. 14) In den Sog der Individualisierung zieht es jede (von der männlichen über die weibliche bis zur kindlichen) Biographie, jedoch die Chance einer aktiven Selbstgestaltung können zahlenmäßig große Gruppen der Gesellschaft nur unbegrenzt in Anspruch nehmen, und hierzu gehören Kinder und Frauen. Mütterlichkeit ist auch im modernen Familienmodell ein zentrales Definitionsmerkmal des weiblichen Sozialcharakters. In der Regel sind es Mütter, welche den Familienalltag organisieren, die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse des arbeitenden Mannes, des Kleinkindes oder des pubertierenden Sohnes hinsichtlich divergierender Zeitrhythmen, Orte und Mittel koordiniert. Die Interessen der Frau habe ich noch nicht erwähnt. Im traditionellen Modell würde sich die Mutter zugunsten anderer Familienmitglieder zurücknehmen (können), in moderneren Familienkonstellationen steht frau unter Druck, auch sich selbst zu verwirklichen. Ein Alltag der Familien fällt vor diesem Hintergrund eher konfliktgeladen aus und entspricht so gar nicht dem harmonischen Bild der ”Vater-Mutter-Kind-Einheit”. Der Kinderbericht liefert diesbezüglich eine entspannende und hoffnungsvolle Einschätzung: ” Viele Väter haben im Zusammenhang mit dem Wandel der familialen Lebensformen vermehrt Aufgaben in Versorgung, Betreuung und Erziehung ihres Kindesübernommen und neue Ausdruckformen eines liebevollen Verhältnisses zu ihrem Kind gewonnen ” (Kinder- und Jugendbericht 1999, S. 30). Als individueller Entwurf existiert der ”neue aufmerksame Vater”, als gesellschaftliches Phänomen muss es sich erst noch durchsetzen.
An dieser Stelle möchte ich eine Definierung der sozialen Instanz Familie vornehmen. Wenn die Kindheit nur in Bezug zur generationalen Ordnung, dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, bestimmt werden kann, dann ist die Familie eine zentrale Strukturkategorie und interaktiver Ausdruck des Generationsverhältnisses und kann ebenso wie die Kindheit nur in der Mehrzahl formuliert werden.
Diesen pluralen Konzepten von Familie und Familienleben werde ich mich im nächsten Abschnitt zuwenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Vielfältigkeit der Familienformen aufzuzeigen. Eine Einteilung oder Zuteilung nach differierenden Ausdrucks- und Strukturmerkmalen kann wieder nur einen reduzierten Einblick gewähren, dennoch kann ich im Rahmen meines Vortrages nur auf diese Form zurückgreifen.
Ich werde erstens: Familien bezügl. Kommunikations- und Interaktionsformen unterscheiden, zweitens: bezügl. der Aufenthaltsorte und Zeitrhythmen der einzelnen Familienmitglieder, drittens: bezügl. ihrer ökonomischen und strukturellen Gegebenheiten.
Erstens: Verschiedene Familienkonzepte hinsichtlich ihrer Kommunikations- und Interaktionsformen
Der Charakter des Umgangs der Eltern mit ihren Kindern und umgekehrt hat sich verändert. Im privaten Rahmen der Familie können Gefühle, Affekte, Konzepte vom individuellen Sein ausgelebt werden, die Art und Weise markiert verschiedene Familienkulturen. Heute weisen die Beziehungsverhältnisse zwischen Kindern, Müttern und Vätern bzw. Personen, welche in die Rollen von Mutter oder Vater schlüpfen, partnerschaftliche Züge auf (vgl. Kinder- und Jugendbericht 1999, S. 27). Was in früheren Zeiten durch die Eltern angeordnet wurde, soll nun zwischen den Generationen, aber auch zwischen Müttern und Vätern, zwischen den Geschwistern ausgehandelt werden. Dieses Kommunikationsmuster entspricht der allgemeinen gesellschaftlichen Erwartung, sich selbst als Subjekt zu entwerfen, zu bewerten und auch zu agieren. Da diese Erwartungen auch die Kindheit erreicht hat, müssen auch die Heranwachsenden ihr ”eigenes Leben” aus einer breiten Palette von Angeboten und Möglichkeiten verteidigen. Eltern erwarten von ihren Kindern, dass sie den Bildungsnormen gerecht werden, sich Interessen und Freizeitbeschäftigungen suchen und sich zu demokratischen Persönlichkeiten entwic keln. Sie sollen sich selbst verwirklichen, aber den Blick für die Realitäten oder den Sinn anderer Menschen nicht verlieren. Das Kind selbst bewegt sich zwischen konkurrierenden formellen und informellen Netzen, in engen Freundschaften und Kindercliquen, in verwandtschaftlichen und professionellen Bezügen mit je eigenen Regeln, Routinen, Sprachcodes und Wertungen. Die Familie als der Ort der täglichen Auseinandersetzung leistet einen wichtigen, vielleicht den wichtigsten Beitrag, Kindern den Raum zu bieten, die verschiedenen Kulturen und Sinnzusammenhängen zu synchronisieren und in den eigenen Entwurf einzupassen. Eltern bieten den Kindern in ihrem Verhalten Orientierung, aber auch die notwendige Reibefläche, es ”anders als die Erwachsenen” tun zu wollen. Eltern werden ihre Kinder vor Risiken warnen bzw. sich ihrer Machtmittel bedienen, um das Kind nicht in jede Gefahr rennen zu lassen.
Die Sozialwissenschaftlerin Manuela du Bois-Reymond entwickelt eine Typologie verschiedener familialer Modelle im ihrem Buch ”Kinderleben” aus dem Jahr 1994. Sie entwickelt diese entlang dem historischen Trend vom ” Befehlshaushalt zum Verhandlungshaushalt ” . (Sie greift damit auf die Begrifflichkeiten von A. de Swann: De mens is de mens een zorg. Amsterdam 1982 zurück.) Obschon sich allmählich eine Verhandlungskultur in modernen Familien etabliert, macht sie auf eine wichtige Einschränkung aufmerksam: ” Familiale Verhandlungsprozesse laufen deshalb trotz einer ausgewogeneren Machtbalance zwischen den Generationen nicht in einem machtfreien Raum ab. Im Gegenteil; gerade weil moderne Kinder ihren Eltern widersprechen dürfen, muss umso mehr zwischen den Parteien geredet und verhandelt werden. Und das Kinder im Zivilisationsverlauf mehr Macht und Rechte erworben haben, bedeutet nicht, daßsie etwa unabhängiger vom Familienkontext geworden wären (Du Bois-Reymond 1994, S. 145)”. Eltern und Kinder sind gezwungen, über ihr Verhalten, ihre Wertungen zu reflektieren. Entscheidungen, Möglichkeiten und Verbote müssen begründet werden. Gelingt es den Generationen, sich gegenseitig zu erklären und kann die Familie auf ein breites Repertoire von Konfliktstrategien zurückgreifen, um so eher entspricht sie (innerhalb der vorgeschlagenen Typologie) modernisierten Mustern. Im Gegensatz hierzu zeichnet den Alltag im traditionalen Befehlshaushalt ein wenig informelles Familienklima aus, die Eltern orientieren sich an prinzipiellen Erziehungsmaximen, die nicht oder nur begrenzt hinterfragbar sind. Die geduldeten Machtmittel des Kindes sind gering. Ein tendenziell offenes bzw. traditionales Klima sagt jedoch zunächst nichts aus über die emotionale Tiefe der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Kinder können im modernen als auch im konservativen Familienmodell geliebt, vernachlässigt und überfordert werden.
Zweitens: differenzierende Familienkonzepte hinsichtlich verschiedener Aufenthaltsorte und Zeitrhythmen einzelner Familienmitglieder
Sozialräumliche Aneignung gilt in sozialwissenschaftlichen Kindheitstheorien als ein aktiver und selbstbestimmter Prozess der Subjektentwicklung. ” Räumliche Gegebenheiten stellen Möglichkeiten und Grenzen für das Tun. In den Einteilungen, Abgrenzungen und Entfernungen, in den Ausstattungen und Zuordnungen der räumlichen Welt sind soziale Verhältnisse verfestigt ” (Zeiher, Helga 1994, S. 353). Zeiher und Zeiher beschreiben in ihren Veröffentlichungen verschiedene Kindheiten in verschiedenen Orten und Inseln, Kindheit auf dem Land bietet andere Anregungen als eine Kindheit im Neubauviertel einer Großstadt. Ebenso unterscheiden sich Räume nach ihrer funktionalen Bestimmung. Im Zug der Verdrängung der Kinder von öffentlichen Räumen, Plätzen und Strassen wurden pädagogisch inszenierte Räume gestaltet und eigens den Kindern zugedacht. Eine aktive Raumaneignung ermöglicht es aber auch, dass vorgesehene Funktionen der Räume umgeschrieben werden. Kinder erobern sich öffentliche Räume zurück, sie nutzen die Medienabteilung im Kaufhaus zum kostenlosen Computerspiele n, öffentliche Plätze werden nicht selten von Skatern dominiert. Neben unkonventioneller Nutzung dienen diese Inseln immer auch dem Ausleben einer eigenen Gleichaltrigenkultur. Kinder definieren sich über den aktuellen Moment.
An dieser Stelle ergibt sic h ein rhetorischer Bogen zur zeitlichen Dimension. Zu verschiedenen Zeiten sollen und können Kinder verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Jede Institution weist zudem einen eigenen Zeitrhythmus auf. Der Rhythmus der Schule ist ein anderer als der Rhythmus in der Familie, bzw. der Tagesablauf der Familie wird auf die verschiedenen Zeiten der Schulkinder und berufstätigen Eltern abgestimmt. Kinder sind zunehmend gezwungen, sich in rationale Aushandlungen zu begeben. Das Kind mit dem Handy in der Tasche ist kein ungewöhnlicher Anblick mehr. Aber Kinder wollen trotz dieser habitualisierten Selbständigkeit nicht sich selbst überlassen sein, ”verfügbare Erwachsene” (Böhnisch 1999, S. 131) sind notwendig, um eigene Vorstellungen von den Orten und Dingen mit denen der Erwachsenen zu vergleichen, abzugleichen oder zu verwerfen. Auch hier ist es eine Leistung der Familie, Orte und Zeiten zu regulieren, jede Familie macht es auf eigene Weise.
Drittens: unterschiedliche Familienformen hinsichtlichökonomischer und struktureller Gegebenheiten
Kinder leben in ”heilen” oder ”zerrütteten” Familien, sie leben bei ihren leiblichen oder sozialen Eltern, es gibt eheliche, nichteheliche und gleichgeschlechtliche Gemeinschaften mit Kindern, es formieren sich um die Kernfamilie verwandtschaftliche Netze aus Tanten und Großeltern und es behaupten sich Ein-Eltern-Familien. Für die Kinder stellen diese Konstellationen den jeweiligen Alltag dar. Eltern und Kindern ist es Anliegen, ihre konkrete Situation als eine mögliche Existenzform zu normalisieren, d.h. die alltäglichen Anforderungen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu meistern. In den genannten Familienkonstruktionen werden eigene Kommunikationsformen entwickelt, werden Tagesabläufe und Zeiten arrangiert. Und natürlich kann ein Kind aus einer Familie bestehend aus Vater und Mutter, den Großeltern und Freunden leichter und selbstverständlicher auf ”verfügbare Erwachsene” zurückgreifen. Im Gegensatz hierzu muss eine alleinerziehende Frau dieses Netz in häufig konfliktreicher Beziehungsarbeit erst einmal erschaffen und pflegen. Neuere Muster verfügen noch über keine Selbstverständlichkeiten wie beispielsweise die verwandtschaftliche Beziehung, aber auch diese hat um ihre Legitimation zu kämpfen. Kindern vermitteln diese modernen Konstruktionen eine ”individualistische Botschaft” (Beck-Gernsheim 1999, S. 131). Elisabeth Beck-Gernsheim betont mit dieser Aussage die eigene Leistung der Kinder, wenig erprobte Muster, Trennungen und Bindungen im engsten privaten Raum zu bewältigen.
Eine wichtige Bedingtheit gelingender Kindheit blieb bisher im Vortag ausgespart, eine gesicherte ökonomische Basis. Der Sozialstaat gewährt jedem Kind die zur Entwicklung notwendigen Voraussetzungen, allerdings trägt die Gruppe der Kinder das größte gesellschaftliche Armutsrisiko. In westlich modernisierten Gesellschaften verfügen Kinder definitiv über die geringsten materiellen Partizipationsmittel, sie sind in jedem Fall auf eine familiale und/oder sozialstaatliche Absicherung ihrer Existenz angewiesen. Die neue Armutsdebatte macht auf die Gefahr strukturell bedingter Benachteiligung und Armut von Kindern aufmerksam, diese Tatsache erfuhr erstmalig eine öffentliche und politische Beachtung. Mein Anliegen ist es jedoch im Augenblick weniger auf diese strukturelle Ungerechtigkeit zu verweisen, sondern vielfältige Bilder von Kindheiten und Familienformen zu vermitteln.
Ich gelange zum letzten und zusammenfassenden Punkt meines Referates.
4 Eine Schlussbetrachtung
Kindheit bildet in der modernen Gesellschaft den Rahmen für individuelles selbstaktives Kinderleben. Kindheit ist eingebettet in ein hierarchisches Generationsverhältnis, der Ort der Familie stellt die konkrete Lebenswelt der Heranwachsenden dar. Für viele kindliche Entwürfe jedoch ist Familie keine selbstverständliche Lebensform, sie muss sich neu finden oder neu entwerfen. Und Kinder sollen auch außerhalb von Familie gelingende Lebenswege einschlagen können. Ich wünsche mir ”normale” Kindheit in der ”klassischen” Familie, in neuen Familien, in Pflegefamilien, in Erziehungsstellen und weiteren Einrichtungen der Erziehungshilfe. Ein sozialpädagogischer Zugang könnte heißen, Kindheit muss individuell bewältigt werden. Hierfür müssen Kinder gesellschaftlich breitete und vielfältigere Gelegenheiten bekommen.
Literaturverzeichnis
Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994
Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim, Elisabeth: Individualisierung in modernen Gesellschaften - Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie. In: Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994
Beck-Gernsheim, Elisabeth: Auf dem Weg in die postfamiliale Familie - Von der Notgemeinschaft zur Wahlverwandtschaft. In: Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994
Böhnisch, Lothar: Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung. Weinheim und München 1999
Brück, Brigitte u.a.: Feministische Soziologie. Eine Einführung. Frankfurt/Main 1992
Du Bois-Reymond, Manuela/ Büchner, Peter/ Krüger, Heinz-Herrmann/ Ecarus, Jutta/ Fuhs, Burkhard: Kinderleben. Modernisierung von Kindheit im interkulturellen Vergleich. Opladen 1994 Honig, Michael-Sebastian: Entwurf einer Theorie der Kindheit. Frankfurt am Main 1999 Honig, Michael-Sebastian/Leu, Hans Rudolf (Hg.): Kinder und Kindheit. Soziokulturelle Muster - sozialisationstheoretische Perspektiven. Weinheim und München 1996
Honig, Michael-Sebastian/ Lange, Andreas/ Leu, Hans Rudolf (Hg.): Aus der Perspektive von Kindern? Zur Methodologie der Kindheitsforschung. Weinheim und München 1999
Hitzler, Ronald/Honer, Anne: Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung. In: Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994
Lüscher, Kurt: Politik für Kinder - ein aktueller Zugang. In: Neue Sammlung 3/99
Klocke, Andreas/Hurrelmann, Klaus (Hg.): Kinder und Jugendliche in Armut. Umfang, Auswirkungen und Konsequenzen. Opladen 1998
Menz, Simone: Mädchen auf Abwegen. Ursachen und Zusammenhänge weiblicher Fluchtstrategien am Beispiel junger Ausreißerinnen. Diplomarbeit an der TU Dresden 1996
Metz-Göckel, Siegrid/Nyssen, Elke: Frauen leben Widersprüche. Zwischenbilanz der Frauenforschung. Weinheim und Basel 1990
Zeiher, Harmut J. (Hg): Orte und Zeiten der Kinder. Soziales Leben im Alltag von Großstadtkindern. Weinheim und München 1994
Zeiher, Helga: Kindheitsräume. Zwischen Eigenständigkeit und Abhängigkeit. In: Beck, Ulrich/ Beck- Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994
Zeiher, Heilga/ Büchner, Peter/Zinnecker, Jürgen (Hg.): Kinder als Außenseiter? Umbrüche in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Kindern und Kindheit. Weinheim und München 1996 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland. Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverständigenkommission
Simone Menz
Kindheit und Familie
1. Einbettung der Thematik in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs
In den gemeinsamen Aussagen, Kinder als Mitglieder der Gesellschaft zu betrachten und somit Kindern einen eigenen Subjektcharakter zu ermöglichen, treffen sich Vertreterinnen und Vertreter einer kontrovers geführten Diskussion.
2. Versuch einer Definierung von Kindheit
Kindheit bildet ein normatives Konstrukt. Kindheit kann nur in Bezug zur generationalen Ordnung, dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, Erwachsenen und Heranwachsenden bestimmt werden.
Es werden die sozialen Praktiken, Handlungsmuster, Institutionen und Instrumente zur Gestaltung und Reproduktion von Kindheit und der hierfür geschaffenen generationalen Ordnung thematisierbar.
Das Kind wird zum sozialen Akteur. Es kann sich der jeweiligen sozialen, kulturellen und materiellen Ressourcen seiner konkreten sozialen Umwelt bedienen, gleichsam ist es auf interaktive und kommunikative Angebote und Auseinandersetzung im Rahmen des Generationenverhältnisses angewiesen, um eigene Handlungsfähigkeit und Handlungsentwürfe herzustellen und zu gestalten.
3. Die modernisierte Familie als eine wichtige Bedingung gelingender Kindheit
Familie stellt eine zentrale Strukturkategorie und ein interaktiver Ausdruck des Generationsverhältnisses dar. Familie kann ebenso wie Kindheit nur in der Mehrzahl formuliert werden.
4. Schlussbetrachtung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Vortrags "Kindheit und Familie"?
Der Vortrag behandelt das Thema Kindheit und Familie im Kontext der sich modernisierenden Gesellschaft. Er untersucht die vielfältigen Verläufe von Kindsein unter Berücksichtigung der Einbettung in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs.
Welche Autoren werden im Vortrag besonders berücksichtigt?
Der Vortrag bezieht sich insbesondere auf die Arbeiten von Michael-Sebastian Honig, Lothar Böhnisch und Elisabeth Beck-Gernsheim.
Wie definiert der Vortrag Kindheit?
Kindheit wird als ein normatives Konstrukt definiert, das soziale Praktiken, Handlungsmuster, Institutionen und Instrumente zur Gestaltung und Reproduktion von Kindheit und der generationalen Ordnung umfasst. Kindsein muss interaktiv hergestellt werden, wobei das Kind zum sozialen Akteur wird.
Welche Rolle spielt die Familie in der modernen Kindheit?
Die modernisierte Familie wird als eine wichtige Bedingung für gelingende Kindheit betrachtet. Sie stellt eine zentrale Strukturkategorie und einen interaktiven Ausdruck des Generationsverhältnisses dar, wobei jedoch auch die Individualisierung der Familienmitglieder und die daraus resultierenden Herausforderungen berücksichtigt werden.
Welche verschiedenen Familienkonzepte werden unterschieden?
Der Vortrag unterscheidet Familien bezüglich ihrer Kommunikations- und Interaktionsformen, ihrer Aufenthaltsorte und Zeitrhythmen sowie ihrer ökonomischen und strukturellen Gegebenheiten.
Was bedeutet "Bastelexistenz" im Kontext der modernen Familie?
Der Begriff "Bastelexistenz" bezieht sich auf ein zur Freiheit verurteiltes Leben, in dem Alltagserfahrungen individuell koordiniert und bewertet werden müssen. Dies spiegelt die zunehmende Individualisierung und die Notwendigkeit zur Aushandlung innerhalb der Familie wider.
Welche Rolle spielt der Sozialstaat für Kinder?
Der Sozialstaat gewährt jedem Kind die zur Entwicklung notwendigen Voraussetzungen, allerdings tragen Kinder das größte gesellschaftliche Armutsrisiko. Der Vortrag betont die Abhängigkeit der Kinder von familialer und/oder sozialstaatlicher Absicherung.
Welche Schlussfolgerung zieht der Vortrag?
Kindheit bildet in der modernen Gesellschaft den Rahmen für individuelles, selbstaktives Kinderleben. Ein sozialpädagogischer Zugang könnte darin bestehen, Kindheit muss individuell bewältigt werden. Hierfür müssen Kinder gesellschaftlich breitete und vielfältigere Gelegenheiten bekommen.
Welche Hauptpunkte werden im Vortrag behandelt?
Der Vortrag behandelt folgende Hauptpunkte:
- Einbettung der Thematik in den sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs
- Versuch einer Definierung von Kindheit
- Die modernisierte Familie als eine wichtige Bedingung gelingender Kindheit
- Schlussbetrachtung
Welche Literatur wird im Vortrag zitiert?
Eine umfangreiche Liste der zitierten Literatur wird am Ende des Dokuments bereitgestellt, einschließlich Werke von Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Michael-Sebastian Honig und Lothar Böhnisch.
- Quote paper
- Simone Menz (Author), 2000, Kindheit und Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95224