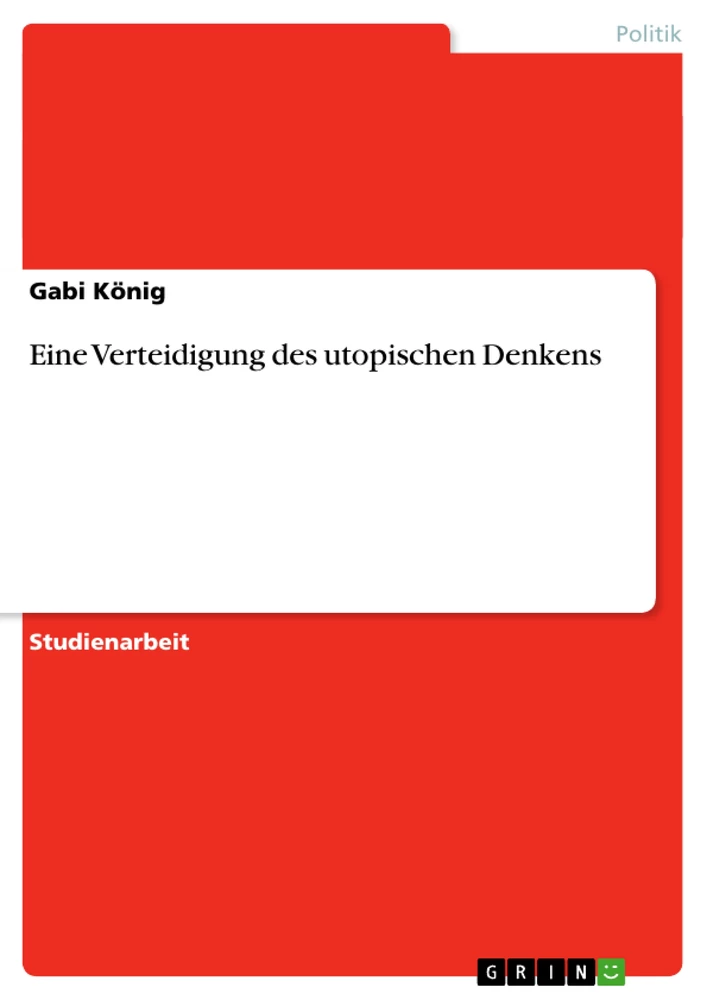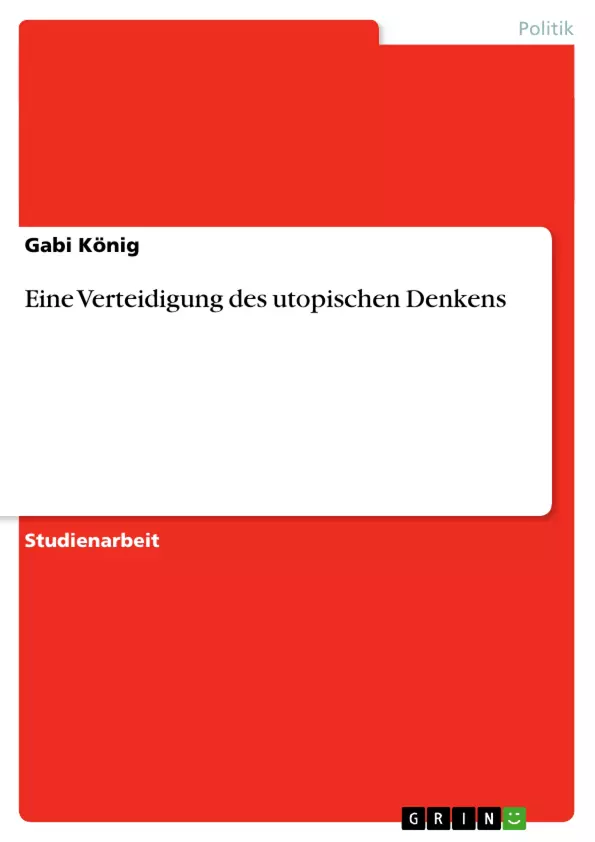Gliederung
I Einleitung
II Hauptteil
1. Die Geschichte der Utopie
1.1. Defintionsbestimmung zum Begriff „Utopie“
1.2. Negative Utopie-Kritik
1.3. Positive Utopie-Kritik
2. Geistige Grundhaltung der Anti-Utopie
2.1. Georges Orwell „1984“
3. Hat der utopische Gedanke „ausgedient“?
4. Von der Notwendigkeit konkreter Utopien
III Fazit
IV Literaturhinweis
I Einleitung
„Mut zur Utopie“ zu fordern, erscheint heute unmoderner denn je. Der Begriff „Utopie“ wird vielfach mißbräuchlich benutzt und wird häufig negativ besetzt. „Utopie“ ist im Sprachgebrauch ständig vorhanden. Utopisch nennt man die Dinge, die man nicht für umsetzbar hält. Die nicht realisierbar zu scheinen mögen. Der Weg zur Utopie wird jedoch außer acht gelassen. Wenn ein Ziel nicht erreichbar scheint, aus welchen Gründen auch immer, dann wird auch gar kein Versuch unternommen, den ersten Schritt dahin zu wagen. Dadurch bleibt der Traum nach einer „besseren“ Welt nur ein Traum. Ist die Utopie denn so utopisch? Und wenn Utopien für so unrealistisch gehalten werden, wie kann dann die Realität verändert werden? Lassen sich im Zeitalter der Massenarbeitslosigkeit, der permanent anhaltenden Umweltzerstörung, der Menschenrechtsverletzungen nicht doch auch Visionen entwickeln? Visionen, die diese Krisen überwinden?
Kann die Politik ohne Utopien eine gute Politik sein? Welche Argumente können wir den Kritikern entgegenhalten?
Antworten auf diese Fragen und noch weitere möchte ich in der nachfolgenden Arbeit aufzeigen.
1. Die Geschichte der„Utopie“
Im Jahre 1516 prägte Sir Thomas Morus den Begriff „Utopie“. Die Veröffentlichung der lateinischen Schrift über den besten Staat und die neue Insel Utopia war die Geburtsstunde des Wortes Utopia, das von da an Einzug in alle Weltsprachen gehalten hat. (vgl. Herbrüggen, 1960, S. 3)
Morus beschrieb eine fiktive Insel, die von einem fiktiven Reisegefährten des Amerigo Vespucci entdeckt wurde, der dort ein ideales Staatswesen vorgefunden haben will. Utopia als ein räumliches Nirgendwo, ein „prinzipiell nonexistenten Ort der Handlung“. (Herbrüggen, 1960, S. 4)
1551 weist das Oxford English Dictionary (OED) eine erste Definition des Begriffes Utopia auf: „1 [a] An imaginary island, depicted by Sir Thomas Morus as enjoying a perfect sozial, legal and political system.“ (Herrbrüggen, 1960, S. 13)
In der erzählerischen Darbietung Thomas Morus ist die Utopie zwischen Fiktion und Realität angesiedelt. Sein erfundenes Gebilde wird zugleich ein bestimmter Realitätsbezug zugesprochen. Aber ob die von T. Morus beschriebene Utopie „eines fiktiven Gemeinwesens mit seinen politischen und sozialen, ökonomischen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, als die beste aller möglicher Welten zu verstehen ist (..) oder nur als eine zwar vorbildliche, aber heidnische Lebensordnung, die von den christlichen Völkern Europas noch übertroffen werden sollte, ist bis heute umstritten.“ (Erzgräber, 1980, S. 14)
1.1. Definitionsbestimmung zum Begriff„Utopie“
Was ist nun inhaltlich mit „Utopie“ gemeint? Was ist utopisch? Im Herder Lexikon „Politik“ finden wir folgende Definition von ´Utopie`: „ w [gr. = nirgendwo], lit. Weltverbesserungsplan (oft als Roman), der, vorwiegend v. der Kritik der jeweiligen gegenwärtigen gesellschaft. Zustände ausgehend, eine ideale Gesellschaftsordnung (Idealstaat) postuliert. Hauptsächl.
Staatsromane, die sich durch soz. fortschrittl. Ordnung u. besondere Betonung v. Erziehung u. kulturellen Milieu auszeichnen, oft mit sozialist.-kommunistischen Tendenz. Moderne U. n. sind häufig pessimist. (negative Utopie) zeigen den Menschen, der den Funktionen der Technik u. der gesellschaftl. Organisation als Individuum hilflos ausgeliefert ist. Als erste Utopie gilt Platons Staat. Th. Morus´Utopia (danach der Begriff) wurde Vorbild für viele U.n.“ (Herder Lexikon, 1992, S. 219)
Hans Ernst weist in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema Utopie hin, somit eine genaue Definitionsbeschreibung nur schlecht möglich macht [Allein die Bibliographie bei Neusüss nennt 700 Titel; vgl. Neusüss, 1986]. Hinzukommen die zahlreichen theoretischen Ansätze und Begriffsbestimmungen. (vgl. Ernst, 1982, S. 9)
Ernst Bloch weist in seinem Buch „Prinzip Hoffnung“ darauf hin, „...daß die ganze Philosophie notwendig wird..., um dem mit ´Utopie` Bezeichneten inhaltlich gerecht zu werden.“
( 1 ) Bloch, 1975, S. 24)
Arnhelm Neusüss werden Fragen über Utopie meist zu kurz oder zu lang beantwortet: „Die Vokabel `Utopie` ist gegenwärtig ungemein beliebt. Will aber einer genauer wissen, was inhaltlich mit ihr gemeint ist, sieht er sich bald in Verlegenheiten. Er steht vor einem Konglomerat höchst verschiedener Definitionsversuche, heterogener theoretischer Ansätze, die allerdings spärlich sind, und einander kaum berührender Begriffsverwendungen, die sich nach- und nebeneinander abgelagert haben.“ (Neusüss, 1968, S. 13) Neusüss weist auch weiter darauf hin, daß der Begriff Utopie um so konturloser erscheint, je weiter er gespannt wird, dessen sollte man sich bei einer theoretischen Arbeit bewußt sein. (vgl. Neusüss, 1968, S. 13f)
Bei der Charakterisierung der ersten Utopie kann man auch von „Wunsch-Räumen“ sprechen. William Morris Veröffentlichung „News from Nowhere“ im 19. Jahrhundert unterscheidet sich von Morus „Utopia“ dadurch, daß er das ideale Staatswesen weit in die Zukunft, in das 21. Jhrd. datiert.
Das utopische Denken und damit auch die literarische Form der Utopie wurde durch die französische Revolution, die eine neue Lebens- und Gesellschaftsordnung durch einen gewaltsamen Umsturz zu verwirklichen versuchte, und die Geschichtsphilosophien des 19. Jahrhundert, die die Idee der Höherentwickung und des zivilisatorischen Fortschritts in den Mittelpunkt rückten, neu geprägt. „Die Utopie wurde nicht mehr nur als eine aus einem fremden Raum geholte Norm verstanden, die der Kritik an zeitgenössischen Verhältnissen zugrunde gelegt werden konnte, sondern - ähnlich wie schon in James Harringtons Oceana aus dem Jahre 1656 - als ein konkretes Ziel, auf das alles politische Handeln auszurichten sei.“ (Erzgräber, 1980, S. 14.)
Utopie wird und wurde auch so verstanden, das ein Weltzustand erscheint bzw. eintritt, der mit Anstrengungen einiger Generationen in (absehbarer) Zukunft erreicht werden könnte. Die Utopie hebt sich auf, wenn sie von der historischen Entwicklung eingeholt wird. (vgl. Erzgräber, 1980, S. 14)
1.2. Negative Utopie-Kritik
Im 19. Jahrhundert machte sich in der Geschichte des Utopie - Begriffes ein Wandel bemerkbar. Der Begriff wurde primär negativ besetzt. Von Seiten der bürgerlichen Wissenschaft wurde utopisches Denken mit den Begriffen des Kommunismus und Sozialismus gleichgesetzt. „Utopie war ein Schimpfwort zur Verunglimpfung angeblicher politischer und philosophischer Scharlatanerie.“ (Beke-Bramkamp, 1990, S. 2)
Friedrich Engels distanzierte sich in seiner Schrift von 1882 „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ von dem Utopie-Begriff der vormarxistischen Sozialisten. Mit seiner Schrift warf er ihnen ein falsches Geschichtsbild und unzureichende Theoriebildung vor. Friedrich Engels: „Dem unreifen Stand der kapitalistischen Produktion, der unreifen Klassenlage, entsprachen unreife Theorien. Die Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben, die in den unentwickelten ökonomischen Verhältnissen noch verborgen lag, solle aus dem Kopfe erzeugt werden.“
(Engels, 1979, S. 54)
Weiter vermißte er in den bisher formulierten Utopie- Vorstellungen eine wissenschaftliche Analyse der Gegenwart und darauf zu gründende Anweisungen zum politischen Handeln in der unmittelbaren Gegenwart. Für Engels und seine Gesinnungsgenossen waren die bisher verfaßten utopische Werke „überholt“. „Die moderne negative Bedeutung Utopie = `Hirngespinst, von der wir ausgingen, dürfte durch die Engels´sche Polemik gegen die traditionelle Utopien mitbeeinflußt sein.“ (Erzgräber, 1980, S. 15)
Engels jedoch stärkte den vormarxistischen Sozialisten gegenüber der bürgerlichen Wissenschaft den Rücken in dem er den Ideenreichtum der vormarxistischen Theoretiker hervorhob: „Wir freuen uns lieber der genialen Gedankenkeime und Gedanken, die unter der phantastischen Hülle überall hervorbrechen und für die jene Philister blind sind.“ (Engels, 1979, S. 54)
In der kritischen Diskussion des Utopie-Begriffes und der Tradition lassen sich derzeit dementsprechend verschiedene Schulen unterscheiden. Arnhelm Neusss hat in seinem im Jahre 1968 erschienenden Buch „Begriff und Phänomenen des Utopischen“ die liberalistische und konservative Utopie-Kritik gegenübergestellt. Die liberalistische Utopie-Kritik vergiß in ihrer Kritik nicht „Kritisches auch gegen die gesellschaftliche Wirklichkeit voranzubringen.“ (Neusüss, 1968, S. 35)
Zu der konservativen Utopiekritik führt er aus: „Die konservative Utopiekritik folgt entweder der Betonung des machtvoll Faktischen, das als das Normative selber ausgegeben wird, oder sie gehorcht der Furcht vor der sozialen und politischen Wirkmächtigkeit utopischer Impulse, je nachdem, welche Affektlage die Zeitumstände nahelegen, meist aber beidem zugleich.“ (Neusüss, 1968, S. 35)
1.3. Positive Utopie-Kritik
Im 20. Jahrhundert erfolgte durch Ernst Bloch und Karl Mannheim der Begriff „Utopie“ eine positive Bedeutung. „Sie lösten sich von dem bisher gültigen Axiom Utopie gleich Staatsroman (bzw. theoretischer Entwurf eines perfekten Gesellschaftssystems) und verstanden Utopie als eine Kritik der bestehenden Gesellschaft durch Antizipation einer besseren Ordnung “ (Beke-Bramkamp, 1990, S. 3)
Utopie als ein Prozeß, als ersten Ansatz zur politischen Veränderung. Bloch verstand Utopie als einen Bewußtseinsprozeß. Die Kritik an den bestehenden Verhältnissen geht mit dem Willen zur Veränderung einher. „Die undialektisch herangebrachte Träumerei war Nebel der Sache, und im Nebel lagen - obwohl mit Unterschi eden - alle die Wunschzeiten und Wunschträume der alten Utopie. Auch standen die meisten alten Utopien in der ihnen gegebenen Wirklichkeit still, ..., sie kannten keinen Prozeß und keine Totalität der Erneuerung.“ ( 1 ) Bloch, 1962, S. 217f)
Für Bloch gelten Welten oder Gebilde, die nur gedacht, vorgestellt und ausgesprochen werden, nur als „Nebel der Sache“, als „Wunschzeiten und Wunschräume der alten Utopie.“ Die neue Utopie ist aber widersprüchlich zur ursprünglichen Vorbedeutung, „nur um der zu erreichenden Gegenwart willen“ da. ( 2 ) Bloch, 1975, S. 366)
„Wie statt der immer wieder vorüberfliegenden Augenblicke oder der bloßen Schmeckpunkte ein Anhalt sein soll, so soll auch statt der Utopie Gegenwart sein und in der Utopie wenigstens Gegenwart in spe oder utopisches Präsens; es soll zu guter Letzt, wenn keine Utopie mehr nötig ist, Sein wie Utopie sein.“ ( 2 ) Bloch, 1975, S. 366)
Bloch versteht die Utopie als Kritik vorhandener Zustände ein Moment gesellschaftsverändernder Praxis in theoretischer Form. Die Utopie soll objektiv die wachsamste Aufforderung, zu Handeln subjektiv soll sie es sein. Utopie ist in ihrer konkreten Gestalt der geprüfte Wille zum Sein des Alles. Das Alles steht hier für die Identität des zu sich gekommen Menschen mit seiner für ihn gelungenen Welt. (vgl. Bake-Bramkamp, 1990, S. 6)
Karl Mannheim fügt dem Bloch´schen Ansatz zur Verwirklichung der Utopie noch ein Kriterium hinzu. „Für ihn ist Utopie ein Bewußtsein, das sich mit dem es umgebenden Sein nicht in Deckung befindet.“ (Beke-Bramkamp, 1990, S. 7)
Das entscheidende Kriterium für Mannheims Utopieverständnis ist die Verwirklichung. Beke-Bramkamp interpretiert Mannheims Utopieverständnis als „...dynamischen Charakter der Wirklichkeit in Betracht“ zieht, „indem er nicht von einem Sein überhaupt ausgeht, sondern von einem konkret historischensozial bestimmten und sich stets wandelnden Sein. (vgl. BekeBramkamp, 1990, S. 8)
Polak zieht ein positives Fazit der Bloch´schen und Mannheims Überlegungen: „In historischer Sicht spiegelten diese Zukunftsbilder nicht nur die Gestalt der kommenden Dinge wider, sondern sie gaben diesen Dingen auch Form und Gestalt und leiteten ihr Kommen ein. Magnetisierende Zukunftsbilder und ihre Propheten gestalteten die Geschichte der Zukunft. Sie machten Geschichte, indem sie diese Zukunft schufen und ihre eigenen Verheißungen erfüllten. Sie waren wie mächtige Zeitbomben, die ihn der Zukunft explodierten und einen mächtigen Kraftstrom freisetzten, der dann zurück zur Gegenwart floß, die ihrerseits in diese Zukunft hineingedrängt wurde.“ (Polak, 1970, S. 308)
2. Geistige Grundhaltung der Anti-Utopie
Die kritische Gegenbewegung gegen das utopische Denken formierte sich zu Beginn des 20. Jahrhundert. Werke von H. G. Wells „Time Machine“, Aldoous Huxleys „Brave new world“ und George Orwells „Nineteen Eighty-Four“ beschreiben literarische Darstellungen utopischer Gesellschaftszustände - die wiederum zur Entstehung der „Anti-Utopie“ führten. „Huxleys kritisiert die Übersteigerung naturwissenschaftlichen Denkens und die (möglichen) Einflüsse dieses Denkens auf die Umgestaltung der sozialen und politischen Verhältnisse; Orwell dagegen ist stärker mit der politischen Entwicklung der Gegenwart befaßt: Seine Anti-Utopie zielt auf die Auswirkungen der technokratischen Denkens im Faschismus und Kommunismus (stalinistischer Prägung).“ (Erzgräber, 1980, S. 15f)
Erzgräber weist auf den wesentlichen Unterschied zwischen Huxleys und Orwells Werken: „In Huxleys Neuer Welt gibt es keine politischen Spannungen zwischen Machtblöcken, keinen Krieg (..).” (Erzgräber,1980, S. 17)
Ihre Kritik an den möglichen Entwicklungen in der Zukunft ist mit Furcht besetzt, daß die Würde des Menschen durch eine „Perfektionierung des Staates“ ausgelöscht wird.
2.1. Georges Orwell„1984“
Die Veröffentlichung Orwells Werk „1984“ löste weltweite Diskussionen aus. Orwell stellt eine Alptraumwelt dar, die voller Hoffnungslosigkeit ist.
Diese Hoffnungslosigkeit war auch der Spiegel seines eigenes Lebens, hatte er doch viele seelische Stationen in seinem Leben erfahren müssen. Auf die politische Welt hat sein Werk unterschiedlichen Einfluß ausgelöst.
(vgl. Schulte-Herbrüggen, 1960, S. 163)
„1984“ stellt einen sozialistischen Superstaat, namens Ozeanien, dar. Sowohl die staatliche und die gesellschaftliche Ordnung bezeichnet er als Kollektivismus. Die politische Macht liegt in den Händen einer politischen und intellektuellen Elite der Partei, die sozialisitische Grundsätze proklamieren: Wegfall des Privateigentum, kein Kapitalismus, die staatliche Kontrolle aller Produktionsmittel, um die breite Masse besser beherrschen zu können. „Das Ziel politischen Handelns in diesem Staat ist die ungehinderte Ausübung von Macht (..)“. (Erzgräber, 1980, S. 173)
Die installierte totalitäre Ministerialmaschinerie überwacht das Leben des einzelnen Staatsbürgers, bis weit in die Intimsphäre.
Der Alltag ist von ideologischer Schulung, Arbeitsnormen, Polizeiterror und Haßpsychosen geprägt. Die Hauptfigur des Wellsen´s Roman stellt Winston Smith dar. Er „kleidet“ das Amt eines Beamten im sog. „Wahrheitsministeriums. Seine Aufgabe besteht darin, die geschichtliche Vergangenheit jeden Tag so umzuschreiben, daß sie dem aktuellen Stand der Parteilinie entspricht. In einem Dialog zwischen ihm und einer weiteren Hauptfigur namens O´Brian stellt letzterer das Verhältnis zwischen der Partei und der Macht dar. Mit Hilfe von Macht kann das Ziel erreicht werden, daß allen Utopien gemeinsam, daß Paradies freier und gleicher Menschen von O´Brian negiert.
Nach den Worten von O´Brian unterscheidet sich der Staat, dem er angehört von faschistischen und kommunistischen Staaten dadurch, daß eben kein utopisches Ziel vorgegeben ist.
(vgl. Erzgräber, 1980, S. 174)
Der Staat in „1984” ist allmächtig und allwissend. Von Liebe, Güte oder gar Gnade ist in diesem Staat nichts erhalten. Menschen, die solche Regungen zeigen, werden auf massivste Weise unterdrückt. Wer Widerstand leistet, wird entweder umerzogen und geläutert, so wie es Winston Smith im Laufe des Romans ergeht, oder aber er wird liquidiert.
„Gleich Huxleys Neuer Welt ist auch der Staat in 1984 auf die Erhaltung seiner Stabilität bedacht; er gleicht einem Perpetuum mobile, das ständig in Bewegung ist und sich doch nie verändert.“ (Erzgräber, 1980, S. 174)
Im weiteren Vergleich von Huxley und Orwell kann man eine weitere Parallele erkennen, die in der lückenlose Ausrichtung des gesamten Lebens auf den Staat liegt. „Während der verhinderte Arzt Huxley die Bürger seiner wackeren neuen Welt durch medizinische Mittel (Eugenik und Pharmaka) auf die optimale Staatsräson hin konditioniert, erreicht Orwell dieses politische Ziel auch durch politische Mittel, vor allem durch die Propaganda, die hier über die Sprache das Denken der Menschen absolut beherrscht.“ (Schulte-Herbrüggen, 1960, S. 180)
Welche Motivation hatte Orson Welles, als er den Roman „1984“ schrieb? Warum so ein düsteres Werk, warum so eine düsterer Ausblick in die Zukunft? Schulte-Herbrüggen bringt es bei seiner Analyse wie folgt auf den Punkt: „Hinter dieser totalen Verfinsterung der künftigen Welt steht die Moral, jetzt alles zu tun, um eine solche Entwicklung zu verhindern; später nämlich würde es nicht mehr möglich sein, dagegen auch nur das Geringste zu unternehmen. So gesehen, gehört 1984 nicht in die Kategorie der ´horror fiction`; es ist vielmehr ein Werk von hohem moralischen Anspruch. Ist die Vision jener kommenden Welt auch vollkommen ausweglos, so spricht doch gerade die Tatsache, daß Orwell solch ein Schreckensbild seinen Lesern vorsetzt, von seiner persönlichen Hoffnung, daß es für eine Rettung jetzt noch nicht zu spät, die düstere Botschaft deshalb nicht sinnlos sei.“
(Schulte-Herbrüggen, 1960, S. 181)
Erzgräber unterstreicht die Ansicht von Schulte-Herbrüggen: „Als autonomes Werk verstanden, ist der Staat, den Orwell schildert, eine Schreckensvision...(..) Als Teil von Orwells politischer Strategie verstanden, erscheint das Werk als ein Instrument der politischen Schocktherapie, ..“
(Erzgräber, 1980, s. 198)
Orwells Anti-Utopie ist verglichen zu den davor verfaßten utopischen Gedanken ebenfalls aus dem Bewußtsein einer tiefen Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit entstanden. „Bestand die Gegenbildlichkeit in der Utopia [Thomas Morus. Anm. d. A.] in der Vorstellung staatlicher Idealnormen als Postulat, so ist an deren Stelle hier eine Art photographisches Negativ eines Idealstaates als Warnung an die Gegenwart getreten, doch zeigen beide, Utopie und Anti-Utopie, durch ihre Gegenbildlichkeit der Welt, was ihr an Ideale mangelt.“
(Schulte-Herbrüggen, 1960, S. 182)
3. Hat der utopische Gedanke„ausgedient“?
Nach dem Zusammenbruch des realexistierenden Sozialismus und seit Beendigung des kalten Krieges, ist der Begriff „Utopie“ zunehmend unmoderner geworden. „Neuerdings sind Utopien aller Art prinzipiell in Verruf geraten. Hierbei werden sie auf eine Form der Utopie reduziert, die bis in ihren selbstgewählten Begriff hinein alles Utopische scheute, nämlich die Form des ´realen Sozialismus`.”(Narr, 1992, S. 37)
Hans Magnus Enzensberger will von der Utopie nur noch in Form eines Nachtrages sprechen und sieht einen „Alltag angebrochen, der ohne Propheten auskommt“.
(Enzensberger, 1992, S. 65)
Ähnlich erleichtert prognostizieren konservative Publizisten wie Joachim Fest ein „Ende des utopischen Zeitalters.“ (Fest, 1991, S. 84)
Im Nationalsozialismus und „Realsozialismus“ sieht Fest die Exponenten der Utopie schlechthin, da Fest zufolge die Utopie „ihrem Wesen nach stets eine totale Gesellschaft“ verlangt. (Fest, 1991, S. 84)
Ernst Nolte unterstreicht das abschreckende Bild der gewalttätigen und totalitären Utopie, indem er die politische Utopie an eine Gruppe bindet, „die sie gewaltsam umsetzt.“ (Nolte, 1992, S. 12)
Ein wenig differenzierter läutete Hans Jonas bereits einige Jahre zuvor das Ende der Utopie ein. Jonas führte die Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen durch die rücksichtslose Ausbeutung der Natur auf die „Utopie des Fortschritts“ zurück, eine Utopie, die Jonas zufolge die westlichen Industriegesellschaften ebenso geprägt habe wie die ehemaligen Ostblockländer. (vgl. Jonas, 1984, S. 386)
Die häufigsten Kritiken an politischer Utopie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Utopie zielen auf einen „neuen Menschen“ und rechtfertigen damit brutale Auslöschung, Unterdrückung und Umerziehung.
- Utopien sind statisch und blenden die Geschichtlichkeit von Mensch und Gesellschaft aus.
- Utopien ordnen rigoros das Individuum dem Ganzen unter, sind autoritär, elitär, antidemokratisch.
- Utopien erheben Anspruch auf Universalität
- Utopien basieren auf einem ökologischen sowie zielgerichteten Fortschrittsbegriff.
(vgl. Saage, 1992)
Solche Utopiekritik suggeriert: Ein Leben ohne Utopie ist der Preis der Menschlichkeit. Weil die Träume vom besseren Leben geholfen haben, Unmenschliches herbeizuführen, soll ein Traumverbot gerechtfertigt sein.
(vgl. Klenner, 1992, S. 55)
Fritz Vilmar, Friedensforscher und Politikwissenschaftler, antwortete 1993 in einem Interview, auf die Frage, warum der utopische Gedanke wichtig sei: „Daß man keine gute Politik machen kann, weder im großen noch im kleinen, ohne Entwürfe eines noch nicht Seienden zu wagen, weil das bloße Verharren, das bloße Fortschreiben dessen, was ist, mit einigen kleinen Variationen, uns nicht aus den Grunddilemmata, den selbstzerstörerischen Tendenzen in der Arbeitswelt, in der Sexualität, in der Familie, in der Demokratie, aber eben auch in den außenpolitischen Beziehungen hinausführt. Ich muß über eine neue Art des Verhältnisses der Geschlechter nachdenken, die nicht geprägt ist, durch die monogame Ehe, ich muß nachdenken über eine Arbeitswelt, die nicht geprägt ist durch das Fließband und durch die hierarchische Befehlsstruktur. Ich muß über eine Form von Demokratie nachdenken, die sich nicht reduziert auf Repräsentation und ich muß eben auch über eine außenpolitische Ordnung nachdenken, die nicht geprägt ist durch die Dominanz und Rüstungswettlauf. Das alles erfordert Realutopien, d. h. Entwürfe dessen, was noch nicht in der gegenwärtigen Politik und meistens noch nicht einmal in der politischen Theorie vorhanden ist, die meist nur Bestätigung, Verfestigung oder nur technokratisches ´Reformen´ des Bestehenden liefern.” (Seiffert/Wasmuth, 1994, S. 219)
Vilmar betont in dem Interview u. a. auch, daß wir weniger eine große Utopie brauchen, sondern viele „kleine“ Utopien. Der Mensch braucht eine Utopie, die er selber verwirklichen kann, aber die Sozialstaatsziele werden dadurch nicht unnötig. Er wünscht sich einen Staat, den den Rahmen läßt für Menschen, die neue Formen der Gemeinschaft, der Unternehmen, Schule, Ehe, usw. ausdenken und realisieren. Herrschaft in Lebens- und Arbeitsformen sollen abgebaut und abgeschafft werden. (vgl. Seiffert/Wasmuth, 1994, S. 219)
Robert Jungk hat in seinem Aufsatz „Utopien denken und Utopien verwirklichen“ den utopischen Gedanken verteidigt: „ Angesichts der rasch zunehmenden Bedrohung allen Lebens auf dieser Erde hat in der letzten Hälfte des Jahrhunderts ein Umdenken begonnen, das immer mehr Menschen erfaßt. (...) Noch leben wir zwar in einer Risikogesellschaft, deren Entscheidungsträger in der Mehrzahl durch einen Mangel an politischer Phantasie, Verantwortung und Mut gekennzeichnet sind, aber die Betroffenen sind ihren Herren in Wirtschaft und Staat voraus. Sie drängen sie zu Schritten, die diese nicht wagen wollen angesichts der zunehmenden Zerstörung aller natürlicher Grundlagen eine Ressource allen Beschädigungen zu widerstehen und sie zu überdauern vermag: der leidende, bedrängte und dennoch denkende, erfindungsreiche, handelnde Mensch. Er muß nicht Opfer der von anderen Menschen zur Steigerung ihrer Macht eingesetzten Instrumente werden, sondern kann sich aktivieren und auf die täglich neubeginnende Zukunft Einfluß nehmen.“ (Jungk, 1990, S. 4)
Jungk sieht aber auch, daß die Zahl derer steigt, die resignieren. Die meinen, es sei schon zu spät, die vielen Fehler wie z. B. Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung oder Versäumnisse noch zu verhindern. Alles was dagegen unternommen werde, sei ungenügend. Doch Jungk verteidigt seinen optimistische Haltung. Er begründet seine Zuversicht auf vorzeigbare Beobachtungen der Gattung Mensch, Krisen zu erkennen und weitgehend zu bewältigen. Für ihn ist es kein blinder Optimismus sondern das Ergebnis einer aufmerksamen und erwartungsvollen geschichtlichen Bestandsaufnahme. Jungk glaubt an die0 Fähigkeit der Menschen, Mißstände zu erkennen und an den Willen, für eine „bessere“ Welt einzustehen.
Aber wie kann die Menschheit die Fülle der Probleme bewältigen? Wie wird sie mit der Herausforderung fertig? Wie aber kann die Lösung der vielen drängenden Fragen angegangen werden? „So bleibt die Aufforderung von damals bestehen, ja sie wird angesichts der Lawine ungelöster Probleme, die auf uns zurast, noch dringlicher als bisher. Wenn ich auf meine publizistische und gesellschaftliche Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten zurückblickte, so erscheint mit der Versuch, politische Phantasie und soziale Erfindungstätigkeit zu aktivieren, am sinnvollsten. Dabei wende ich mich nicht nur an diejenigen, die beruflich mit gesellschaftlichen Problemlösungen befaßt sein sollten, sondern vor allem an die große Menge der Betroffenen, die nicht mehr warten können und nicht mehr warten sollten, daß Experten ihnen sagen, was zu geschehen habe. (...)“ (Jungk, 1990, S. 5f)
4. Von der Notwendigkeit konkreter Utopien
Utopien entwickeln sich im Widerspruch zwischen realem gesellschaftlichen und wünschbarem Sein. Sie sind nicht zufällige idealistische Hirngespinste, sondern Reaktions- und Verarbeitungsmuster der konkreten Wirklichkeit. Im Krieg sehnen wir uns nach Frieden, haben wir Hunger, wollen wir Brot, sind wir eingesperrt, wollen wir uns befreien. Der von Ernst Bloch verwendete Begriff der „konkreten Utopie“ verweist auf diese Dialektik von realem und vorgestellten Dasein. Sie entzündet sich an wahrgenommener Realität und ist somit gesellschaftlich determiniert. Indem sich konkrete Utopie gegen die Macht der tatsächlichen Verhältnisse auflehnt, legt sie Vorstellungen frei, „die die bestehende Gesellschaft unterminieren und sprengen oder eine Sprengung vorbereiten mit dem Traum von einer schöneren Welt, einer besseren Gesellschaft.“ ( 3 ) Bloch, 1980, S. 70)
Zusammenfassend soll festgestellt werden: Utopisches Denken und Handeln entzündet und entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Realität, mit konkreten Lebens- und Leidenserfahrungen.
„Indem gegengesellschaftliche Entwürfe und selbstbestimmte Sozialisationsverläufe antizipiert werden, entwickeln sich identitätsstiftende Lern- und Handlungskompetenzen, die nicht mehr ohne weiteres in den herrschenden Vergesellschaftsmodus des Sichgewöhnens an den Kapitalismus integriert werden können. Die Gesellschaft kann nicht durch Menschen geändert werden, die die Defekte der ´alten´ Gesellschaft ungebrochen mit sich herumschleppen. Die Dialektik von Selbst- und Gesellschaftsveränderung, von Emanzipation und Politik, schließt sowohl „subjektivistische“ als auch „objektivistische“ Lösungen aus.“ (Manke, 1981, S. 204f)
Utopisches Denken beansprucht die Fähigkeit zu Lernen. Lernen ist nur möglich, wenn wir uns ändern können, wenn wir plastisch prägsam, phantasievoll und gestaltungsfähig sind. Für die Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen ist entscheidend wichtig, an welchen Orientierungsmustern Menschen sich auszurichten vermögen. „Und deswegen sind Zukunftsorientierungen, Entwürfe, ja Utopien für Menschen, gerade für ihr Leben hier und heute und die Art dieses Lebens hier und heute, so ungemein bedeutsam.“ (Narr, 1992, S. 43)
Gesellschaftliche ökonomische und ökologische Mißstände muß man sich bewußt machen. Der Mensch muß sich der Situation bewußt werden. Nach Erich Fromm bedeutet „Bewußtwerden“, „für etwas wach zu werden, das man gefühlt oder gespürt hat, ohne es zu denken, aber immer schon geahnt hat.
Es ist ein Prozeß, der ein belebende und kraftgebende Wirkung hat, weil es ein innerer aktiver Prozeß ist und kein passiver Vorgang des Hörens, Übereinstimmtes oder Widersprechendes.“ (Fromm, 1992, S. 63)
Erich Fromm sieht diese Notwendigkeit, die sich auf das gesamte System beziehen muß und nicht nur auf Teilaspekte. Es genügt nicht, das Kriege sinnlos, gefährlich und unmoralisch sind, daß Konsum das Glück nicht erhöhen oder gar gewährleisten sondern nur die Langeweile betäuben. Das System bringt diese Symptome hervor. Es hilft also nicht, nur die Symptome zu bekämpfen, vielmehr gilt es, das System zu verändern. Es gilt, die Tatsache eines in zunehmenden Maße bürokratisierten Industriesystems bewußt zu werden, „dessen Leitwerte Macht, Prestige und Vergnügen sind, und das von den Prinzipien der maximalen Produktion bei minimaler Reibung programmiert wird.“ (Fromm, 1992, S. 64)
E. Fromm sieht darin eine entmenschlichstes System. Nicht der Mensch beherrscht die Maschinen, wie noch im 19. Jahrhundert, sondern die Maschinen beherrschen den Menschen. Und dieses System funktioniert nur, weil der Mensch sich damit arrangiert. „Wenn sie es ändern wollen, dann kann es auch geändert werden, solange es demokratische Prozesse gibt.“ (Fromm, 1992, S. 64)
Die Gesellschaftskritik reicht aber alleine nicht aus. Die Menschen müssen eine Alternativen vor Augen haben. Erich Fromm: „Tatsächlich ist eines der Haupthindernisse, vernünftig und angemessen zu handeln, darin zu sehen, daß die Menschen entweder keine Alternativen zum Status Quo erkennen oder ihnen falsche und demagogische Alternativen dargeboten werden, mit denen ihnen eindringlich bewiesen werden soll, daß es keine echten Alternativen gibt.“
(Fromm, 1992, S. 64f)
Also müssen Alternativen gesucht werden. Es kommt auf die Vielfalt der Fragestellungen und Forschungsergebnisse an. Kann das Mögliche nicht nur dann verwirklicht werden, wenn man nach dem Unmöglichen strebt? Für Fritz Vilmar ist es selbstverständlich, daß die Politische Wissenschaft die Utopie braucht. Wissenschaft soll nicht um der Wissenschaft willen betrieben werden, die Gesellschaft darf nicht übersehen werden. Wenn man die Begriffe Ideologie und Utopie vergleicht, stellt man einen Unterschied fest. Nach Karl Mannheim ist die Ideologie demzufolge die Rechtfertigung der bestehenden Herrschafts- und Eigentumsordnung, die Utopie dagegen verwirft und kritisiert das herrschende Gesellschaftssystem. Gegen eine unkritische, ideologische Verherrlichung der schlechten Welt bäumt sich das utopische Bewußtsein auf. Für die Ideologie ist also charakteristisch, daß hier die Gegenwart als die Fortsetzung der Vergangenheit erscheint, während bei der Utopie die Gegenwart ganz vor der Zukunft verblaßt. Nach Mannheim, stellen die Utopie wie vor allem aber die Ideologie Weltanschauungen dar, die einseitig von den begrenzten und vorübergehenden Interessen bestimmter Klassen, Gruppen oder Schichten geprägt sind - Ideologie ist insofern das „falsche“ Bewußtsein der herrschenden Klassen. Utopie ist hingegen das der unzufriedenen Massen. (vgl. Mannheim, 1952, S. 5ff)
III Fazit
Heute ist der Blick für die Zukunft vielfach verlorengegangen. Utopische Entwürfe scheinen unmodern, aber das hängt auch sicherlich damit zusammen, daß der Staatssozialismus kläglich gescheitert ist. Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung schreiten in einem Fort. Gewalt bleibt weiterhin ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung und Kriege (Irak- USA) werden wieder denk- und ausführbar. Hinzu kommt eine große soziale und politische Orientierungskrise.
Es fehlt an Alternativen!
Doch meiner Ansicht nach ist Politik ohne Utopie unvorstellbar. Wir benötigen dringend Ziele, müssen Alternativen zum Bestehenden erproben. Und der Weg ist genauso wichtig wie das Ziel. Wir dürfen den zukünftigen Generationen nicht die Lebensbasis entziehen.
Wir wissen unendlich viel, verfügen über mehr Informationen, als je zuvor dem Menschen zugänglich waren, aber gleichzeitig verstehen wir immer weniger von dem, was unser Leben bestimmt, verlieren immer gründlicher den Überblick und die Orientierung. Diesen Widerspruch gilt es zu überwinden. Wir brauchen Visionen für die Zukunft der Arbeit und der Gesellschaft.
Der Fortschritt soll eine Sprache sprechen, der nicht nur den Verstand beeindruckt sondern auch das Herz. Träume soll man mit der Realität und umgekehrt konfrontieren, nur dann lassen sich bestehende Verhältnisse verändern. Wir brauchen positive Perspektiven. Utopien können den „lähmenden“ Zustand bekämpfen. Sie können ein Lichtblick sein, in Phasen der Resignation und Stagnation.
„Eine Karte, auf der das Land „Utopia“ nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick.“ (Oscar Wilde)
„Wir träumen von ´ner Revolution hier,
doch wer will schon, daß dabei Blut fließt.
Wenn du dich mitbringst, mag sein, daß es gelingt, dich ganz und deinen Traum mitbringst,
mag sein, daß es gelingt.“ (bots/danzer)
„Was ist unsere politische Verantwortung?
Eines sicher nicht: Resignation, Zynismus, Denkfaulheit und Mangel an Phantasie.“ (Jutta Ditfurth)
„(...)Möchten die Tagträume also wirklich voller werden, das ist, heller, unbeliebiger, bekannter, begriffener und mit dem Lauf der Dinge vermittelter Denken heißt überschreiten.“ (Ernst Bloch)
„Leben einzeln und frei
wie ein Baum und
brüderlich wie ein Wald
ist unsere Sehnsucht“ (Nazim Hikmet)
IV Literaturverzeichnis
Beke-Bramkamp, R.: Die Bedeutung der Utopie in der Rezeption des vormarxistischen Sozialismus. Beiträge zur Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft. Diskussionspapier. Nr. 34/90, 1990
1 ) Bloch, Ernst: Zur Originalgeschichte des Dritten Reiches, aus: Erbschaft dieser Zeit - 1935 - erwe. Aufl., Frankfurt a.M. 1962; in: Neusüss: Utopie, S. 217f)
2 ) Bloch, Ernst: Prinzip Hoffnung; Bd. 1 - 3, Suhrkamp TBW, 6. Aufl., Frankfurt a.M. 1975
3 ) Bloch, Ernst: Abschied von der Utopie? Vorträge. Frankfurt a. M. 1980
Engels, Friedrich: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Berlin 1979
Enzensberger, Hans Magnus: Gangarten. Ein Nachtrag zur Utopie, in: Saage, R. (Hrsg.): Hat die politische Utopie eine Zukunft?, Darmstadt 1992
Ernst, Hans: Utopie und Wirklichkeit auf dem Utopiebegriff bei Paul Tillich, Berlin 1982
Erzgr ä ber, Willi: Utopie und Anti-Utopie in der englischen Literatur: Morus, Morris, Wells, Huxley, Orwell, München 1980
Fest, Joachim: Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters, Berlin 1991
Fromm, Erich: Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen; Schriften aus dem Nachlaß, Bd. 8; Weinheim, 1992
Herder Lexikon: Politik, Freiburg 1992
Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1976
Jungk, Robert: Zukunft zwischen Angst und Hoffnung. Ein Plädoyer für die politische Phantasie. München 1990
Klenner, H.: Rückblick aus dem Jahre 1992 auf das Jahr 1652. Rechtsphilosophisches zum Nowhere des Nowere, in: Saage, R. (Hrsg.): Hat die politische Utopie eine Zukunft?, Darmstadt 1992
Manke, Wilfried: Neue soziale Bewegungen und linke Politik. Die verschlungenen Pfade der Utopie, in: Kremeyer u. a. (Hrsg.): Heute schon gelebt? Alltag und Utopie. Offenbach 1981
Mannheim, K.: Ideologie und Utopie. Frankfurt a. M., 1952
Narr, Wolf-Dieter: Nach den Umbrüchen in Osteuropa - Verlust der politischen Utopie?; in: Kühne/West (Hrsg.): Verlust der politischen Utopie in Europa; Berlin 1992
Neus ü ss, Arnhelm (Hrsg.): Begriff der Phänomene des Utopischen (Soziologische Texte, Bd. 44), Frankfurt, 1986
Nolte, Ernst: Was ist oder was war die „politische“ Utopie, in: : Saage, R. (Hrsg.): Hat die politische Utopie eine Zukunft?, Darmstadt 1992
Polak, Frederik L.: Utopie und Kulturerneuerung, in: Manuel, Frank (Hrsg.): Wunschtraum und Experiment. Vom Nutzen und Nachteil utopischen Denkens, Freiburg 1970.
Saage, R. (Hrsg.): Hat die politische Utopie eine Zukunft?, Darmstadt 1992
Schulte-Herbr ü ggen, Hubertus: Utopie und Antiutopie. Von der Strukturanalyse zur Strukturtypologie, Bochum 1960
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht das Konzept der Utopie, seine Geschichte, Kritik und seine Relevanz in der heutigen Zeit. Es werden verschiedene Definitionen und Interpretationen von Utopie vorgestellt, sowohl positive als auch negative Kritiken analysiert und die Notwendigkeit konkreter Utopien für die politische und soziale Entwicklung diskutiert.
Wer sind die Hauptfiguren, die im Dokument erwähnt werden?
Das Dokument erwähnt eine Vielzahl von wichtigen Persönlichkeiten, darunter Sir Thomas Morus, Friedrich Engels, Ernst Bloch, Karl Mannheim, George Orwell, Aldoous Huxley, Hans Jonas, Erich Fromm und Fritz Vilmar. Ihre Beiträge zur Definition, Kritik und Verteidigung des utopischen Denkens werden im Einzelnen beleuchtet.
Was sind einige der Schlüsselkonzepte im Zusammenhang mit der Utopie, die in dem Dokument behandelt werden?
Das Dokument behandelt Schlüsselkonzepte wie: Definitionen von "Utopie", negative und positive Utopiekritik, Anti-Utopie (insbesondere in Bezug auf George Orwells "1984"), konkrete Utopien, die Rolle von Utopien in der Politik und die Bedeutung utopischen Denkens für die gesellschaftliche Veränderung und Problemlösung.
Was sind die Hauptpunkte der negativen Utopiekritik, die in dem Dokument diskutiert werden?
Die negative Utopiekritik im Dokument beinhaltet Bedenken hinsichtlich des totalitären Charakters von Utopien, der Unterdrückung des Individuums im Namen des Ganzen, dem unrealistischen Fortschrittsglauben und der Gefahr, dass Utopien zur Rechtfertigung von Gewalt und Umerziehung genutzt werden.
Was sind die Hauptargumente für die Notwendigkeit konkreter Utopien?
Das Dokument argumentiert, dass konkrete Utopien notwendig sind, um Alternativen zum Status Quo zu entwickeln, politische Phantasie und soziale Erfindungstätigkeit zu aktivieren, einen Rahmen für neue Formen der Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu schaffen und die Reflexion über gesellschaftliche Missstände zu fördern.
Was ist die Rolle von George Orwells "1984" in der Diskussion über Utopie?
Orwells "1984" wird als Beispiel für eine Anti-Utopie dargestellt, die die Gefahren eines totalitären Staates und der Unterdrückung des Individuums durch Machtmissbrauch veranschaulicht. Es dient als Warnung vor den möglichen negativen Konsequenzen eines blinden Glaubens an ideale Gesellschaftssysteme.
Was sind die Schlussfolgerungen des Dokuments?
Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass Utopien trotz der gescheiterten Versuche des Staatssozialismus weiterhin notwendig sind, um positive Perspektiven zu entwickeln, Alternativen zum Bestehenden zu erproben und eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Es betont die Bedeutung von Visionen, die nicht nur den Verstand beeindrucken, sondern auch das Herz berühren, und ruft dazu auf, die Gesellschaftskritik mit der Suche nach konkreten Alternativen zu verbinden.
- Quote paper
- Gabi König (Author), 1999, Eine Verteidigung des utopischen Denkens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95091