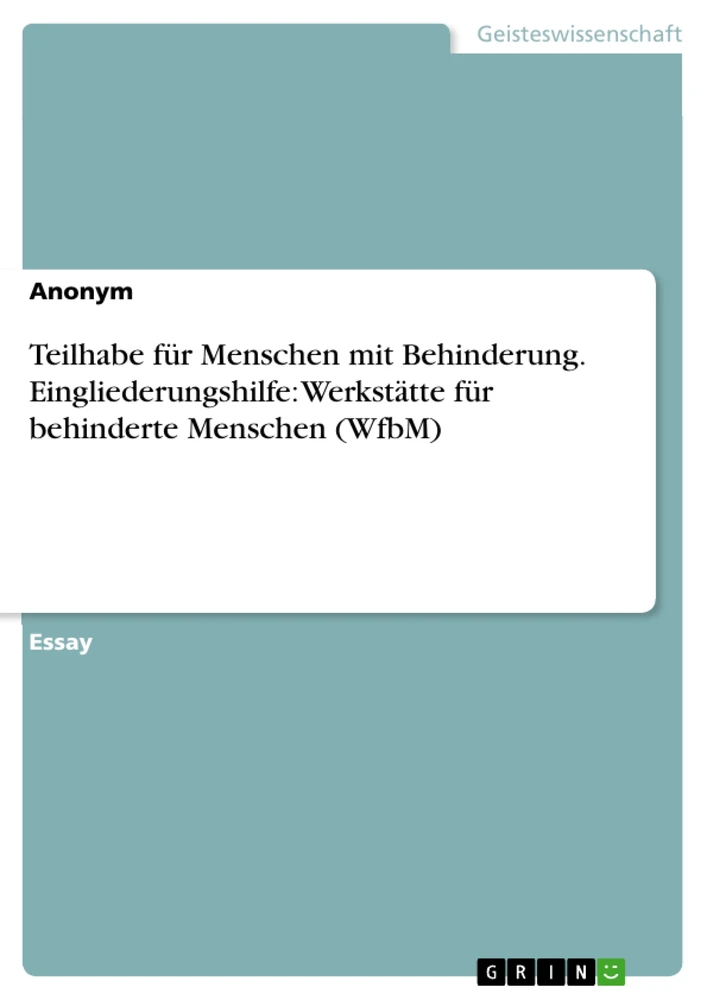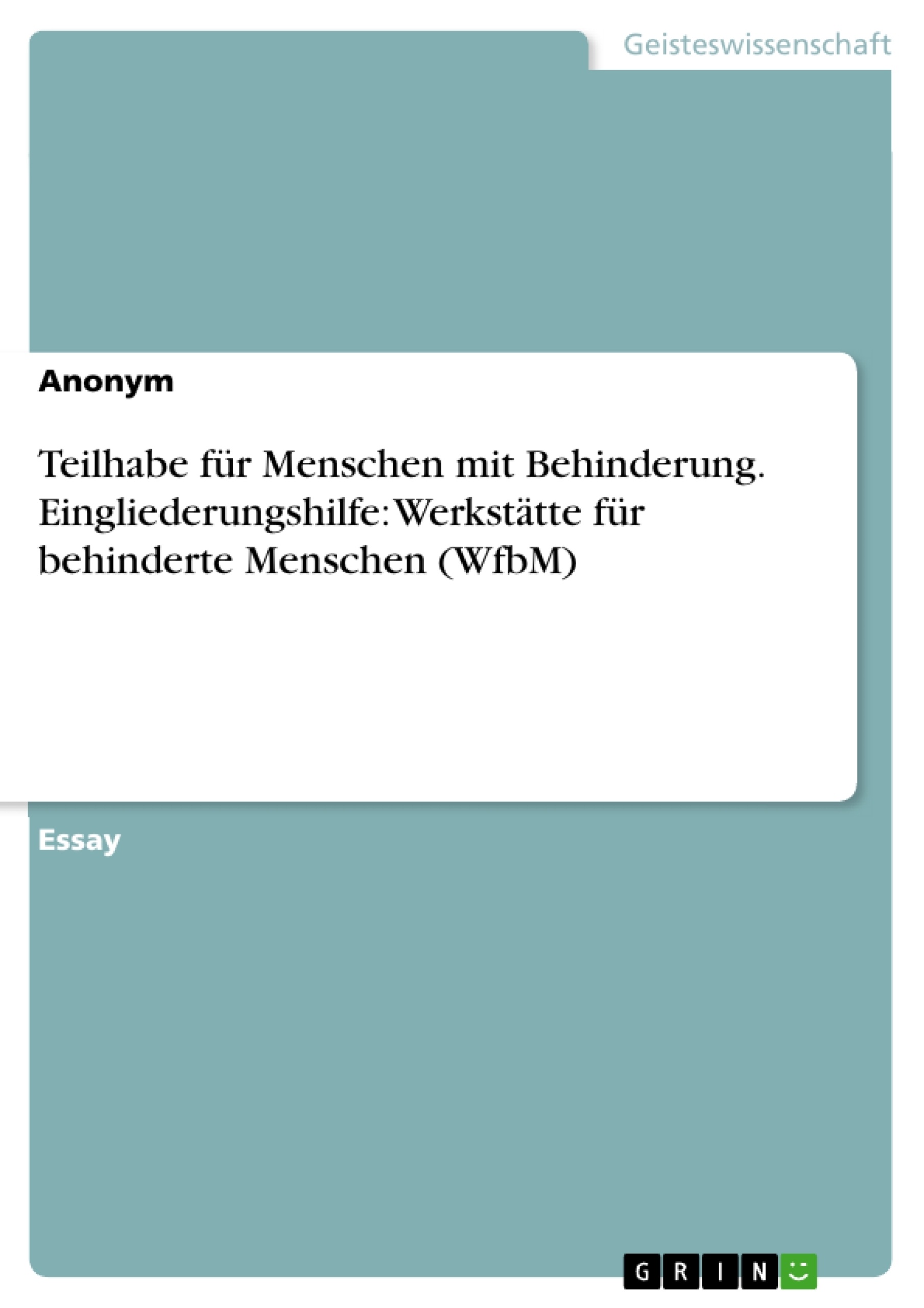Ob die WfbM zur Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beiträgt, wurde in der vorliegenden Studienarbeit wissenschaftlich erarbeitet. Es lässt sich schlussfolgern, dass das Konzept der WfbM, welche Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung verbindet, durchaus sinnvoll ist und durch die 3 Phasen (Eingangsverfahren, Berufsbildungsphase und Übergangsphase) zu einer erfolgreichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt führen kann. Dies setzt voraus, dass das Konzept in der Praxis auch genauso umgesetzt wird und die dafür benötigten Fachkräfte vorhanden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Behinderung
- Definition nach WHO
- Definition nach SGB
- Definition nach UN-BRK
- Gesetzliche Vorgaben der Beschäftigung behinderter Menschen
- Grundgesetz
- UN-Behindertenrechtskonvention
- Sozialgesetzbuch III und IX
- Eingliederungshilfe: Werkstätte für behinderte Menschen
- Individuelle Förderplanung
- Berufliche Bildung
- Beschäftigung
- Arbeitsbegleitende Maßnahmen
- Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Beispiel von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Ziel ist es, die Wirksamkeit der WfbM als Instrument zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu analysieren und die gesetzlichen Grundlagen der Teilhabe zu beleuchten.
- Definition von Behinderung aus verschiedenen Perspektiven (WHO, SGB, UN-BRK)
- Relevanz gesetzlicher Vorgaben zur Beschäftigung behinderter Menschen (Grundgesetz, SGB, UN-BRK)
- Konzept und Funktionsweise von WfbM
- Bewertung des Beitrags von WfbM zur Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt
- Herausforderungen und Potenziale der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die hohe Zahl von Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland und deren niedrige Erwerbsquote im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Sie führt ein in die Thematik der beruflichen Teilhabe und benennt Vorurteile, Diskriminierung und Barrieren als mögliche Gründe für die niedrige Erwerbsquote. Weiterhin werden die relevanten gesetzlichen Grundlagen (GG, SGB, UN-BRK, BBIG, HwO) erwähnt, die die Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Menschen unterstützen sollen. Die Arbeit gliedert sich in einen Teil zur Definition von Behinderung und die Vorstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einen zweiten Teil zur Analyse der WfbM als Beispielmaßnahme der Eingliederungshilfe.
Definition: Behinderung: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionen von Behinderung, unter anderem die der WHO mit ihrem ICF-Modell (Schädigung, Beeinträchtigung, Teilhabe) und die Definition nach dem SGB IX, das körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen als relevant für den Begriff der Behinderung ausweist. Die Kapitel verdeutlicht die Komplexität des Begriffs und die Schwierigkeit einer allgemeingültigen Definition.
Gesetzliche Vorgaben der Beschäftigung behinderter Menschen: Hier werden die gesetzlichen Grundlagen für die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben vorgestellt. Das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, sowie das Sozialgesetzbuch III und IX werden als zentrale Rechtsgrundlagen erläutert. Diese gesetzlichen Vorgaben sollen Benachteiligung aufgrund von Behinderung verhindern und die Teilhabe am Arbeitsleben fördern.
Eingliederungshilfe: Werkstätte für behinderte Menschen: Dieses Kapitel beschreibt die WfbM als eine Maßnahme der Eingliederungshilfe. Es werden die individuellen Förderplanungen, die berufliche Bildung, die Beschäftigungsmöglichkeiten, arbeitsbegleitende Maßnahmen und den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt als Bestandteile des WfbM-Konzeptes dargestellt. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung in den drei Phasen des Eingliederungsprozesses (Eingangsverfahren, Berufsbildungsphase, Übergangsphase).
Schlüsselwörter
Berufliche Teilhabe, Behinderung, Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Eingliederungshilfe, Sozialgesetzbuch (SGB) IX, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Teilhabe am Arbeitsmarkt, inklusion, Gesetzliche Vorgaben, individuelle Förderplanung, Barrieren.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung, insbesondere die Rolle von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bei der Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie analysiert die Wirksamkeit der WfbM und beleuchtet die relevanten gesetzlichen Grundlagen.
Welche Definitionen von Behinderung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Definitionen von Behinderung, darunter die Definitionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem ICF-Modell, die Definition des Sozialgesetzbuches (SGB) IX und die Definition der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Die Komplexität des Begriffs "Behinderung" und die Schwierigkeit einer allgemeingültigen Definition werden hervorgehoben.
Welche gesetzlichen Vorgaben werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale gesetzliche Grundlagen zur Beschäftigung behinderter Menschen, wie das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, sowie das Sozialgesetzbuch III und IX. Es wird erläutert, wie diese Vorgaben Benachteiligung verhindern und die Teilhabe am Arbeitsleben fördern sollen.
Was sind Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)?
Die Arbeit beschreibt WfbM als eine Maßnahme der Eingliederungshilfe. Es werden die individuellen Förderplanungen, die berufliche Bildung, die Beschäftigungsmöglichkeiten, arbeitsbegleitende Maßnahmen und der Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt als Bestandteile des WfbM-Konzeptes dargestellt. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung in den drei Phasen des Eingliederungsprozesses (Eingangsverfahren, Berufsbildungsphase, Übergangsphase).
Welche Zielsetzung verfolgt die Studienarbeit?
Die Studienarbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit von WfbM als Instrument zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu analysieren und die gesetzlichen Grundlagen der Teilhabe zu beleuchten. Sie untersucht die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Definition von Behinderung aus verschiedenen Perspektiven, die Relevanz gesetzlicher Vorgaben, das Konzept und die Funktionsweise von WfbM, die Bewertung des Beitrags von WfbM zur Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt und die Herausforderungen und Potenziale der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studienarbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufliche Teilhabe, Behinderung, Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Eingliederungshilfe, Sozialgesetzbuch (SGB) IX, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Teilhabe am Arbeitsmarkt, Inklusion, Gesetzliche Vorgaben, individuelle Förderplanung, Barrieren.
Wie ist die Studienarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Thematik einführt und die gesetzlichen Grundlagen nennt. Es folgen Kapitel zur Definition von Behinderung, den gesetzlichen Vorgaben, den WfbM und abschließend eine Diskussion. Die Einleitung beinhaltet bereits eine hohe Zahl an Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland und deren niedrige Erwerbsquote im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Sie führt ein in die Thematik der beruflichen Teilhabe und benennt Vorurteile, Diskriminierung und Barrieren als mögliche Gründe für die niedrige Erwerbsquote.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Eingliederungshilfe: Werkstätte für behinderte Menschen (WfbM), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/948563