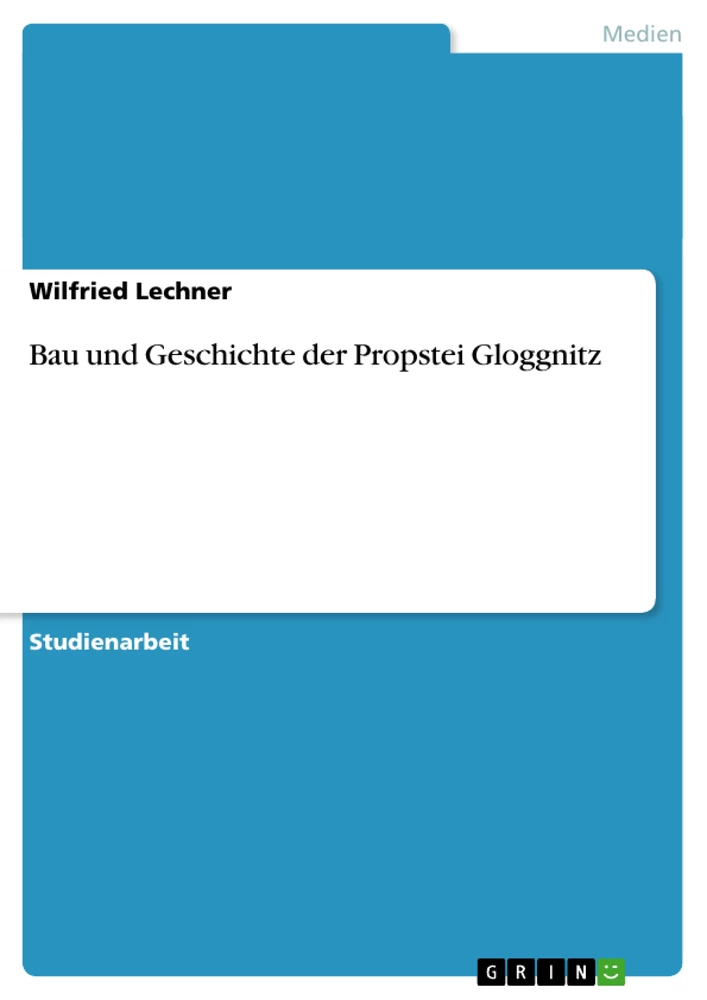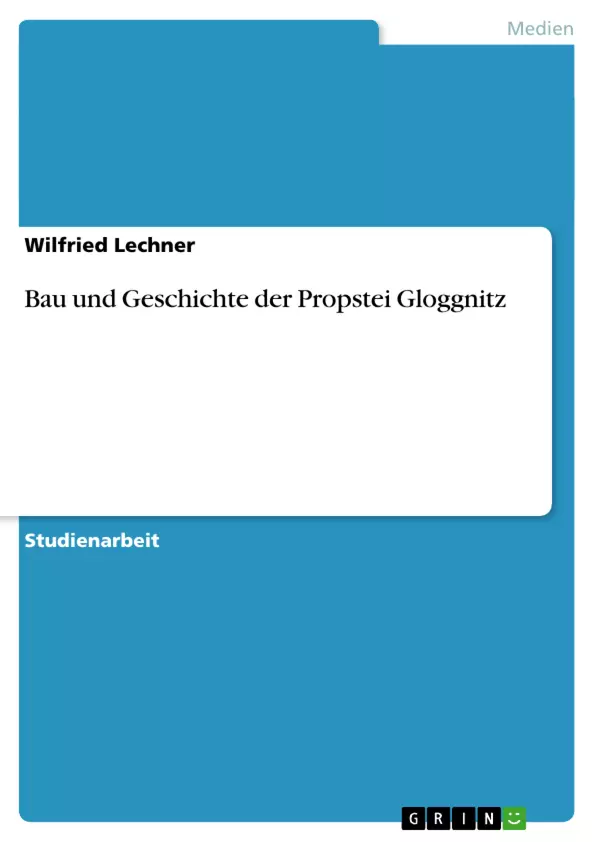INHALTSVERZEICHNIS:
1. Die Formbacher und die Stiftungsurkunde 1094
2. Die Bruderschaft zu Gloggnitz
3. Die Einkünfte des Klosters im 14. Jahrhundert
4. Gloggnitz als Wein-Hochburg
5. Die Propstei nach den Formbachern
6. Die Propstei nach Josef II.
7. Kirchen in Gloggnitz Literaturverzeichnis
1. Die Formbacher und die Stiftungsurkunde 1094
Im 11. Jahrhundert tritt der Raum Schwarzatal zum ersten Mal in den Blickpunkt der Geschichte, als Gottfried aus dem Geschlecht der Wels-Lambacher 1042 über die angreifenden Ungarn siegreich bleibt und die Güter der bereits bestehenden Burg Pitten (Gebiet vom Wienerwald mit der Piesting als Grenze über den Bergrücken des Wechsels nach Hartberg, zum Semmering und bis ins Schwarzatal1 ) erhält. Seine Vertrauensleute besiedelten das Land und das Schwarzatal wurde kultiviert und verwaltet. Nach Gottfrieds Tod 1050 erbte seine Tochter Mathilde das Gebiet um die Burg Pitten. Durch ihre Heirat mit Graf Ekbert I. von Formbach konnten die Besitztümer bis weit in die kartanische Mark erweitert werden, denn Ekbert war selbst im Besitz vieler Ländereien von Melk bis zum Bisamberg und Wienerwald. Die Burg Pitten war in diesem durchaus großen Reich das Zentrum und während des Investiturstreits der Sitz von Ekbert I. und Mathilde.
Ekberts Kusine Himiltrudis soll, wie eine Sage berichtet, nach der Heilung von einer Augenkrankheit um 1040 durch Stiftung das Benediktinerstift Vormbach (auch Formbach, Vornbach) begründet haben.
Rund fünfzig Jahre später, im Jahre 1094, erfolgte nach der Begründung des Benediktinerstifts eine zweite, weitaus größere Schenkung, die aber folgende Auflage inkludierte: am Fluß Glocniza solle eine Cella errichtet werden.
In der Schenkungsurkunde vom 17. Dezember 1094 werden Ortsnamen zum Teil erstmals erwähnt: Niuwenchirgun (Neunkirchen), Butino (Pitten), Werth (Wörth), Clamma (Klamm), Beierbach (Payerbach), Glocniza (Gloggnitz), Botsach (Pottschach), Smidesdorf (Schmidsdorf) und Wirbilach (Würflach)2.
...Ekbert bestiftet die Abtei dann aus seiner Erbschaft und der seiner Gattin Mathilde neu, indem er zu den Stiftungsg ü tern der Himiltrud zahlreiche Besitzungen am Inn hinzuf ü gt. Dazu gab er ihnen auch im ö stlichen Landstrich eine Siedlung namens Niuwenchirgun (= bei der neuen Kirche) und zwei Pfarrkirchen, einer unterhalb der Burg Pitten und eine zweite in ebengenannten Siedlung in Neunkirchen, mit den Zehenten und allen anderen Zugeh ö rigkeiten, und den Markt, der sich dort befindet, und die Siedlung namens W ö rth und eine andere Ö rtlichkeit nach dem Fl üß chen Glocniza, wo bald darauf eine (M ö nchs)Zelle errichtet wurde... 3
Wann mit dem Klosterbau begonnen wurde, kann nicht genau festgelegt werden. Es ist aber wahrscheinlich, daß noch vor dem Tod Ekbert. I. (1109) begonnen wurde, denn sein Sohn Ekbert II. nahm gegenüber den Benediktiner-Mönchen eine äußerst starrsinnige Haltung an und erklärte die Schenkungen seines Vater für obsolet und entzog den Benediktiner einen großen Teil der Güter. Da der Vormbacher Abt Beringer, der zu Ekbert I. in einem guten Verhältnis stand, im Oktober 1108 starb, kann die Gründung der Cella, vielleicht auch der Pfarre durchaus um die Zeit um 1100 angesetzt werden, wahrscheinlich aber noch vor dem Oktober 1108.
Als einziger der Autoren steht Johann Rigler mit seiner Meinung über den Ort, wo die Zelle Gloggnitz errichtet worden ist, da: "Das Kloster ging eindeutig aus der ehemaligen Burg Eichberg hervor. Die ö stlichen Nebengeb ä ude der Burg sind, wie ja auch der alte Turm, abgetragen worden, um mehr Platz zu schaffen. Die Steine des Abbruches wurden zum Aufbau der Klostergeb ä ude verwendet. Es entstand so ein ger ä umiger Klosterhof." 4 In der restlichen Literatur sind keine Angaben vorhanden, daß die Zelle auf dem Grund der ehemaligen Burg Eichberg gebaut wurde, obgleich es bekannt ist, daß die Benediktinermönche ihre Klöster auf Anhöhen zu errichten pflegten. Dies war ja auch in Gloggnitz der Fall, denn ein solider Felsen diente als Basis für die Mauern, zwei Gewässer, die sich unterhalb des Hügels vereinten und stets klares Wasser führten und ein weiter Blick ins Land waren optimale Voraussetzungen für den Bau der Zelle.
Erst im Jahre 1134 gelangten die Mönche wieder in den Besitz der Schenkungen von Ekbert I., als sie sich, vertreten durch Abt Dietrich von Vormbach, bereit erklärt hatten, um 22 Talente Silber die Besitztümer von Ekbert II. zurückzukaufen. Ekbert II. bestätigte dem Kloster den Gloggnitzer Besitz.
Bei diesem Anlaß wurden die Grenzen des Gebietes genau aufgezeichnet: Entlang des Wei ß enbaches zum Shyrnbach, wo sich der Besitz des Otto Syrnike anschlo ß , zum Ursprung des Baches beim Besitz des Rapoto, zur H ö hle des kleinen Raachberges bis zum Gut des Regnboto Longus (dessen Gut lag offenbar im Raume der sp ä teren Herrschaft Wartenstein 5 ) und weiter bis an die Grenze von Klamm. Dort bergw ä rts entlang eines Baches zu einer Wiese, bis an die Grenze des sp ä teren Reichenauer Besitzes. Am Eichberg zur Quelle des Apfaltersbaches, von dort entlang des Baches bis zur Einm ü ndung in die Schwarza. 6
Im Zuge der Besitzbestätigung (Traditionsnotiz LVIII) und des Kaufes von Rechwang (Traditionsnotiz LIX) ist von einem bereits verstorbenen Propst Bepo und einem lebenden Propst Adalbertus die Rede. Das ist insofern recht ungewöhnlich, als bei den Benediktinern Äbte regieren, denen im Mutterkloster Prioren zur Seite stehen. Der Titel "Propst " ist bei den Benediktinern ungewöhnlich und kann sich daher nur auf den
Leiter einer anderen klösterlichen Einheit beziehen. Die obengenannten Herren waren also - als Propst - mit der Leitung der Cella Gloggnitz beauftragt, obwohl es sich um eine bei den Benediktinern im Sinnes der Kirchenrechts nicht existierende Institution handelte.
Exkurs:
Probst: in der kath. Kirche Vorsteher eines Dom- oder Stiftskapitels; in einigen ev. Landeskirchen der Superintendent.7
Probst: (von mittellat. propostus, praepositus: Vorstand im allgemeinen, z.B. Papst, Köni, Bischof, Ordensoberer, Abt). In der Benediktregel erscheint die Bezeichnung Propst für den Stellvertreter des Abts; doch wurde hier im 10. Jhd. der Propsttitel durch Prior abgelöst. Der Propsttitel blieb aber für die Vorsteher kleinerer, meist abhängiger Klöster; er erhielt sich auch für den bei klausurierten Klosterfrauen Kaplan.8
Nach dem Tod Ekbert II. kam sein Sohn Ekbert III. an die Macht, der wohl noch bedeutender als sein Vater war und den Heldentod bei Mailand starb. Mit ihm stirbt das Geschlecht der Formbacher aus.
2. Die Bruderschaft zu Gloggnitz
Anno 1355 wurde eine Bruderschaft zu Gloggnitz gestiftet, die zum gemeinsamen Gebet, Teilnahme an Totenehrungen, Bekenntnis der Wahrheit, zur Gabe von Spenden und zum Andenken an die Toten aufrief.
"Darnach haben wir gesetzt alle Quotemper des n ä chsten Suntag darnach des Nachts Vigily zu singen, unseren Vodern und allen glaubhaftigen Seln zu Hilf und zu Trost, und des Morgens an dem Montag ain Seelambt, und umb die Kirchen ze gen mit Gesang und mit den Kerzen...Und darum, dass dye Sach also stet unzebrochen beleib, geben wir unverschaydentlich deen Brief ü ber uns zu ainer Urkund und zu ainen warn Zaichen versigelt mit des w ü rdigen gaistlichen Herrn Abbt Martin von Vormbach Insigel, der dieser Bruderschafft obrister Herr und Bruder ist, und darzu mit Herrn Christans des Probst Insigel, und Weygants des Sneberger Insigel, und mit Rugleins des Bifenfres Insigel und mit Vomtherus von Grasberg Insigel, dye Sach aller Zeugs sind mit irn Insigel. Der Brief ist geben nach Christens Geburt ü ber dreyzehen hundert Jar, darnach in dem f ü nfundf ü nfzigsten Jar an sand Thomanstag (21. Dez.)." 9
Die Bruderschaft zu Gloggnitz hat ihre Wurzeln möglicherweise in den Katastrophen, die Gloggnitz in den vorangegangenen Jahren heimgesucht hatten: Harte Winter, denen verheerende Überschwemmungen folgten, eine drei Jahre andauernde Heuschreckenplage (1339-1341), Erdbeben (Jänner 1343) und im Winter 1348/49 die Pest, die viele Opfer forderte.
1499 erhielt die Gloggnitzer Bruderschaft neue Satzungen, die später auch von dem berühmten Abt Angelus Rumpler bestätigt wurden.
Abt Rumpler verbrachte seine Sommermonate gerne in Gloggnitz, und er schrieb seine Eindrücke darüber in der Historia Monastruii Formbacernsis 1504 nieder (alte Übersetzung der lateinischen Abhandlung):
"...Kehren wir zum Kloster zur ü ck. Das Haus ist sehr alt und gro ß . Es enth ä lt die Praelatur und die Probstei und sowohl f ü r den Abt als f ü r den Probst besteht ein Dampfbad bei ihrer Zelle. Aber auch f ü r die Diener ist gesorgt, sie haben ihre Schlafr ä ume in den einzelnen Vorwerken. F ü r die Br ü der, die hier wohnen, besteht ein Schlafsaal mit einzelnen Zellen. An Kornspeichern, Speise- und Vorratskammern fehlt es nicht, um Feldfr ü chte und E ß waren aufzubewahren..." 10
3. Die Einkünfte des Klosters im 14. Jahrhundert
Im Register des Stifts Vormbach sind um 1320 sechs Bezirke aufgezählt:
Erster Bezirk: Gloggnitz, Schottwien, Aue, Weißenbach, die Talseiten zwischen Gloggnitz und Weißenbach, Rechwang, Heufeld, Schmidesdorf, Payerbach, Prein, Raach, Türmannsdorf, Götschach, Köttlach, Werd, Pulchesdorf und Chienberg. Zweiter Bezirk: Neunkirchen mit Wartmannstetten, Wimpassing, Danegg, Lindgrub, Ramplach, Natschbach, Kulm, Loipersbach, Tann, Hafnern, Weiding, Straßhof, Awenpach, Chunesberg, Pottschach mit Buchbach und Würflach. Dritter Bezirk: Linkes Ufer der Donau im Viertel unter dem Manhartsberg, St. Veit bei Bisamberg, Jedlersee, Stammersdorf, Enzesfeld, Hagenbrunn, Königsbrunn, Stetten, Flandorf, Sebarn, Klein Engersdorf, Leobendorf, Rohrbach und einige Grundholden in Korneuburg.
Vierter Bezirk: Rechtes Ufer der Donau im Viertel ober dem Wienerwald,
Herzogenburg mit Etzersdorf, Oberndorf, Weichselberg und Ramsau und zwei Besitzungen bei Kloster Erla.
Fünfter Bezirk: Paumgarten (hinter Penzing bei Wien) und das Haus Wien ("in vico prope Sanctum Michaelem ex oposito domus Siebendorfarii").
Sechster Bezirk: In der Steiermark: Münichwald mit Pfarre und 87 Grundholden,
Gravendorf bei Hartberg, Jauern (über dem Semmering) und Göritz bei Kapfenberg.
Die Bewohner dieser Gebiete mußten an das Kloster folgende Abgaben leisten:
Der Gelddienst (Haus- und Grundzins) wurde am St. Michaelstag (29. September), bei den Grundstücken in Neunkirchen am St. Martinstag (11. November), der Schnittpfennig am St. Margaretenstag (10. Juni) und der Waldweidepfennig am St. Veitstag (15. Juni) eingebracht.
Der Pflugdienst galt nur für die Umgebung von Gloggnitz. Von jedem größeren Grundbesitzer wurde ein Pflug mit einem Ochsen je Joch, von mehreren Kleinen einer zusammen im Frühjahr und Herbst zur Verfügung gestellt. Die Gesamtanzahl der Pflüge schwankt zwischen 2411 und 42 Pflügen12.
Der Fruchtdienst(Ernteertrag von Weizen, Korn, Hafer, Gerste, Bohnen und Mohn) wurde am St. Aegidustag (1. September) geleistet. Der Blutdienst stand mit dem Fruchtdienst in Beziehung. Hier mußte der Hühnerdienst zu St. Michael und zu Weihnachten, der Eierdienst (100 Stück pro größeres Gut) zu Ostern, der Käsedienst zu Pfingsten, die Abgabe von Lämmern zu Ostern, die Abgabe von Gänsen zu Martini und die Abgabe von Schweinen zu Weihnachten geleistet werden.
Das Zehentrecht (der zehnte Teil aller Einnahmen) Robotleistungen bei Bauten und sonstigen Anlässen Zudem schrieb das Bergrecht die Abgabe von einer bestimmten Menge Wein vor. Im Weinbezirk Gloggnitz wurden 129 1/2 Urnen (ca. 6993 l), insgesamt 239 1/2 Urnen (12933 l) abgegeben. Und jedes dritte Jahr wurde mit dem Bergrecht in derselben Höhe der Steuerwein eingehoben.
4. Gloggnitz als Wein-Hochburg
Wie bereits den Angaben über das Bergrecht zu entnehmen ist, zählte Gloggnitz zu den Aushängeschildern der Vormbacher Propstei in punkto Weinbau. In den Besitzregisten ist dem Weinbau in Gloggnitz auffällig viel Platz geschenkt. Schon zur Zeit der Klostergründung 1094 wird von Weinbergen in "Wirflach und Pottschach" geschrieben. Auch Abt Angelus Rumpler berichtete im Jahre 1504 in seinen Aufzeichnungen über den Gloggnitzer Weinbau. Rumpler stufte den Wein vom Aichberg (Eichberg) als den "Unangenehmsten"13, den Rebensaft von Rechwang als "Stärkeren"14 ein, dafür hat der Wein vom Silbersberg in der Öffentlichkeit einen vorzüglichen Namen.
Am Ende des Textes stellte der exzellente Weinkenner Rumpler aber den gesamten Weinbeständen keine besonders gute Note aus: "Mir scheinen doch alle diese Weine etwas rauh und minderen Werts. Wir haben auch in Schadwienn (Schottwien) Zehentweine, die aber sind noch weniger wert."15
Es mag schon sein, daß die Weine aus Gloggnitz nicht an die edle Qualität der in der Nähe von Wien gekelterten Rebensäfte heranreicht, aber die Gloggnitzer Winzer hatten ob dem Mangel an Werkzeug und tiefen Kellern denkbar ungünstige Voraussetzungen.
5. Die Propstei Gloggnitz nach den Formbachern
Nach Ekbert III. Tod (1158) wird sein Vetter Herzog Otokar von Steiermark Schirmherr des Gloggnitzer Klosters. Er versuchte durch den Ausbau des Semmerings den stets durch die Ungarn gefährdeten Transportweg über den Wechsel zu meiden. Otokar gründete auch das Hospital am Semmering.
Der Nachfolger Otokar III. blieb ohne Nachfahren und schloß mit dem Babenberger Herzog Leopold V. 1186 den Georgenberger Vertrag, wonach beide Herzogtümer - Steier war 1180 zum Herzogtum erhoben worden - stets unter einem Fürsten stehen sollten. Die Ländereien um die Schwarza und Pitten kamen 1192 an Leopold V.
Entgegen dem Georgenberger Vertrag kam es 1194 zu einer Teilung, wo Leopold VI. die Steiermark, Friedrich I. das Erzherzogtum Österreich erhielt.
Bereits 1184 weilte der Minnesänger Walther von der Vogelweide als Gast im Kloster und auch Ulrich von Liechtenstein hielt vom 13. bis 15. Mai 1227 und 1239 in Gloggnitz Turniere ab.
Von 1200 an führte Gloggnitz den Titel "Propstei"16.
1282 besuchte Rudolf I. von Habsburg das Kloster und sein Sohn Albrecht I. unterwarf nach einem Marsch durch Gloggnitz den aufrührerischen steirischen Adel. Nach der Ermordung Albrecht I. kam im ganzen Land Unsicherheit auf und im Jahre 1309 erstürmten Hademar von Falkenstein und Ortlof von Kranichberg mit ihrer Gefolgschaft die Klosterburg, nahmen das Kloster in Besitz und vertrieben die Mönche. Doch die Mönche kehrten bald wieder unter dem Schutz Friedrichs zurück. Am 25. Jänner 1343 gab es in Gloggnitz ein furchtbares Erdbeben von insgesamt elf Stößen, das verheerende Spuren hinterließ. Die Urzelle soll dabei vollkommen zerstört worden sein. Vermutlich ist damit der alte Turm der einstigen Burg Eichberg gemeint, an dessen Stelle dann die Propstkirche, die heutige St. Michael Kapelle errichtet wurde.17
Am 24. April 1345 siegelte Propst Eberhard von Gloggnitz zum ersten Mal mit einem Rundsiegel und betonte damit die Geschäftsfähigkeit der Pröpste von Gloggnitz und 1353 scheint erstmalig das Wappen mit der Glocke auf dem Siegel auf.
Amtssiegel des Propstes von Gloggnitz aus dem Jahre 1406.
Rund, ca. 30 mm Durchschnitt, grünes Siegelwachs in naturfarbener Schüssel. Im Siegelfeld spitzer Wappenschild, umgeben von Ranken. Wappen: geschweifte Glocke mit Klöppel.18
Unter Albert IV. trat der erste Landtag zusammen, zu denen die Vertreter die Prälaten entsandten. Zu diesen wurden zeitweilig auch die Gloggnitzer Pröpste gerechnet. Die Gloggnitzer Pröpste hatte Zeit ihrer Tätigkeit große Probleme mit ihrem "Mutterkloster", da die Geistlichen aus Vormbach es nicht sehr gerne sahen, daß die Gloggnitzer selbst siegeln.
1393 entschied sogar Herzog Albrecht III. über einen Streit: er schickte Kundschaft, um festzustellen, ob ein Propst von Gloggnitz "Gewalt habe, Dienste und Rechte des Gotteshauses zu verkaufen oder zu versetzen und darüber zu siegeln".19 Die Nachricht, die er erhielt, habe ergeben, daß ein Propst eine solche nicht habe, diese läge im Kloster Vormbach.
1421 schrieb Propst Heinrich von Gloggnitz, zur Zeit des Vormbacher Abtes Johannes von Poppenberg, die wunderschön illuminierte, großformatige Vormbacher Bibel, die auch Darstellungen von Abt und Propst enthält.
Bis ins 16. Jahrhundert hinein waren im Kloster Gloggnitz große bauliche Erneuerungen geschehen. Die Kirche erfuhr größere Veränderungen und die Wehrbauten wurden verstärkt.
Die wirtschaftliche Lage zeigte eine stete Aufwärtsentwicklung: Der Weinbau war zur stärksten Einnahmequelle geworden und daß auch, obwohl er nicht so süß war. Aber es gab in Gloggnitz nicht solche Schwierigkeiten wie in Wien, wo der Kaiser die Bevölkerung aufrief, sauren Wein nicht wegzuschütten, sondern ihn zum Stephansdom zu bringen, wo er zum Kalklöschen gut verwendet werden konnte.20
Zur Zeit der Türkenkriege im 16. Jahrhundert entbrannte zwischen dem Land und dem Kloster Vormbach ein heftiger Streit um die Steuereintreibung. Auch die Propstei Gloggnitz wurde zur Leistung der Abgaben verpflichtet, was aber den Widerstand des herrischen Abtes von Vormbach, Leonhard II., weckte. Er erklärte nämlich wieder, daß der Propst von Gloggnitz gar kein Propst, sondern nur ein Administrator des Klosters sei und daher auch gar nicht verpflichtet, den für einen Propst errechneten Teil zu entrichten. Dem Streit machte Kaiser Max II. 1574 ein Ende, indem er in einem Schreiben an den niederösterreichischen Klosterrat erklärte, er habe Gloggnitz die "jährliche geistige Constitution" nachgelassen.21
So war Gloggnitz aus äußerst zweifelhaften Gründen um seinen Propst gekommen. Als der Streit dann beendet war, hatte Vormbach natürlich nichts mehr gegen die Bezeichnung "Propst von Gloggnitz" einzuwenden.
Die Klosterwirtschaft in Gloggnitz zog immer mehr die Interessen der Regierung auf sich und so wurde sogar ein zweiter Administrator nach Gloggnitz entsandt, der als Kontrollorgan verwendet wurde.
Zudem wurde in einem aufsehenerregenden Prozeß im Jahre 1582 der Gloggnitzer Propst Johann Staininger abgesetzt. Staininger wurde sein aufwendiger Lebensstil zum Verhängnis.
Zwischen 1720 und 1740 ging ein umfangreicher Umbau des Klosters von Statten, bei dem u.a. der Südtrakt neu aufgebaut wurde.
In diese Zeit fällt auch der Aufenthalt von Kaiser Karl VI. im Kloster Gloggnitz. Der Kaiser kam am 21. Juni 1728 gegen 11 Uhr im Kloster an, aß bis 15 Uhr an einer reich gedeckten Tafel und brach gegen 16.45 Uhr, nachdem die Abreise durch einen Regenschauer verzögert wurde, gen Mürzzuschlag auf, wo er samt Gefolge die Nacht zubrachte.
6. Die Propstei nach Josef II.
Das Kloster hatte die Josefinischen Reformen gut überstanden, aber trotzdem nahte das Ende: Als das Kloster Formbach 1803 aufgelöst wurde, folgte kurz darauf die Säkularisierung des Kloster Gloggnitz. Die Klosterburg kam an die kaiser-königliche Staatsherrschaft und das Inventar wurde zum größten Teil nach Wien gebracht. Das übrige Klostergut wurde als eigene Grundherrschaft verkauft.
1822 wurde das ehemalige Kloster an Josef Ritter von Weya verkauft, die Kirche und Pfarrei gingen 1825 dem Religionsfond über.
1836 folgte der Wiener Rechtsanwalt Dr. Moritz Weitlof und 1856 dessen Schwiegersohn Dr. Vinzenz Richter, der noch größere Renovierungsarbeiten durchführen ließ.
Richters Erben verkauften das Gut 1906 an Ritter von Raimann, der weitläufige Holzschlägerungen vornahm. 1910 kam es aber zu einer Exekution und Oskar Richter war der neue Besitzer, der es 1917 an David Hartenstein verkaufte.
1926 kam die Stadt gewordenen Gemeinde Gloggnitz in den Besetz des einstigen Klosters, wobei aber größere Grundstücksflächen bei David Hartenstein verblieben. Durch die allgemein instabile Wirtschaftslage hatte Gloggnitz keine Mittel zur weiteren Instandhaltung zur Verfügung und das einstmals prunkvolle Kloster drohte zu verfallen.
Doch die tatkräftigen und vorausdenkenden Bürgermeister der Stadt Gloggnitz betrieben mit Hilfe von Land und Bund die Wiederherstellung des Klosters. Die jahrelangen Mühen wurden schließlich 1992 belohnt: die Niederösterreichische Landesausstellung fand im wieder im alten Glanz erstrahlenden, im Volksmund "Schloß" getauften ehemaligen Kloster statt.
Seither wird das Gebäude als "Hochzeitschloß" und für eine Miniaturenausstellung genützt.
7. Kirchen in Gloggnitz
In Mitten des "Schloß"-Hofes steht die barocke Klosterkirche, auch Kirche Maria Schnee genannt, mit gotischem Kern. Ursprünglich war sie den beiden Heiligen Godehard und Oswald geweiht. In einer Urkunde von 1485 heißt sie auch "Propsteikirche St. Godehard in Gloggnitz"22. Der älteste Teil ist die Frauenkapelle, die wahrscheinlich ursprüngliche Zelle aus dem 11. Jahrhundert, mit einem Spitzbogengurt von 1260. Früher war die Frauenkapelle selbständig und wurde erst um 1760 mit der Kirche verbunden. Die größte Umgestaltung erfuhr die Kirche unter den Pröpsten Perfaller und Wenckh. 1692 wurde die Kirche barockisiert, aus dieser Zeit stammt auch der 36 m hohe Turm mit Zwiebeldach, in dem 1693 die erste große Glocke (635 kg) und 1725 die zweite (1330 kg) angebracht wurde. Die Orgel auf dem Chor spendete Propst Spitzl im Jahr 1486.
Die in den Westtrakt des Klosters eingebaute kleine Kirche, die einst als Propstkirche bezeichnet wurde, ist dem Erzengel Michael geweiht. Die Michaelskapelle steht teilweise auf den Grundmauern eines Karners. Der gekrümmte westliche Abschluß, dessen Mauern noch Teile der bestehenden Kapelle sind, deuten auf einen ursprünglich romantischen Rundkarner hin. Dieser Teil war von der Wehrmauer umgeben und blieb damit erhalten. Eine erste Nennung finden wir im Klosterarchiv, wo zu lesen ist, daß im Juli 1322 eine Seelenmesse im Karner gestiftet wurde23. Die Michaelskapelle wurde als erstes Gebäude im Ensemble des Klosterbereiches renoviert und als sakraler Raum 1988 wieder geweiht.
An der Südseite der Kirche befindet sich die Frauenkapelle, von Angelus Rumpler auch Abtkapelle genannt. Der Marienaltar stammt aus der Barockzeit. Die Marienkapellewurde nach Osten um zwei Meter verlegt, wahrscheinlich deshalb, weil der Barockaltar aus einem anderen Gotteshaus übertragen wurde und infolge seiner Höhe keinen Platz in der Marienkapelle fand. Unter der Kapelle befindet sich eine Gruft, die aber um 1930 zugemauert wurde.
Die unten im Ort Gloggnitz stehende alte Kirche hat den heiligen Othmarus zum Patron. Der erste Nachweis findet sich im Klosterarchiv: 1313 wird eine Hofstatt zu Gloggnitz bis St. Othmar angeführt. Die St. Othmars Kapelle geriet mehrmals in Brand: Ende des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich durch Truppen des Matthias Corvinus und 1809 durch die napoleonischen Soldaten. Im Jahre 1899 erfolgte eine Generalrenovierung, wobei zwei neue Fenster freigelegt und neu verglast wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Innenraum restauriert und ein jüngerer Anbau abgebrochen. Die kleine Kapelle dienst heute hauptsächlich für Gottesdienst und Andachten.
Die Pfarre Gloggnitz faßte Anfang des 20. Jahrhunderts den Plan, eine neue Kirche nahe dem Ortszentrum zu bauen und eröffnete 1908 den Kirchenbaufonds. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte erst 1933 der Grundstein gelegt werden; als Architekt wurde der Rektor der Wiener Kunstakademie, Clemens Holzmeister gewonnen. Die Kirche hätte ursprünglich eine Kolumbariumskirche werden sollen, aber nach einer gänzlichen Umplanung wurde der Bau der Christkönigskirche von 1960 bis 1962 zu Ende geführt.
Die evangelische Dreifaltigkeitskirche wurde von Rudolf Angelides, einem Schüler Holzmeisters, 1968 an Stelle der hölzernen Notkirche gebaut, die 20 Jahre in Verwendung stand. Interessant an dem Neubau ist das steil ansteigende Dach mit der Lichtblende für den Altarraum und der 20 m hohe freistehende Glockenturm. Die bunten Glasfenster mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament hat der Wiener Professor Günter Naszelt geschaffen.
Literaturverzeichnis
Höfer, Josef und Rahner, Karl (Hrsg): Lexikon für Theologie und Kirche. Achter Band: Palermo bis Roloff. Freiburg, 1963.
Lechner, Karl: Das Archiv der ehemaligen Propstei Gloggnitz, seine Geschichte und seine Bestände. In: Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestands des Haus, Hof und Staatsarchiv. Hrsg: Leo Sanitfaller. I. Band. Wien, 1949. S. 54-94.
Rigler, Johann: Eichberg-Gloggnitz (= Waldmark Geschichtsblätter Heft Nr.16). Neunkirchen, 1980.
Kath. Pfarramt Gloggnitz (Hrsg): Die Kirchen von Gloggnitz. Gloggnitz, 1992.
Lexikon-Institut Bertelsmann (Hrsg): Grosses Handlexikon in Farbe. 60 000 Stichwörter und über 2500 Abbildungen. Gütersloh, 1979. S. 856
Pfadfinder-Gilde Wartenstein-Gloggnitz (Hrsg): Gloggnitz-Pitten auf dem Weg zu Niederösterreich 1050-1350. Die Zeit der Wels-Lambacher - Formbacher - Otokare - Babenberger - Habsburger. Gloggnitz, 1984.
Pfadfinder-Gilde Wartenstein-Gloggnitz (Hrsg): Dr. Michael Hainisch: 1.
Bundespräsident 1920-1928 - Leben und Werk eines österreichischen Staatsmannes. Sonderschau: Burgen und Sakralbauten im Raume Gloggnitz-Pitten 10.-14. Jahrhundert. Gloggnitz, 1985.
Pfadfinder-Gilde Wartenstein-Gloggnitz (Hrsg): Gloggnitz-Pitten im Spätmittelalter. Gloggnitz, 1986.
Stadtgemeinde Gloggnitz (Hrsg): Gloggnitz 1094-1994. Gloggnitz, 1994.
Stadtgemeinde Gloggnitz (Hrsg): Festschrift 900 Jahre Gloggnitz. Gloggnitz, 1994.
[...]
1 Stadtgemeinde Gloggnitz (Hrsg): Gloggnitz 1094-1994. Gloggnitz, 1994 . S. 13.
2 ebenda, S. 22.
3 ebenda, S. 17.
4 Rigler, Johann: Eichberg-Gloggnitz (= Waldmark Geschichtsblätter Heft Nr.16). Neunkirchen, 1980. S. 15
5 Pfadfindergilde Gloggnitz-Wartenstein (Hrsg): Gloggnitz- Pitten auf dem Weg zu Niederösterreich 1050 und 1350. Die Zeit der Wels-Lambacher - Formbacher - Otokare - Babenberger - Habsburger. Gloggnitz, 1984. S. 18
6 Gloggnitz 1094-1994, S. 22.
7 Lexikon-Institut Bertelsmann (Hrsg): Grosses Handlexikon in Farbe. 60 000 Stichwörter und über 2500 Abbildungen. Gütersloh, 1979. S. 856.
8 Höfer, Josef und Rahner, Karl (Hrsg): Lexikon für Theologie und Kirche. Achter Band: Palermo bis Roloff. Freiburg, 1963. S. 810.
9 Rigler: Waldmark, S. 19.
10 Gloggnitz 1094 -1994, S. 29.
11 Gloggnitz 1094-1994, S.24
12 Rigler: Wartenstein, S. 18.
13 Gloggnitz 1094-1994, S. 35.
14 ebenda, S. 29.
15 ebenda, S. 29f.
16 Rigler: Wartenstein, S. 15.
17 ebenda
18 Pfadfindergilde Wartenstein-Gloggnitz (Hrsg): Gloggnitz-Pitten im Spätmittelalter. Gloggnitz, 1986. S. 87 bzw. S. 102.
19 Gloggnitz 1094-1994, S. 30.
20 Gloggnitz 1094-1994, S. 30.
21 Rigler: Waldmark, S. 20.
22 Stadtgemeinde Gloggnitz (Hrsg): Festschrift 900 Gloggnitz. Gloggnitz, 1994. S. 41.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Stiftungsurkunde von 1094?
Die Stiftungsurkunde von 1094 erwähnt erstmals Ortsnamen wie Niuwenchirgun (Neunkirchen), Butino (Pitten), Werth (Wörth), Clamma (Klamm), Beierbach (Payerbach), Glocniza (Gloggnitz), Botsach (Pottschach), Smidesdorf (Schmidsdorf) und Wirbilach (Würflach. Sie inkludierte die Auflage, dass am Fluss Glocniza eine Cella errichtet werden solle.
Was ist über die Bruderschaft zu Gloggnitz bekannt?
Die Bruderschaft zu Gloggnitz wurde Anno 1355 gestiftet und rief zum gemeinsamen Gebet, zur Teilnahme an Totenehrungen, zum Bekenntnis der Wahrheit, zur Gabe von Spenden und zum Andenken an die Toten auf. Ihre Wurzeln könnten in den Katastrophen der vorangegangenen Jahre liegen. 1499 erhielt die Bruderschaft neue Satzungen.
Welche Einkünfte hatte das Kloster im 14. Jahrhundert?
Das Kloster Vormbach bezog Abgaben aus sechs Bezirken, darunter Gloggnitz, Neunkirchen und Gebiete an der Donau. Die Bewohner mussten Gelddienst, Schnittpfennig, Waldweidepfennig, Pflugdienst, Fruchtdienst, Blutdienst und Zehent leisten. Auch Wein wurde aufgrund des Bergrechts abgeliefert.
War Gloggnitz eine Wein-Hochburg?
Ja, Gloggnitz war bekannt für seinen Weinbau. Bereits 1094 wurden Weinberge erwähnt. Der Wein vom Aichberg galt als unangenehm, der von Rechwang als stärker, und der vom Silbersberg hatte einen guten Ruf.
Was geschah mit der Propstei Gloggnitz nach den Formbachern?
Nach dem Tod von Ekbert III. wurde Herzog Otokar von Steiermark Schirmherr. Gloggnitz führte ab 1200 den Titel "Propstei". 1309 wurde das Kloster von Hademar von Falkenstein und Ortlof von Kranichberg gestürmt. Im 16. Jahrhundert gab es Streit um die Steuereintreibung.
Was geschah mit der Propstei nach Josef II.?
Nach der Auflösung des Klosters Formbach 1803 wurde das Kloster Gloggnitz säkularisiert. Es kam an die kaiserlich-königliche Staatsherrschaft, und das Inventar wurde nach Wien gebracht. 1822 wurde das ehemalige Kloster an Josef Ritter von Weya verkauft. 1926 kam die Stadt Gloggnitz in den Besitz eines Teils des Klosters.
Welche Kirchen gibt es in Gloggnitz?
Es gibt die Klosterkirche Maria Schnee mit gotischem Kern, die Michaelskapelle (ehemalige Propstkirche), die Frauenkapelle, die alte Kirche St. Othmarus und die Christkönigskirche. Die evangelische Dreifaltigkeitskirche wurde 1968 gebaut.
- Arbeit zitieren
- Wilfried Lechner (Autor:in), 1996, Bau und Geschichte der Propstei Gloggnitz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94815