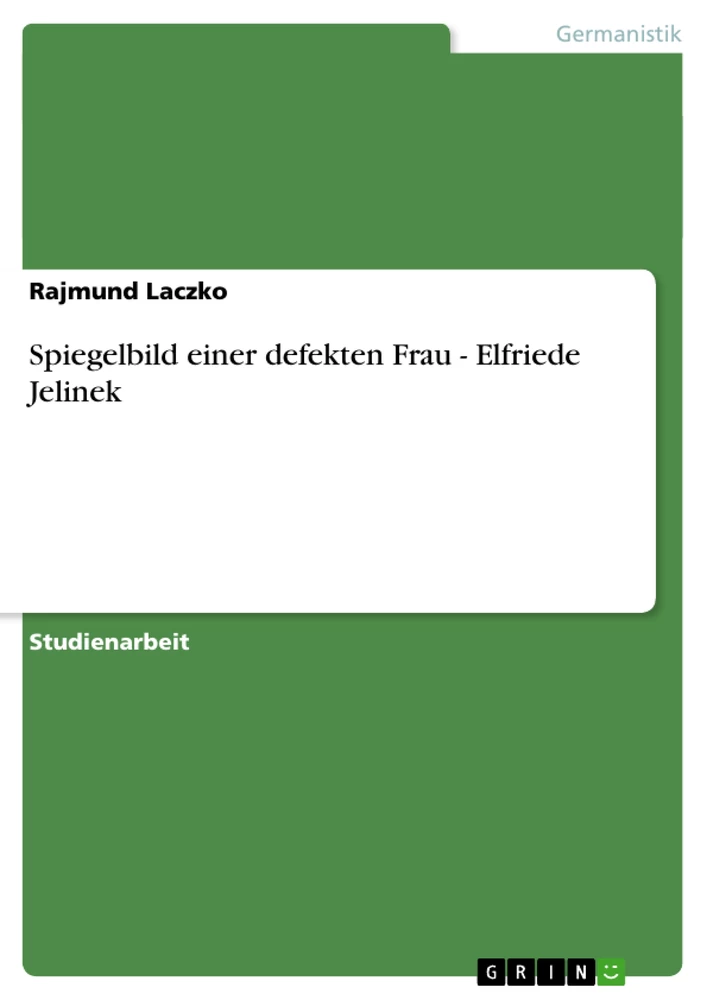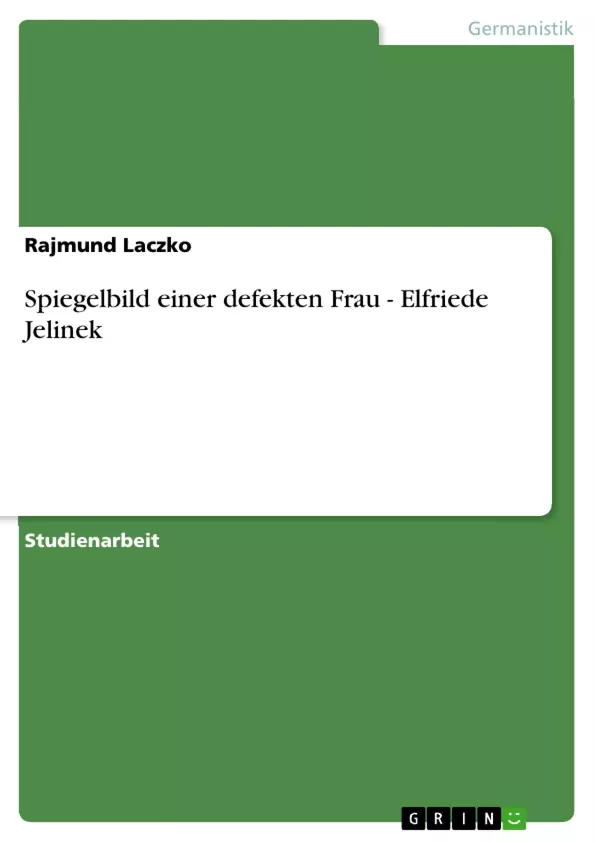In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Liebe und Zwang, zwischen Mutterliebe und eiskalter Kontrolle verschwimmen, entfaltet sich das erschütternde Psychogramm einer Frau, gefangen im Netz einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung. Erika Kohut, eine talentierte Klavierspielerin, lebt ein Leben, das von ihrer dominanten Mutter bis ins kleinste Detail bestimmt wird. Die Musik, einst ein Hoffnungsschimmer, wird zum Instrument der Unterdrückung, ein Mittel, um Erikas Körper und Geist zu disziplinieren und sie von jeglicher Autonomie zu entfremden. Auf der Suche nach Befreiung und sexueller Identität stürzt Erika in einen Strudel aus Obsessionen und Perversionen, in dem Lust und Schmerz untrennbar miteinander verbunden sind. Ihre Begegnungen mit Männern sind geprägt von Gewalt und Demütigung, ein Spiegelbild der emotionalen Grausamkeit, die sie von ihrer Mutter erfahren hat. Jelineks schonungslose Analyse der weiblichen Psyche, der gesellschaftlichen Erwartungen und der zerstörerischen Kraft der Familie lässt den Leser verstört zurück. Ist es möglich, sich aus den Fesseln der Vergangenheit zu befreien, oder ist Erika dazu verdammt, für immer die Klavierspielerin ihrer Mutter zu bleiben? Ein Roman über Mutterliebe, Erziehung, sexuelle Unterdrückung, die Suche nach Identität und die dunklen Abgründe der menschlichen Seele. Die Geschichte einer traumatischen Beziehung, die in die österreichische Seele blickt und eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Tabus und verdrängten Konflikten anregt. Ein Schlüsselwerk der feministischen Literatur, das Fragen nach weiblicher Selbstbestimmung und den Rollenbildern in der modernen Gesellschaft aufwirft. Erleben Sie ein erschütterndes Porträt einer Frau, die zwischen Rebellion und Selbstzerstörung ihren Weg sucht, während die Mutter als unerbittliche Strippenzieherin im Hintergrund agiert und die Grenzen des Erträglichen auslotet. Tiefgründige Einblicke in die Zerrissenheit einer Künstlerin und die Last einer erdrückenden Familiengeschichte. Ein Muss für Leser, die sich mit den komplexen Themen von Trauma, Identität und weiblicher Emanzipation auseinandersetzen möchten.
Zitaten:
"Haarbuschige Dreiecke erglimmend herausmeißeln, denn das ist das allererste, worauf der Mann schaut, da gibt es ein Gesetz dafür. Der Mann schaut auf das Nichts, er schaut auf den reinen Mangel."
"Nach vielen Harten Ehejahren erst kam Erika damals auf die Welt. Sofort gab der Vater den Stab an seine Tochter weiter und trat ab. Erika trat auf, der Vater ab."
"Der Vater strebt blindwerdenden Auges, doch sicher geführt, sein zukünftiges Heim an."
"Nie könnte sie sich einem Mann unterordnen, nachdem sie sich so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat."
"Zum Glück hat diese eine alte Frau, die Mutter Kohut, ein jüngeres Anhängsel ergattert, auf das sie stolz sein kann und das für sie sorgen wird, bis der Tod sie scheidet."
"Für Erika wählt die Mutter früh einen in irgendeiner Form künstlerischen Beruf, damit sich aus der mühevoll errungenen Feinheit Geld herauspressen läßt, während die Durchschnittmenschen bewundernd um die Künstlerin herumstehen, applaudieren."
"Wenn etwas besonders unverwechselbar ist, dann nennt man es Erika."
"Bedroht das Kind mit Erschlagen, sobald es mit einem Mann gesichtet werden sollte."
"Was sie nicht haben kann, will sie zerstören."
"Im Unterricht bricht sie einen freien Willen nach den anderen."
"Jeder Herr hat Erika bald verlassen, und nun will sie keinen Herr mehr über sich haben."
"Erika, die Heideblume. Von dieser Blume hat diese Frau den Namen. Ihrer Mutter schwebte vorgeburtlich etwas Scheues und Zartes dabei vor Augen. Als sie dann den aus ihrem Leib hervorschießenden Lehmklumpen betrachtete, ging sie sofort daran, ohne Rücksicht ihn zurechtzuhauen, um Reinheit und Feinheit zu erhalten. Dort ein Stück weg und dort auch noch. Instinktiv strebt jedes Kind zu Schmutz und Kot, wenn man es nicht davor zurückreißt."
Einleitung
Als zweiter Versuch möchte ich über die Frau als Erscheinung im zweiten Teil unseres Jahrhunderts schreiben, und über die Rolle der Mutter in der Erziehung sowohl soziologisch, als auch psychosexuell.
Die Rolle Frau am Ende unseres Jahrhunderts wirft ein unmöglich großes Problem auf. Zum Verstehen der Identifikationsproblematik der Frauen können wir leider nicht einmal die Geschichte zur Hilfe rufen, weil einerseits dieses Phänomen erst am Anfang der siebziger Jahren zustande kam, andererseits hat sich auch unser Gesellschaftssystem grundsätzlich verändert. Die wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftlich-ökonomische Entwicklungen haben es aber möglich gemacht, daßdie Ähnlichkeit und Gleichheit zwischen den Geschlechten generell und universal anerkannt wurde. Die Periode der 60er und 70er Jahren war die Ära, als sowohl die Pflichten, als auch die Rechten der Frauen mit den der Männer gleichgestellt wurden, und die Ungleichheit unakzeptabel wurde.
Zwischen 1945 und 1950 wurde die Verfassung in fünfzehn Ländern1 geändert: sie anerkannten die Wahlberechtigung der Frauen, und die Gleichheit vor Gericht. Es gab dafür natürlich viele Gründe, am meisten wurden die Taten der feministischen Bewegungen in den Vordergrund gestellt, was natürlich nicht ganz stimmt, denn die wirschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen errungen die Hauptrolle. Die ersten Länder waren die des Ostblocks, sie haben nach der sozialistischen Ideologie die Emanzipation der Frauen gesetzlich geregelt, dem gegenüber waren in den westlichen Länder die gesellschaftliche Veränderungen als Zündschnur zu betrachten.
Diese Entwicklungen sind bis heute nicht abgeschlossen, denn der soziologische Systemwechsel ist noch immer im Gange, und wie es auch keinen Beginn gab, gibt es auch keinen Zeitpunkt, wo man behaupten könnte, alle Frauen auf dieser Welt sind gleichermaßen gleichberechtigt. Es ist sogar vorstellbar, daßinfolge der demographischen Krise2, die schon vor 30 Jahren prophezeit wurde, die Frauen gesetzlich dazu bewegt (gezwungen) werden, mindestens zwei oder sogar drei Kinder auf die Welt zu bringen.3
Analyse
Im Seminar handelte es sich um die Gestalt "Mutter" in der deutschsprachigen Literatur. Wie es sich in der ersten Stunde herausstellte, hatte jeder von uns eine Vorstellung über die Rolle der Mutter innerhalb der Familie, der Gesellschaft. Es fielen Worten wie "zu Hause", "Wärme", "Geburt", "Liebe", "Zusammengehörigkeit", "Frieden", "Sicherheit" usw. Man konnte ohne weiteres feststellen, daßdie Einstellungen gegenüber der Figur "Mutter" eindeutig ideal waren. Niemand wagte darauf zu denken oder sich dazu zu äußern, was alles hinter Begriffe wie "zu Hause" oder "Sicherheit" versteckt bleiben kann. Bis Elfriede Jelinek und das Werk "Die Klavierspielerin" an die Reihe kam.
Denn Jelinek interpretierte die Rolle, den Begriff der Mutter im Leben einer Familie anders, als es im allgemeinen erwartet wird. Die Mutter verkörpert nicht mehr den liebevollen Mittelpunkt einer Familie. Im Mittelpunkt bleibt sie, nur die liebevollen Charakterzüge verliert sie. Es ist kaum abzustreiten, daßdabei auch autobiographische Hintergründe ins Spiel kamen, aber natürlich können wir das Buch "Die Klavierspielerin" nicht als ein biographisches Werk betrachten, dazu ist es einfach zu real.
Sie verwandelte nicht die oben erwähnte Begriffe - sie zeigte ihre andere Seite. Elfriede Jelinek hat die starre Vorstellungen in der zivilisierten Gesellschaft über Mutter, Mutterliebe und Familie in einer beinahe horrorischtischen Beziehung zwischen zwei alleinlebenden Frauen aufgelöst, verwandelt, und genau diese Verdrehung der allgemeinen Bedeutungen läßt Raum für einen erstaunlichen Umgang mit persönlichen Charakterzügen von kleinbürgerlichen Personen. Seit dem Erscheinen des Buches im Jahre 1983 gab es sehr viele gegensätzliche Meinungen darüber, ob dieses Werk "der Rede wert" ist oder gar keinen Grund zu einer literaturwissenschaftlichen Diskussion liefern könnte. Diese Auseinandersetzung ist bis heute nicht zu Ende, und zeigt uns, welche neue, und dadurch auch wertvolle und maßgebende Rolle dieses Werk sowohl in der weiblichen, als auch in der österreichischen und deutschsprachigen Literatur spielte und spielt bis heute.
Zum Grund meiner neuen Arbeit habe ich das Verhältnis zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter, und die Zurückverfolgung der Erzeihung Erikas anhand ihrer Taten als "Erwachsene" und deren Erscheinungsformen innerhalb und außerhalb der Familie gewählt.
Die und ihre Folgen in der Leben der Erika Kohut möchte ich jetzt untersuchen mit dem Schwerpunkt, was für eine Rolle die Erziehung eines Kindes in seinem weiteren Leben hat, welche Folgen und Auswirkungen einer getilgten Familie auf die Persönlichkeit des Kindes ausüben kann, und wie eine Frau fast alle sexuelle Perversionen infolge der oben erwähnten, falsch ausgeführten Prozessen - wie Erziehung und Zusammenleben -, leider besitzen kann.
Geschlechtsstatus einer Person bedeutet nur, ob sie biologisch gesehen weiblich oder männlich ist. Was für eine Frau, oder was für ein Mann aus ihr dann später wird, hängt davon ab, wie sie während der individuellen Entwicklung mit Hilfe der vorhandenen Mustern, Beispielen und Modellen die Rolle der Frau oder des Mannes erlernen kann. Erfolgreich ist dieser Prozess, wenn das Individuum die Erwartungen der Gesellschaft als Mann oder Frau am meisten erfüllen kann. Das ist abzumessen an den sozialen und sexuellen Beziehungen.
Die Bewußtsein der Geschlechtszugehörigkeit entsteht mit der Ich-Bewußtsein paralell. Das ist meistens im dritten Lebensjahr zu sehen. Zu dieser Zeit war Erika Kohut schon mit ihrer Mutter allein. Das Erlernen der Geschlechtsrolle wird von der engeren und weiteren sozialen Umgebung unterstützt. Und wo kein Vater vorhanden ist, kann er selbstverständlich auch keinen Einflußausüben.
Das Leben und die Emotionen eines Kindes wird am meisten von der Mutter bestimmt.
Mutter und Tochter oder Mutter und Vater?
Darunter ist natürlich keine von den heute so modischen Geschlechtumwandlungen zu verstehen, sondern die Verwandlung des Mutter-Tochter Verhältnisses in ein eheliches Verhältnis. Daßdiese Beziehung wirklich so zu betrachten ist, können wir aus dem Zitat entnehmen: "Zum Glück hat diese eine alte Frau, die Mutter Kohut, ein jüngeres Anhängsel ergattert, auf das sie stolz sein kann und das für sie sorgen wird, bis der Tod sie scheidet." (K32) Die letzten Worten des Ehegelöbnis deuten zweifelslos darauf hin, daßdie Mutter in Erika den Ersatz-Ehemann sah.
Nachdem der Vater die Familie "verlassen" hat, bekam die Tochter die Hälfte des Ehebettes, und schlief seitdem mit der Mutter. Ihre Hände durfte sie zwar nicht unter der Bettdecke halten, nur darüber, damit sie von unkeuschen Gedanken bewahrt wird. Und auch eine gewisse Eifersucht ist im Text zu entdecken, mindestens kann man die folgenden Wörter auch so interpretieren: "bedroht das Kind mit Erschlagen, sobald es mit einem Mann gesichtet werden sollte" (K83). Ihr Ziel ist es, die Tochter unbeweglich an einem Ort zu fixieren, damit sie nicht weglaufen kann. Diesem Zweck dienen nicht nur die Fernsehabende und der Fernseher mit seinem schönen Bilder, sondern auch das System verschiedener Bestrafungen von der sadomasochistisch eingestellten Mutter, mit der die Tochter in einer in gewissem Sinne liebevollen, und doch haßerfüllten Symbiose lebt.
Die Mutter hat Erika zur "Lebensfeindlichkeit und Einzelgängerin"4 erzogen; ihrer Karriere zuliebe soll sie sich die sexuelle Sehnsucht abgewöhnen. Sie schafft es so prezis, daßihr Körper keiner Empfindungen mehr zugänglich ist. Sie hatte zwar heterosexuelle Beziehungen mit mehreren Männer und auch Sex gehabt, aber empfand dabei keine Lust, und nach einer Zeit "jeder Herr hat Erika bald verlassen, und nun will sie keinen Herr mehr über sich haben." (K77) Sie kann sogar die empfindsamsten Stelle ihres Körpers, ihr Vagina mit einer "väterlichen" Klinge folgenlos aufschlitzen. Sie sieht das Blut, wie ihre Scheide auseinanderklafft, und verspürt dabei gar nichts. "Es war ihr eigener Körper, doch er ist ihr fürchterlich fremd." (K88) Sie stellt sich vor, wie ihre Scheide ihren Körper angreift und auffrißt. Und das war die erste Stelle, wo ich sagte: Das darf doch nicht wahr sein! DaßFrauen ihre Genitalien als "Nichts", als "reiner Mangel" betrachten, kann ich noch annehmen, es ist sogar bei Freud zu lesen. Aber als ein Biest, das ihren eigenen Wirt angreift! Diese Zeilen mußte ich mehrmals durchlesen, damit ich überhaupt glauben konnte, das so etwas tatsächlich dasteht. Verdauen konnte ich das nicht mehr, aber glauben!
Auch die Musik spielt eine große Rolle nicht nur bei der Erziehung, sondern auch bei der Fixierung der Tochter. Es fordert einerseits Fleiß, Disziplin, Ausdauer und einen endlosen Willen. Ich habe selber Klavier gespielt, weil ich an eine Schauspiel-Schule gehen wollte, und so weißich, wieviel man, wenn man nicht gerade ein Genie ist, opfern muß, um irgendetwas in der Kunst, in der Musik zu erreichen. Ich war nicht gerade berühmt von meinem Fleiß, ein Genie war ich auf keinem Fall, so habe ich nach dreieinhalb Jahre aufgehört, und nie mehr irgendein Instrument gespielt.
Spielt man Musik, darf man von den Noten nicht abweichen, man mußkonsequent vorspielen, was auf dem Blatt spielt. Das stimmt mit dem Ziel der Mutter überein, daßErika nur das „spielt”, was ihr vorgeschreiben wird. Natürlich von der Mutter. Sie läßt nicht zu, daßErika sich zu den anderen Spielenden gesellt, damit sie nicht von dem „Burschi” verführt wird, obwohl es dann doch beinahe passiert. Auch von ihrem eigenen Verwandten sollte sie fernbleiben, nur weil dieser Verwandter ein männliches Wesen verkörperte, das Mädchen verführte.
Musik hat dann auch eine andere Rolle. Sie ist das Mittel, sich aus der kleinbürgerlichen Verhältnissen auszureißen. Erikas Mutter will mit Hilfe der Musik Geld verdienen und samt ihrer Tochter zu etwas Besonderem werden.
"Für Erika wählt die Mutter früh einen in irgendeiner Form künstlerischen Beruf, damit sich aus der mühevoll errungenen Feinheit Geld herauspressen läßt, während die Durchschnittsmenschen bewundernd um die Künstlerin herumstehen, applaudieren." (K25)
Und zwar erreicht Erika mit der Musik nicht gerade die von der Mutter eingeplanten Ziele - sie ist nur eine Unterrichtsgeberin in einer Musikschule mit einer vorgesehenen Professorintitel -, präsentiert die Mutter Erika als die Spitze der Gesellschaft: "Wenn etwas besonders unverwechselbar ist, dann nennt man es Erika" (K14)
Die Mutter versucht ihre Tochter unter Kontrolle zu halten, aber auch sie kann nicht immer und überall Erika begleiten. Und Erika läßt sich diese Chancen nicht entgehen: einerseits spart sie Geld sowohl für Kleider, die sie dann später nie anziehen wird, und wofür sie von der Mutter dann hart bestraft wird, als auch für ihre kleine Ausflüge in die Vorstadt, wie die Besuche in der Peepshow, andererseits beginnt eine Beziehung mit einem ihrer Klavierschülern, mit Klemmer.
Diese Beziehung ist wieder einmal kein normales zwischenmenschliches Verhältnis - so ein Verhältnis in dem Buch ja sowieso nicht zu finden -, denn sowohl Klemmer, als auch Erika will in dieser Sache den Herr spielen. Von Klemmers Seite ist es ja verständlich, so war es ja immer doch, ein Herr soll ein Herr bleiben, aber warum will Erika nicht nach so vielen Jahren aus der Rolle des (Ehe)Mannes austreten, und sich endlich einmal als Frau präsentieren? Weil sie dann ihre eigene Persönlichkeit aufgeben sollte. Als Frau konnte sie keine Herrscherrolle mehr spielen und "nie könnte sie sich einem Mann unterordnen, nachdem sie sich so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat." (K14)
Zu einem Herr kann sie nicht werden, eine Frau kann sie nicht sein, so wird sie zur "Herrin", und tyrannisiert nach den Musikschülern auch Klemmer nicht nur als Schüler, sondern auch als "Geliebten". Klemmer liebt Erika, er wird aber nicht geliebt. Damit "kastriert" Erika Klemmer, und macht ihn dadurch zu der weiblichen Hälfte des Verhältnisses. Jelinek macht also keine halbe Sachen: sie macht nicht nur die Mutter-Begriffe zu ihren eigenen Gegensätzen, sie erläutert eine neue Art der "Liebe": Frauen werden zu Herrin, Herren zu Kastrierten. Ob es bei dieser Konstellation auch Glück zu finden ist, würde ich sowohl anhand meiner Erfahrungen als auch auf Grund der im Buch erläuterten Informationen bezweifeln.
Was ich als Zusammenfassung schreiben konnte? Daßes wirklich ein Buch zum Diskutieren ist, aber nur mit starkem Magen, und nur für unbefriedigte, frustrierte, wenn es möglich ist, für kastrierte Menschen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daßirgend jemand an diesem Buch Gefallen fand. Natürlich gibt es auch Bücher, die nicht unterhaltsam und lustig sind, die sollten aber etwas zum Nachdenken vermitteln. Aber wenn ich nachdenken will, mußich mich in gewissem Sinne mit dem Buch oder mit dessem Inhalt identifizieren können. Das können aber in diesem Fall nur die oben erwähnte Personen tun.
Ich mußgestehen: als ich das Interview mit Jelinek von Lívia ausgeliehen bekam, habe ich einiges besser verstanden. Als ich mir die Frau nach dem Anschauen eines Bildes auch visuell vorstellen konnte, habe ich fast alles verstanden. Nicht der Vater im Buch, sondern die Autorin gehört in ein Irrenheim eingesperrt. Wie ein Junge aus unserem Jahrgang nach dem Anhören einer kurzen Zusammenfassung des Inhaltes sich äußerte: Doch, doch, so ein Buch gehört geschrieben, aber nur für Sanatorium-Gebrauch.
Ja, die Stimmung dieser Zusammenfassung ist ziemlich "kräftig" ausgefallen, aber "extreme Verhältnisse fordern extreme Maßnahmen". Ich persönlich werde keinem empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil meiner Meinung nach dieses Werk das einfach nicht verdient. Wenn dieses Buch, diese Geschichte reale Hintergründe hat, dann mußman wieder die Zivilisation und das menschliche Dasein, dessen Relevanz neu bewerten, und einige neue moralische Grundsätze aufstellen, die Menschheit wird sie gut gebrauchen.
"Was sie nicht haben kann, will sie zerstören" (K84)
Quellen:
Text+Kritik Heft 117: Elfreide Jelinek. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Verlag edition text+kritik GmbH, München 1993
Marlies Janz: Elfriede Jelinek. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart 1995.
[...]
1 Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Frankreich, Griechenland, Israel, Jugoslawien, Polen, Ungarn, DDR, BRD, Italien, Rumänien.
2 in 2040 wird mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung in Europa über 50 Jahre alt sein.
3 A noi nem - tények és kérdojelek. Hrsg. Evelyne Sullerot. Budapest, Verlag Gondolat, 1983. Seite 525-534.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text hauptsächlich?
Dieser Text ist eine Analyse der Darstellung von Frauen, insbesondere der Mutter-Tochter-Beziehung, im Werk "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek. Er untersucht die soziologischen und psychosexuellen Aspekte der Erziehung Erikas Kohut durch ihre Mutter und die Folgen für Erikas Persönlichkeit und sexuelle Entwicklung.
Welche Themen werden im Zusammenhang mit der Mutter-Tochter-Beziehung angesprochen?
Themen wie Manipulation, Kontrolle, emotionale Abhängigkeit, sexuelle Unterdrückung und die Abwesenheit einer gesunden Vaterfigur werden detailliert analysiert. Der Text beleuchtet, wie die Mutter Erika zu einer "Lebensfeindlichkeit und Einzelgängerin" erzieht und ihre sexuelle Sehnsucht unterdrückt.
Welche Rolle spielt die Musik in Erikas Leben?
Die Musik wird einerseits als Mittel zur Disziplinierung und Kontrolle eingesetzt, da die Mutter erwartet, dass Erika nur das "spielt", was ihr vorgeschrieben wird. Andererseits soll die Musik Erika helfen, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen auszubrechen und durch die Kunst zu etwas Besonderem zu werden.
Wie wird Erikas sexuelle Entwicklung dargestellt?
Erikas sexuelle Entwicklung wird als verzerrt und unterdrückt dargestellt. Sie hat heterosexuelle Beziehungen, empfindet aber keine Lust und wird unfähig, sich einem Mann unterzuordnen. Der Text beschreibt, wie sie ihren Körper als fremd und ihr Genital als "Nichts" wahrnimmt.
Was wird über Erikas Beziehungen zu Männern gesagt?
Erika kann sich keinem Mann unterordnen, da sie sich bereits viele Jahre ihrer Mutter untergeordnet hat. Beziehungen sind geprägt von Dominanzspielen, in denen Erika die "Herrin" ist und Männer "kastriert". Es wird in Frage gestellt, ob in solchen Konstellationen Glück möglich ist.
Welche Kritik wird an dem Werk "Die Klavierspielerin" geübt?
Es wird erwähnt, dass das Buch seit seinem Erscheinen polarisiert und gegensätzliche Meinungen hervorgerufen hat. Einige sehen es als wertvollen Beitrag zur weiblichen, österreichischen und deutschsprachigen Literatur, während andere es als abstoßend und unnötig für literaturwissenschaftliche Diskussionen betrachten.
Was ist die persönliche Meinung des Autors über das Buch?
Der Autor äußert eine kritische Meinung über das Buch und empfiehlt es nur Menschen mit starkem Magen und unbefriedigten, frustrierten oder kastrierten Neigungen. Er stellt die Relevanz des Buches in Frage und bezweifelt, dass es irgendjemandem gefällt.
Welche anderen Informationen sind in dem Text enthalten?
Der Text enthält auch Zitate aus dem Buch "Die Klavierspielerin", eine Einleitung über die Rolle der Frau im späten 20. Jahrhundert, eine Diskussion über die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und die Emanzipation der Frau, sowie eine Quellenangabe.
- Arbeit zitieren
- Rajmund Laczko (Autor:in), 1997, Spiegelbild einer defekten Frau - Elfriede Jelinek, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94771