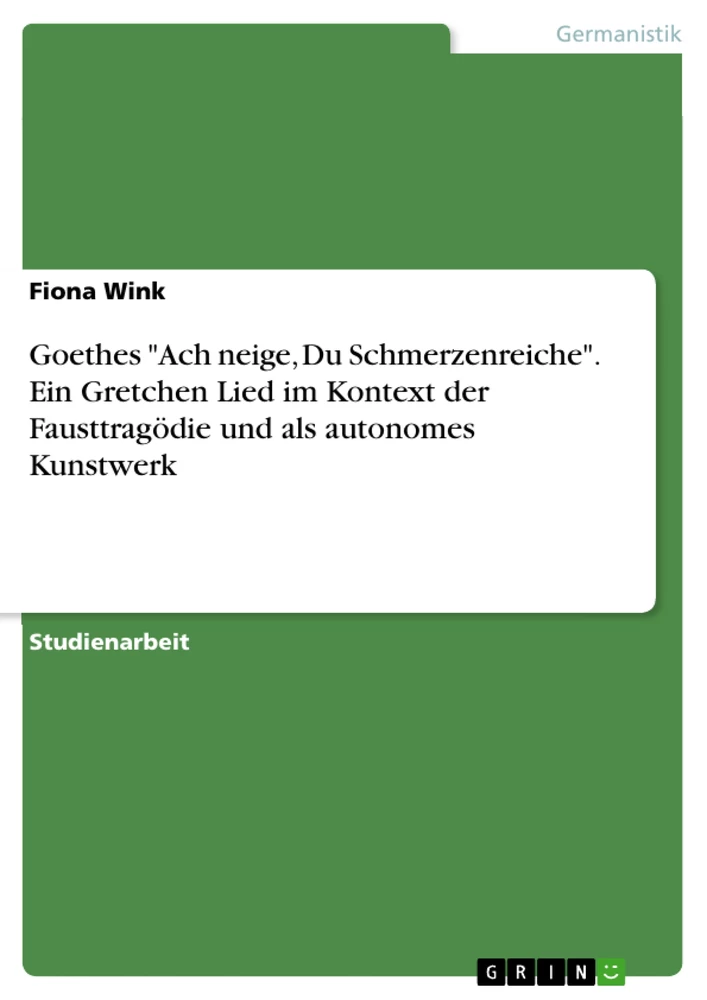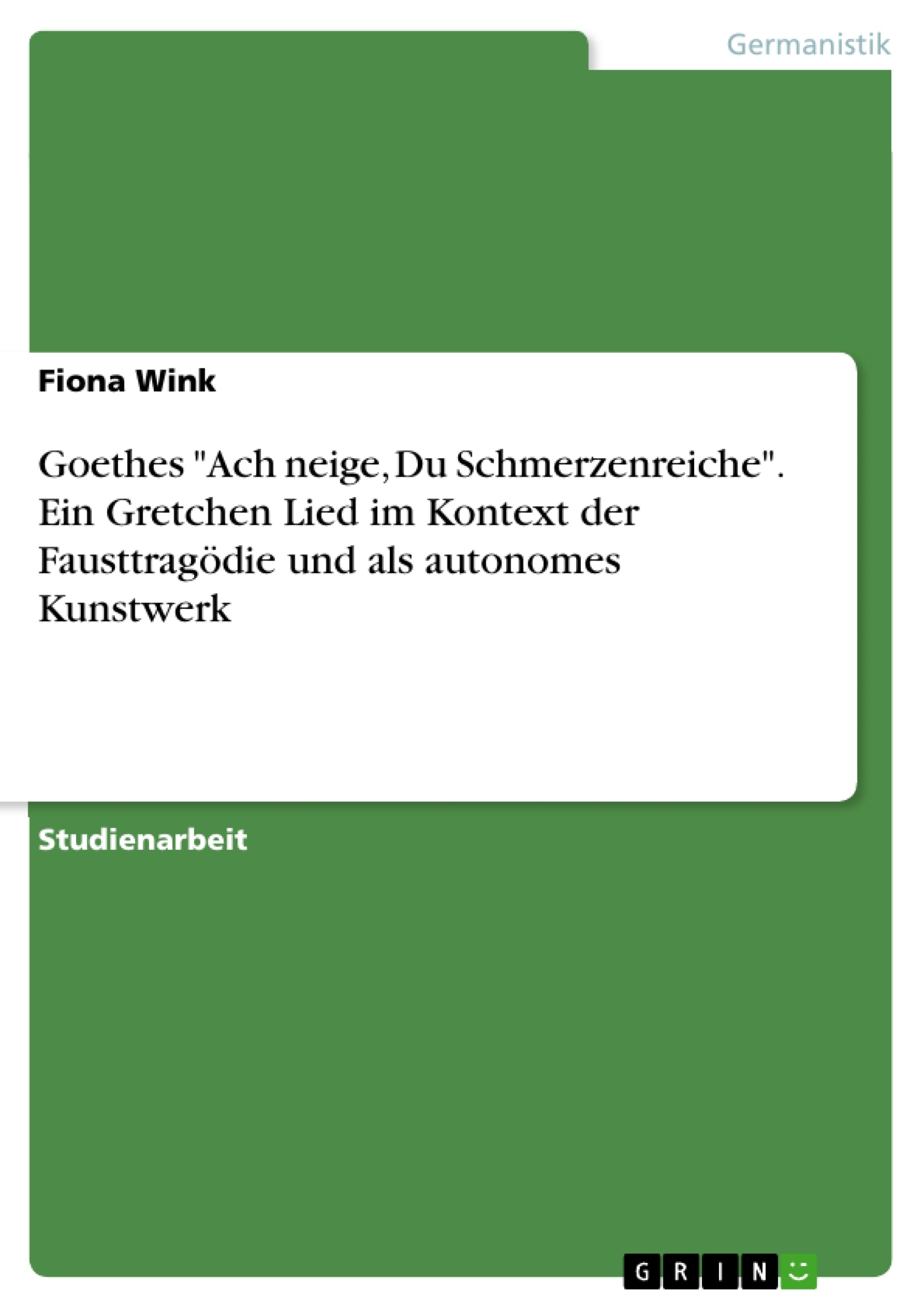Die nachfolgende Hausarbeit untersucht das Gretchenlied "Ach neige, du Schmerzenreiche" als zeitgeschichtliches autonomes Kunstwerk und geht der Fragestellung nach, welche Funktion das Gedicht in der ursprünglichen Faust-Tragödie erfüllt. Dabei konzentriert sie sich im Wesentlichen auf zwei verschiedene Fragestellungen: Was sagt das Gedicht über die Gretchenfigur aus und wie wird das Gretchenlied in der Fausttragödie eingesetzt? Wie funktioniert das Gedicht als autonomes Kunstwerk beziehungsweise als Kunstlied?
Die Gretchentragödie von Johann Wolfgang von Goethe spielt im Urfaust von 1887 eine ganz besondere Rolle. Faust, der als Philosoph und Gelehrter auftritt und die Freuden des Lebens ausprobiert verführt das junge Gretchen, was durch ihre Unschuld und Schönheit einen besonderen Reiz auf ihn ausübt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale der Literatur des Sturm und Drang
- Genieästhetik und der Einfluss Shakespeares
- Das Kindsmordmotiv
- Untersuchung des lyrischen Textes
- Gegenstand der einzelnen Strophen
- Sprechsituation
- Gedichtform, Strophenform, Metrum, Reimschema
- Tropen und Figuren
- Das Gedicht im Faustkontext
- Funktion des Gretchenliedes
- Bedeutung für die Konstruktion der Gretchenfigur
- Das Gebet im historischen Kontext
- Das Gedicht als autonomes Kunstwerk und Kunstlied
- Zusammenfassendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Gretchenlied „Ach neige, du Schmerzenreiche“ im Kontext der Fausttragödie und als autonomes Kunstwerk. Sie befasst sich mit der Funktion des Gedichts in der ursprünglichen Fausttragödie und untersucht, wie es als Kunstlied funktioniert. Die Arbeit beleuchtet die Gestaltungselemente des Gedichts im Hinblick auf die Literatur des Sturm und Drang und untersucht, ob es als typisches Beispiel eines lyrischen Textes dieser Epoche angesehen werden kann.
- Die Funktion des Gretchenlieds in der Fausttragödie und seine Bedeutung für die Charakterisierung von Gretchen
- Die Analyse des Gedichts als autonomes Kunstwerk und seine Merkmale als Kunstlied
- Die Einordnung des Gedichts in die Literatur des Sturm und Drang
- Die Relevanz des Themas Kindsmord im Kontext des 18. Jahrhunderts
- Die Sprechsituation, das Metrum, das Reimschema, die Strophenform, die Tropen und Figuren sowie der Inhalt der einzelnen Strophen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung und Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die wichtigen Merkmale der Literatur des Sturm und Drang, darunter die Genieästhetik und den Einfluss Shakespeares sowie das Motiv des Kindsmords. Kapitel 3 untersucht das Gretchenlied als lyrischen Text, wobei die Sprechsituation, das Metrum, das Reimschema, die Strophenform, die Tropen und Figuren sowie der Inhalt der einzelnen Strophen analysiert werden. Kapitel 4 betrachtet das Gedicht im Kontext der Fausttragödie und erläutert die Funktion des Gretchenlieds, seine Bedeutung für die Konstruktion der Gretchenfigur und das Gebet im historischen Kontext. Kapitel 5 untersucht das Gedicht als autonomes Kunstwerk und Kunstlied. Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Sturm und Drang, Genieästhetik, Shakespeare, Kindsmord, Gretchenlied, Fausttragödie, lyrischer Text, Sprechsituation, Metrum, Reimschema, Strophenform, Tropen, Figuren, autonomes Kunstwerk, Kunstlied, historischer Kontext, Religion, 18. Jahrhundert
- Quote paper
- Fiona Wink (Author), 2019, Goethes "Ach neige, Du Schmerzenreiche". Ein Gretchen Lied im Kontext der Fausttragödie und als autonomes Kunstwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/946342