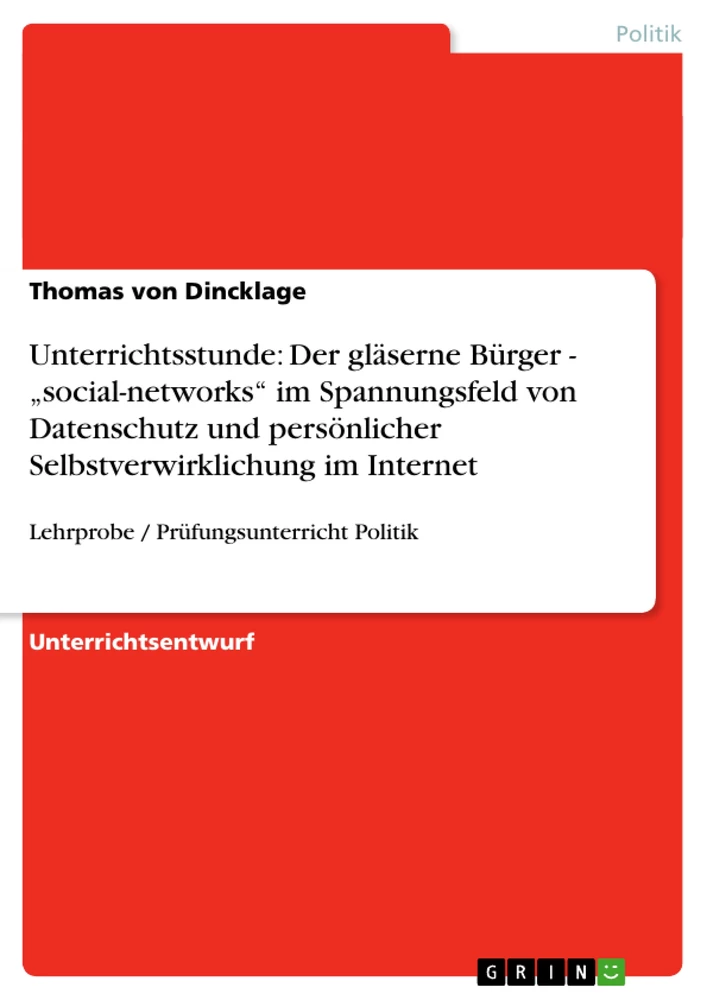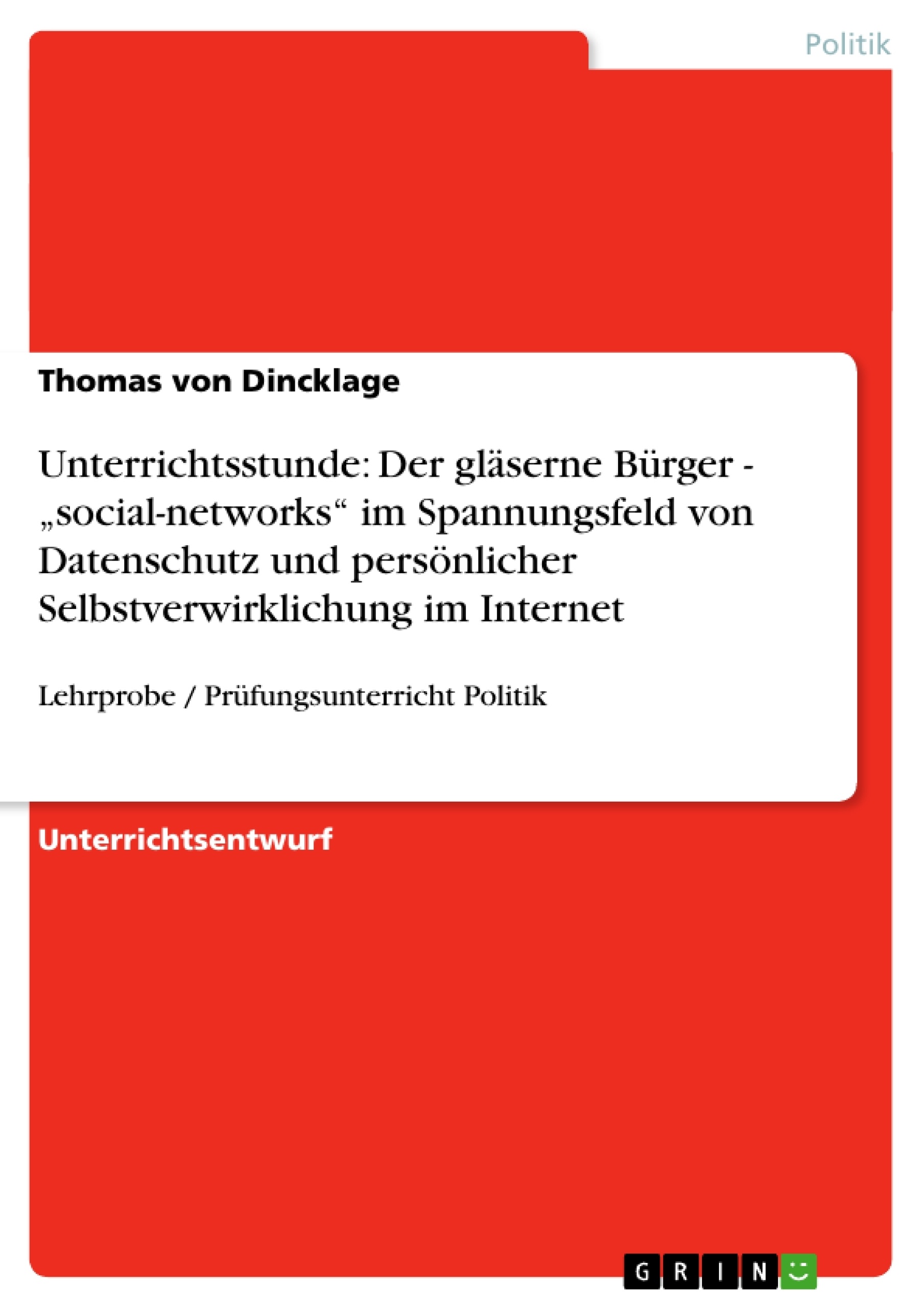Die Bedeutung des Themas für die Schüler ergibt sich aus der Situations-, der Problem- sowie der Zukunftsorientierung. Im Unterricht wird bewusst auf ausgewählte „social-networks“ zurückgegriffen, die allen Schülern aus ihrem Privatleben bekannt sind. Die Diskussion um diese Plattformen im Internet wie StudiVZ wurde mit dem Verkauf der Website an den Holtzbrink-Verlag im Jahr 2007 sehr aufmerksam durch die Schüler verfolgt und kritisch betrachtet. Nicht zuletzt durch die Informationsbeschaffung und Recherche auf unterschiedlichsten Plattformen, Wikis und Blogs im Internet erscheint eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zwiespalt zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Selbstdarstellung in „social-networks“ auf der anderen Seite gerechtfertigt.
Insbesondere durch die Verabschiedung der Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung zum sind die Schüler direkt von der Thematik betroffen. In diesem Zusammenhang offenbarten die Schüler bereits in den vorangegangenen Stunden ihre Ängste und Sorgen darüber, welche Daten gespeichert und weiterverarbeitet würden.
Durch die geplante Erweiterung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung um Internetverbindungsdaten und -inhalte wird deutlich, dass das Unterrichtsthema auch zukünftig für die Schüler ein hohes Maß an Aktualität beinhaltet. Des Weiteren müssen sich die Schüler auch der negativen Konsequenzen (Jobverlust, Ablehnung eines Bewerbers, Werbeflut, etc.) bewusst werden, die mit einer Veröffentlichung persönlicher sowie personenbezogener Daten einhergehen würden.
Die Schüler sind aber nicht nur in ihrem Privatleben vom Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und persönlicher Selbstverwirklichung betroffen. Vielmehr könnte es sein, dass sie später aus beruflicher Sicht durchaus ein Interesse an der Auswertung von öffentlichen Informationen haben, bspw. im Rahmen einer Tätigkeit im Personalentwicklungsbereich eines Unternehmens, um Informationen über Bewerber einzuholen. Eine Möglichkeit dazu bietet das Karrierenetzwerk XING, in dem geschäftliche Kontakte geknüpft werden können und in dem sich Bewerber einem breiten Publikum präsentieren können.
Neben den Vorteilen, die sich aus der Teilnahme an „social-networks“ ergeben, lassen die Schüler jedoch häufig außer Acht, dass Mobbing, Stalking und Psychoterror innerhalb dieser Netzwerke keine Seltenheit ist. Insbesondere StudiVZ ist durch die Funktion „Gruscheln“ in die Kritik geraten, die mitunter zum Mobbing und Stalking instrumentalisiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Analyse des Bedingungsfeldes
- 2. Didaktisch-methodische Konzeption
- 2.1 Analyse der curricularen Vorgaben
- 2.2 Analyse der Thematik, ihrer Komplexität und ihre fachliche Begründung
- 2.2.1 Stoffstrukturgerüst
- 2.2.2 Schichtung
- 2.2.3 Die Bedeutung des Themas für die Schüler
- 2.3 Auswahl- und Reduktionsentscheidungen
- 2.4 Anzustrebende Kompetenzen/Lehr- und Lernziele
- 2.4.1 Stundenlernziel
- 2.4.2 Ergebnisorientierte Lernziele
- 2.4.3 Prozessorientierte Lernziele
- 3. Gestaltung der Verlaufsstruktur des Lernprozesses
- 4. Unterrichtsverlaufsskizze
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Unterrichtsentwurfs besteht darin, die Schüler der Berufsoberschule Klasse 13 im Fach Politik in die Thematik „Social Networks“ im Spannungsfeld von Datenschutz und persönlicher Selbstverwirklichung einzuführen. Der Unterricht soll die kritische Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken der Nutzung sozialer Medien fördern und die Schüler befähigen, die komplexen Zusammenhänge zwischen individuellen Freiheitsrechten und dem Gemeinwohl zu verstehen.
- Datenschutz im Kontext sozialer Netzwerke
- Persönliche Selbstverwirklichung und Online-Identität
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Regulierung des Internets
- Soziale und psychologische Auswirkungen der Social-Media-Nutzung
- Möglichkeiten und Grenzen der Online-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Analyse des Bedingungsfeldes: Diese Analyse beschreibt die Schüler der Klasse BOW 3-2, ihre Vorbildung, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Vorkenntnisse zum Thema „Social Networks“. Es wird auf die Heterogenität der Altersstruktur eingegangen und die homogene schulische Vorbildung hervorgehoben. Die Schüler zeichnen sich durch ein hohes Abstraktionsvermögen und aktives Schülerverhalten aus. Besondere Erwähnung finden einige Schüler, die kontinuierlich sehr gute Beiträge leisten, während andere eher leistungsschwächer sind. Die Analyse betont das ausgeprägte Vorwissen der Schüler zu Social Networks und den damit verbundenen Aspekten wie Datenschutz. Die Lernbereitschaft und das Arbeitstempo werden als gut bewertet.
2. Didaktisch-methodische Konzeption: Dieses Kapitel beschreibt die didaktische und methodische Grundlage des Unterrichts. Es wird Bezug genommen auf die curricularen Vorgaben des Landes Niedersachsen und die Einordnung des Themas in die Themenschwerpunkte „Grundrechte und Menschenrechte“, „Lebenskonzepte“ und „Lebensrisiken“. Der Unterricht zielt darauf ab, die Fähigkeit der Schüler zu fördern, Möglichkeiten der gesellschaftlichen Kommunikation kritisch zu nutzen und Angebote neuer Informations- und Kommunikationstechniken zu prüfen. Es werden die relevanten Qualifikationen der Rahmenrichtlinien genannt und fächerübergreifende Aspekte zu den Fächern Technik und Wirtschaft beleuchtet. Die Komplexität des Themas wird durch die Darstellung verschiedener Schichten (politische, juristische, soziologische und psychologische) veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Social Networks, Datenschutz, Persönliche Selbstverwirklichung, Internet, Rechtliche Rahmenbedingungen, Kommunikation, Grundrechte, Medienkompetenz, kritische Mediennutzung, gesellschaftliche Kommunikation, Online-Identität, Vorratsdatenspeicherung, Jugendschutz.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Social Networks im Spannungsfeld von Datenschutz und persönlicher Selbstverwirklichung
Was ist der Inhalt des Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf für die Berufsoberschule Klasse 13 (Fach Politik) behandelt das Thema "Social Networks" im Kontext von Datenschutz und persönlicher Selbstverwirklichung. Er umfasst eine detaillierte Analyse des Bedingungsfeldes (Schülerprofil, Vorkenntnisse), eine didaktisch-methodische Konzeption mit Lernzielen und Verlaufsstruktur, eine Unterrichtsverlaufsskizze, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden im Unterrichtsentwurf behandelt?
Die zentralen Themen sind Datenschutz im Kontext sozialer Netzwerke, persönliche Selbstverwirklichung und Online-Identität, rechtliche Rahmenbedingungen und Regulierung des Internets, soziale und psychologische Auswirkungen der Social-Media-Nutzung sowie Möglichkeiten und Grenzen der Online-Kommunikation. Der Entwurf verbindet Aspekte der Politik, des Rechts, der Soziologie und der Psychologie.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Der Unterricht soll die Schüler befähigen, die Chancen und Risiken der Nutzung sozialer Medien kritisch zu bewerten und die komplexen Zusammenhänge zwischen individuellen Freiheitsrechten und dem Gemeinwohl zu verstehen. Es geht um die Förderung der Medienkompetenz und die Entwicklung der Fähigkeit, gesellschaftliche Kommunikation kritisch zu nutzen und Angebote neuer Informations- und Kommunikationstechniken zu prüfen.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in folgende Abschnitte: Analyse des Bedingungsfeldes (Schülercharakteristik, Vorkenntnisse), didaktisch-methodische Konzeption (curriculare Vorgaben, Lernziele, Methoden), Gestaltung der Verlaufsstruktur des Lernprozesses, Unterrichtsverlaufsskizze und Literaturverzeichnis. Die didaktisch-methodische Konzeption beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Stoffstruktur, der Schichtung des Themas und der Auswahl- und Reduktionsentscheidungen.
Welche didaktisch-methodischen Ansätze werden verwendet?
Der Entwurf beschreibt die didaktisch-methodische Grundlage, berücksichtigt curriculare Vorgaben des Landes Niedersachsen und ordnet das Thema in die Themenschwerpunkte „Grundrechte und Menschenrechte“, „Lebenskonzepte“ und „Lebensrisiken“ ein. Es werden fächerübergreifende Aspekte zu den Fächern Technik und Wirtschaft beleuchtet. Die Komplexität des Themas wird durch die Darstellung verschiedener Schichten (politische, juristische, soziologische und psychologische) veranschaulicht.
Für welche Schülergruppe ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf richtet sich an Schüler der Berufsoberschule Klasse 13 im Fach Politik. Die Analyse des Bedingungsfeldes berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften dieser Schülergruppe, einschließlich ihrer Vorkenntnisse, ihres Leistungsniveaus und ihrer Heterogenität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Social Networks, Datenschutz, Persönliche Selbstverwirklichung, Internet, Rechtliche Rahmenbedingungen, Kommunikation, Grundrechte, Medienkompetenz, kritische Mediennutzung, gesellschaftliche Kommunikation, Online-Identität, Vorratsdatenspeicherung, Jugendschutz.
- Arbeit zitieren
- Thomas von Dincklage (Autor:in), 2008, Unterrichtsstunde: Der gläserne Bürger - „social-networks“ im Spannungsfeld von Datenschutz und persönlicher Selbstverwirklichung im Internet , München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94323