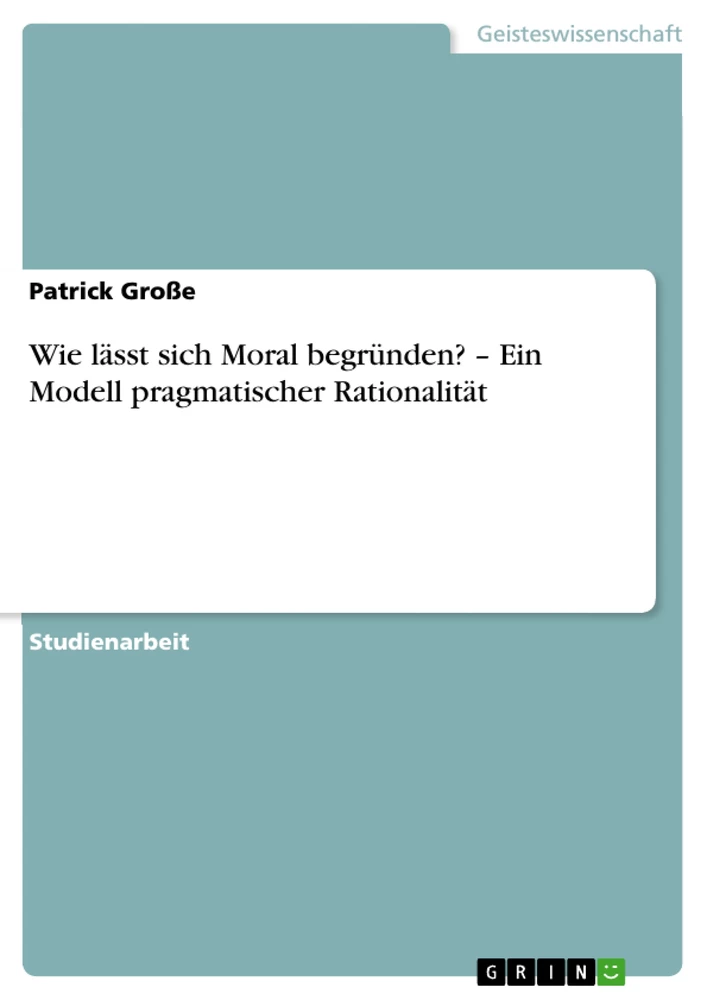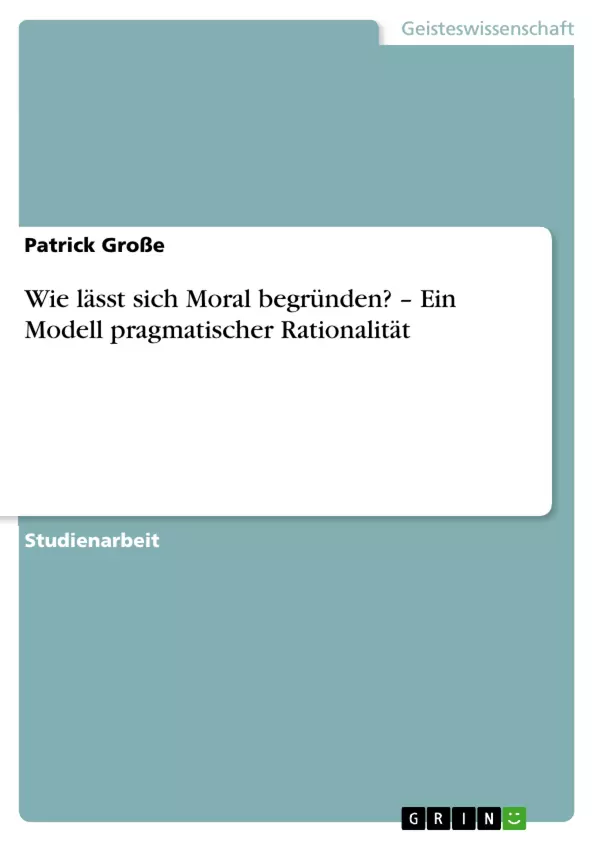1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden
In dieser Arbeit möchte ich mich mit dem Thema der Moralphilosophie beschäftigen, um so einen Vorschlag zur Begründung von Moral zu erarbeiten, der nicht nur auf natürliche Grundlagen des menschlichen Wesens zurückgreift, sondern auch die Rationalität als Grund für gemeinschaftsförderliche Handlungen annimmt.
Nachdem die Rolle der Philosophie im Kampf um eine Moralbegründung verdeutlicht wurde, gehe ich zunächst zur Begründungsfrage nach dem ‚Warum’ über. Im Zuge der ersten Überlegungen zur Moralbegründung im Allgemeinen, bot sich ein grundlegender Skeptizismus an, der gegenüber allen menschlichen Gebilden, Erfindungen und Gedankengängen nicht mit kritischer Aufmerksamkeit spart. Sodann stellte sich mir die Frage, was diesen Skeptizismus begründet. So kam ich zu dem Schluss, die These zu formulieren, dass der Mensch ein Individuum in der Gesellschaft ist und die Moral als Mittel für ein möglichst erträgliches Zusammenleben gilt. [...]
Um die Erfahrungswissenschaften (empirische Wissenschaften) zu stärken, stützt sich mein Vorschlag zur Moralbegründung in weiten Teilen darauf, was die naturalistische Ethik auf den Plan ruft. Diese Position möchte ich dann darlegen, indem der Begriff der Moral geklärt und grundsätzlich festgehalten wird: der Mensch ist in erster Linie notwendig ein biologisches Wesen aus Fleisch und Blut. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden
- 1.1 „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.“ – moralphilosophische Geltungsansprüche
- 1.2 Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus als Ausgangsbasis von moralischen Begründungsversuchen
- 2. Begründungsansätze für Moral
- 2.1 Kants deontologischer Begründungsversuch – eine normative Ethik
- 2.2 Der pragmatische Begründungsversuch – ein moralisches Gefühl
- 3. Die naturalistische Ethik - soziobiologische Grundlagen und moralischer Anspruch
- 3.1 Rationalitätsansprüche und Moralkriterien
- 3.2 Der Mensch - ein Individuum im Gemeinwesen
- 3.3 Versuch einer Abgrenzung zu Foot und McDowell
- 4. Die Fähigkeit moralischer Abstraktion – ein naturalistisches Modell pragmatischer Moralbegründung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begründung von Moral unter Einbezug sowohl natürlicher Grundlagen des menschlichen Wesens als auch der Rationalität als Grundlage gemeinschaftsförderlicher Handlungen. Sie hinterfragt verschiedene Begründungsansätze und entwickelt ein eigenes Modell.
- Die Rolle der Philosophie bei der Begründung von Moral
- Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus als Ausgangspunkt für moralische Begründungen
- Vergleichende Analyse verschiedener ethischer Positionen (Kant, Pragmatismus)
- Die Bedeutung der naturalistischen Ethik
- Ein naturalistisches Modell pragmatischer Moralbegründung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die wissenschaftliche Aufgabe der Moralphilosophie: Begründungen finden: Dieses einführende Kapitel beleuchtet die Aufgabe der Moralphilosophie, Moral zu begründen. Es diskutiert die Grenzen einzelwissenschaftlicher Ansätze und betont die Rolle der Philosophie bei der Beantwortung grundlegender Fragen nach dem "Warum". Der Autor stellt seine These vor, dass der Mensch als Individuum in der Gesellschaft Moral als Mittel für ein erträgliches Zusammenleben benötigt. Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus wird als Ausgangspunkt der Argumentation etabliert, wobei ein grundlegender Skeptizismus gegenüber allen menschlichen Konstrukten kritisch hinterfragt wird. Die Arbeit kündigt einen Vergleich verschiedener Begründungsansätze an und benennt die naturalistische Ethik als zentrale Grundlage des eigenen Vorschlags.
1.1 „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.“ – moralphilosophische Geltungsansprüche: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Philosophie im Kontext der Moralbegründung. Es unterscheidet zwischen der Philosophie als Sammlung von Erkenntnissen und dem Philosophieren als aktivem Streben nach Erkenntnis. Es wird argumentiert, dass die Philosophie im Gegensatz zu Einzelwissenschaften in der Lage ist, die grundlegenden "Warum"-Fragen zu beantworten, die Einzelwissenschaften aufgrund ihrer methodischen Beschränkungen nicht klären können. Die Bedeutung des analytischen Denkens und die Suche nach Rechtfertigung für Denken und Handeln werden hervorgehoben, was schließlich in die Diskussion um Moral und Ethik überleitet.
3. Die naturalistische Ethik - soziobiologische Grundlagen und moralischer Anspruch: Dieses Kapitel präsentiert die naturalistische Ethik als Grundlage des vom Autor vorgeschlagenen Moralmodells. Es betont die biologische Natur des Menschen und die Notwendigkeit, diese bei der Moralbegründung zu berücksichtigen. Es wird der Begriff der Moral geklärt und die Position der naturalistischen Ethik in Abgrenzung zu anderen Ansätzen, wie den des Deontologischen, dargelegt. Das Kapitel bereitet den Boden für die spätere Vorstellung des eigenen Modells, indem es die Wichtigkeit soziobiologischer Grundlagen und den Anspruch an rationale Moralkriterien herausstellt. Die Abgrenzung zu Philosophen wie Philippa Foot wird angekündigt.
4. Die Fähigkeit moralischer Abstraktion – ein naturalistisches Modell pragmatischer Moralbegründung: In diesem Kapitel wird das vom Autor entwickelte Modell der Moralbegründung vorgestellt. Es wird die „Fähigkeit moralischer Abstraktion“ als ein naturalistisches und pragmatisches Modell präsentiert. Dieses Modell integriert vermutlich soziobiologische Erkenntnisse mit rationalen Erwägungen zum menschlichen Zusammenleben, wodurch ein umfassenderer und plausiblerer Ansatz zur Begründung von Moral ermöglicht werden soll. Dieses Kapitel ist der Höhepunkt der Argumentation und stellt die Synthese der vorherigen Kapitel dar.
Schlüsselwörter
Moralphilosophie, Moralbegründung, Naturalistische Ethik, Pragmatische Rationalität, Anthropozentrismus, Kant, Soziobiologie, Moralische Abstraktion, Gemeinschaftsförderliche Handlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Begründung von Moral. Sie untersucht, wie Moral begründet werden kann, indem sie sowohl die natürlichen Grundlagen des menschlichen Wesens als auch die Rationalität als Grundlage gemeinschaftsförderlicher Handlungen berücksichtigt. Verschiedene Begründungsansätze werden verglichen und ein eigenes Modell entwickelt.
Welche Begründungsansätze für Moral werden untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem den deontologischen Ansatz Kants und einen pragmatischen Begründungsversuch, der ein moralisches Gefühl in den Mittelpunkt stellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der naturalistischen Ethik und deren soziobiologischen Grundlagen.
Was ist der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus und welche Rolle spielt er?
Der erkenntnistheoretische Anthropozentrismus dient als Ausgangspunkt für die moralischen Begründungsversuche. Er wird kritisch hinterfragt, wobei ein grundlegender Skeptizismus gegenüber menschlichen Konstrukten eine Rolle spielt. Der Mensch als Individuum in der Gesellschaft und sein Bedarf an Moral für ein erträgliches Zusammenleben steht im Fokus.
Welche Rolle spielt die naturalistische Ethik?
Die naturalistische Ethik bildet die Grundlage des vom Autor vorgeschlagenen Moralmodells. Sie betont die biologische Natur des Menschen und die Notwendigkeit, diese bei der Moralbegründung zu berücksichtigen. Sie wird abgegrenzt von anderen Ansätzen, insbesondere dem deontologischen Ansatz.
Was ist das Kernargument des vom Autor entwickelten Modells?
Das Modell der Moralbegründung basiert auf der „Fähigkeit moralischer Abstraktion“. Es integriert soziobiologische Erkenntnisse mit rationalen Erwägungen zum menschlichen Zusammenleben, um einen umfassenden und plausiblen Ansatz zur Begründung von Moral zu schaffen. Es stellt eine Synthese der vorherigen Kapitel dar.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beleuchtet die Aufgabe der Moralphilosophie, Moral zu begründen. Kapitel 1.1 analysiert die Rolle der Philosophie bei der Moralbegründung. Kapitel 2 untersucht verschiedene Begründungsansätze. Kapitel 3 präsentiert die naturalistische Ethik. Kapitel 4 stellt das eigene Modell der Moralbegründung vor, und Kapitel 5 bietet ein Fazit. Die einzelnen Kapitel werden im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Moralphilosophie, Moralbegründung, Naturalistische Ethik, Pragmatische Rationalität, Anthropozentrismus, Kant, Soziobiologie, Moralische Abstraktion, Gemeinschaftsförderliche Handlungen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Moralphilosophie, Ethik und den philosophischen Grundlagen von Moral auseinandersetzt. Die OCR-Daten sind ausschließlich für die akademische Nutzung bestimmt.
- Quote paper
- Patrick Große (Author), 2007, Wie lässt sich Moral begründen? – Ein Modell pragmatischer Rationalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93790