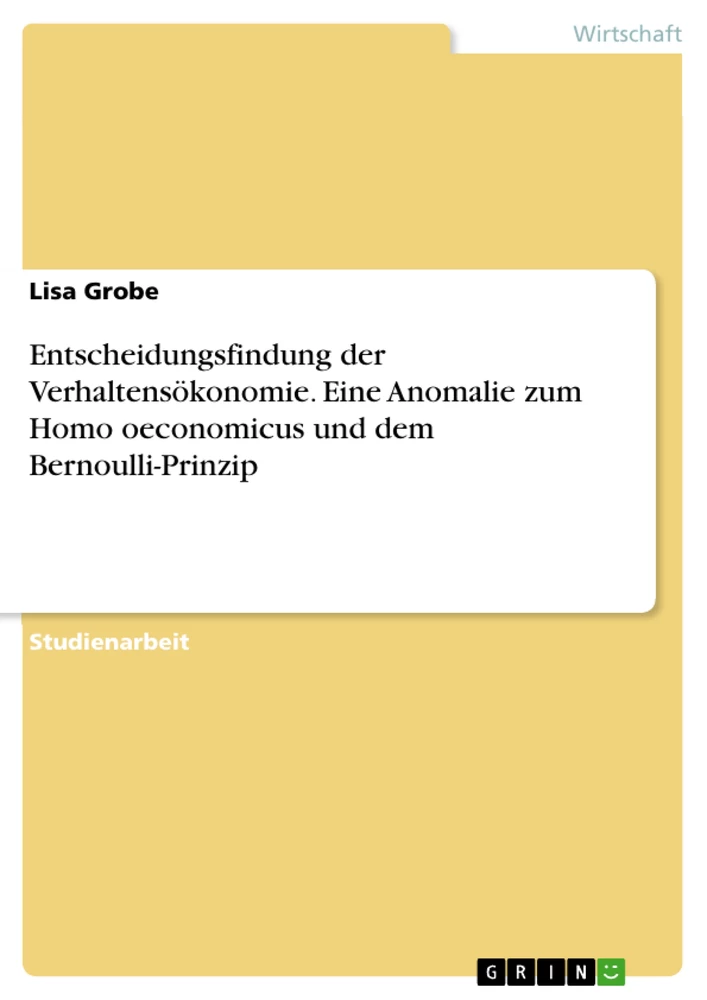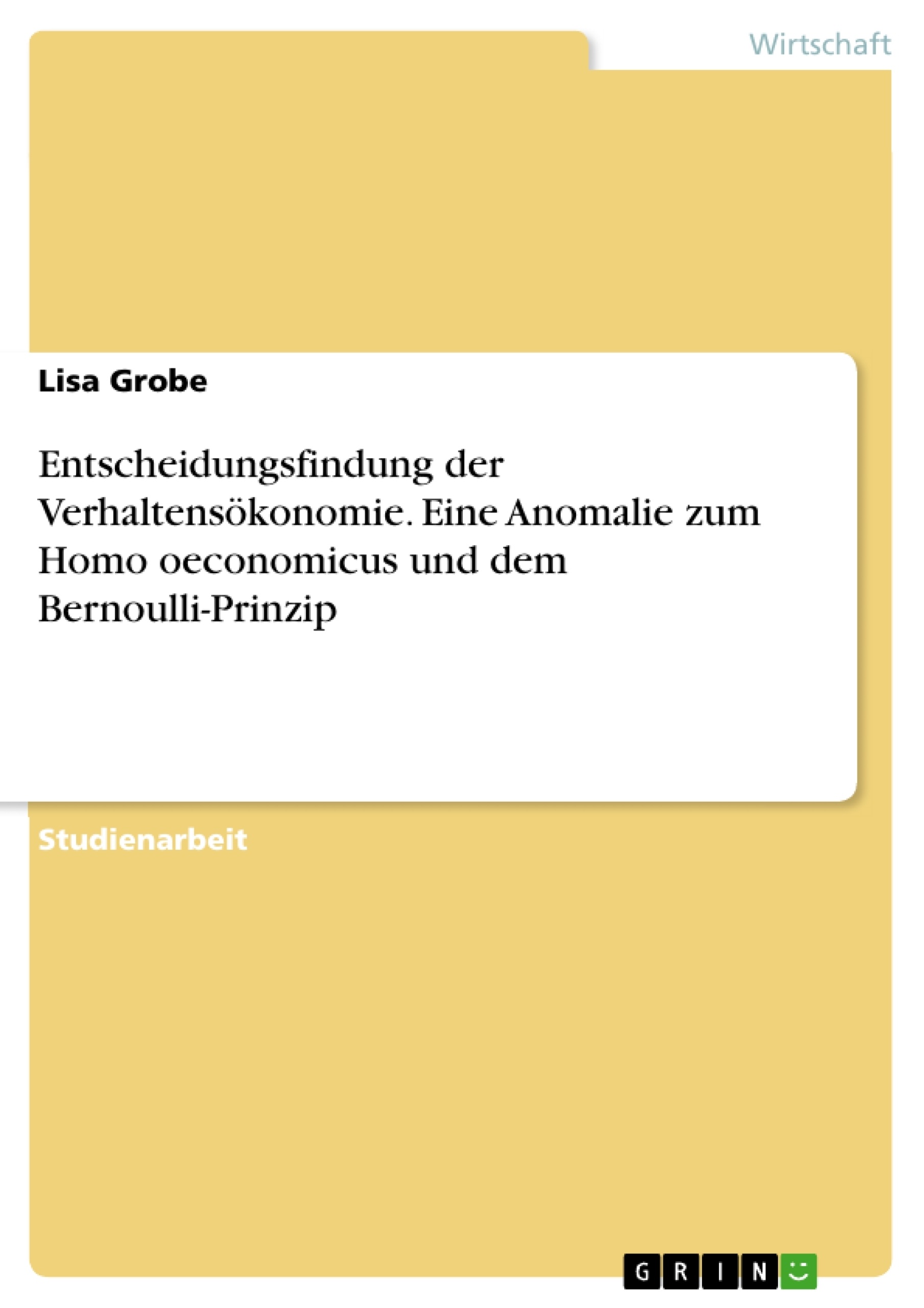Diese Arbeit soll sich mit dem Problem der Diskrepanz zwischen Theorie (der vorherrschenden Meinung über den Homo oeconomicus und das darauf ableitende Bild über das nutzenmaximierende Entscheiden und Handeln des Menschen) und der tatsächlichen Praxis beschäftigen. Eine kritische Betrachtung des Homo oeconomicus und der vorausgehenden Theorie, das Bernoulli Prinzip, im Vergleich zu der Verhaltensökonomie (behavioral economics), dessen Grundbaustein die Prospect Theory (im Folgenden abgekürzt mit PT) bildet, soll stattfinden. Die aus der PT folgenden Effekte bezüglich risikobehafteter Entscheidungen oder Entscheidungen unter Unsicherheit werden ebenfalls als Diskussionsbasis genommen.
Der Impuls für das Themengebiet dieser Arbeit liegt darin, eine bessere Beleuchtung des psychologischen Aspekts in der Wirtschaft hervorzubringen, da wie im Laufe der Arbeit nachzuvollziehen ist, die Modelle der Ökonomie und normativen Entscheidungstheorien einige Lücken bezüglich wichtiger und entscheidender Faktoren in Hinblick auf eine weitreichende Erklärung des menschlichen Verhaltens von Entscheidungen, besonders denen unter Risiko und Unsicherheit, aufweisen. Insbesondere soll die Erkenntnis über den Wandel vom wirtschaftlich rational handelnden Homo oeconomicus zu den Theorien der Verhaltensökonomie deutlich gemacht werden und ein möglicher Anreiz zur Verabschiedung beziehungsweise Umwandlung dieses Modells gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Struktur dieser Arbeit
- Die normative Entscheidungstheorie
- Wesen und geschichtliche Einordnung
- Das Modell des Homo Oeconomicus
- Das Bernoulli-Prinzip
- Der abnehmende Grenznutzen
- Die Subjektive Erwartungsnutzen Theorie
- Kritik der normativen Entscheidungstheorie
- Verhaltensökonomie (behavioral economics)
- Das Wesen der Verhaltensökonomie
- Die Geschichte der Verhaltensökonomie
- Prospect Theory
- Die zwei Phasen der Prospect Theory
- Die Wertfunktion
- Risikoaversion
- Der Besitztumseffekt
- Verlustaversion
- Kritik der deskriptiven Entscheidungstheorie
- Fazit Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die beiden vorherrschenden Theorien der Entscheidungstheorie: die normative und die deskriptive. Er analysiert das Modell des Homo oeconomicus und das Bernoulli-Prinzip als Grundlage der normativen Theorie und stellt diese der Verhaltensökonomie und der Prospect Theory gegenüber. Die Zielsetzung besteht darin, die Stärken und Schwächen beider Ansätze aufzuzeigen und die Grenzen der Annahme einer vollständigen Rationalität im menschlichen Entscheidungsverhalten zu beleuchten.
- Das Modell des Homo oeconomicus und seine Annahmen
- Das Bernoulli-Prinzip und die Erwartungsnutzentheorie
- Die Prospect Theory und ihre zentralen Elemente (Wertfunktion, Verlustaversion etc.)
- Die Grenzen der Rationalität im menschlichen Entscheidungsverhalten
- Der Vergleich der normativen und deskriptiven Entscheidungstheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Entscheidungstheorie ein und stellt die beiden zentralen Ansätze, die normative und die deskriptive Entscheidungstheorie, vor. Sie hebt die Bedeutung von Entscheidungen im Alltag hervor und unterstreicht den Unterschied zwischen der Beschreibung tatsächlichen Verhaltens (deskriptiv) und der Vorschreibung rationalen Handelns (normativ). Die Problemstellung benennt die Diskrepanz zwischen dem theoretischen Modell des Homo oeconomicus und dem realen Entscheidungsverhalten des Menschen. Die Zielsetzung der Arbeit wird klar formuliert: die Untersuchung der Stärken und Schwächen beider theoretischer Ansätze. Die Struktur des Aufsatzes wird im Anschluss kurz umrissen.
Die normative Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel beschreibt die normative Entscheidungstheorie, insbesondere das Modell des Homo oeconomicus und das Bernoulli-Prinzip. Es erläutert, wie der Homo oeconomicus rationale Entscheidungen unter Unsicherheit trifft, indem er Nutzen maximiert und alle relevanten Informationen berücksichtigt. Das Bernoulli-Prinzip und der abnehmende Grenznutzen werden detailliert erklärt. Der Abschnitt schließt mit einer kritischen Betrachtung der normativen Theorie, die auf die Unvereinbarkeit mit empirischen Beobachtungen hinweist.
Verhaltensökonomie (behavioral economics): Dieses Kapitel widmet sich der deskriptiven Entscheidungstheorie, insbesondere der Prospect Theory. Es wird detailliert erklärt, wie diese Theorie die Anomalien des menschlichen Entscheidungsverhaltens, wie Referenzpunktabhängigkeit, Verlustaversion und Besitztumseffekt, berücksichtigt. Die Wertfunktion und die zwei Phasen der Prospect Theory werden analysiert, um zu zeigen, wie Menschen in der Realität Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Betrachtung der deskriptiven Theorie und ihrer Grenzen.
Schlüsselwörter
Homo oeconomicus, Bernoulli-Prinzip, Erwartungsnutzentheorie, Verhaltensökonomie, Prospect Theory, Referenzpunktabhängigkeit, Verlustaversion, Besitztumseffekt, begrenzte Rationalität, Entscheidungsfindung, normative Entscheidungstheorie, deskriptive Entscheidungstheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Entscheidungstheorie: Normative und Deskriptive Ansätze"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die normative und deskriptive Entscheidungstheorie. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine detaillierte Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Modells des Homo oeconomicus und des Bernoulli-Prinzips (normative Theorie) mit der Verhaltensökonomie und der Prospect Theory (deskriptive Theorie).
Welche Theorien werden verglichen?
Der Text vergleicht die normative Entscheidungstheorie, repräsentiert durch das Modell des Homo oeconomicus und das Bernoulli-Prinzip, mit der deskriptiven Entscheidungstheorie, insbesondere der Prospect Theory der Verhaltensökonomie. Der Vergleich beleuchtet die Stärken und Schwächen beider Ansätze und untersucht die Grenzen der Annahme vollständiger Rationalität im menschlichen Entscheidungsverhalten.
Was ist der Homo oeconomicus und seine Rolle in der normativen Entscheidungstheorie?
Der Homo oeconomicus ist ein Modell des rationalen Akteurs in der normativen Entscheidungstheorie. Er trifft Entscheidungen, um seinen Nutzen zu maximieren, indem er alle relevanten Informationen berücksichtigt und rational abwägt. Der Text analysiert die Annahmen dieses Modells und seine Grenzen im Vergleich zum realen menschlichen Verhalten.
Was ist das Bernoulli-Prinzip und seine Bedeutung?
Das Bernoulli-Prinzip ist ein zentraler Bestandteil der normativen Entscheidungstheorie. Es besagt, dass Entscheidungen auf der Basis des erwarteten Nutzens getroffen werden, wobei der abnehmende Grenznutzen berücksichtigt wird. Der Text erläutert dieses Prinzip detailliert und diskutiert seine Relevanz und Grenzen.
Was ist die Prospect Theory und wie unterscheidet sie sich von der normativen Theorie?
Die Prospect Theory ist ein zentrales Konzept der deskriptiven Entscheidungstheorie, welches das tatsächliche Entscheidungsverhalten von Menschen beschreibt. Im Gegensatz zum Homo oeconomicus berücksichtigt sie kognitive Verzerrungen wie Referenzpunktabhängigkeit, Verlustaversion und den Besitztumseffekt. Sie erklärt, wie Menschen in der Realität Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, oft abweichend von der rationalen Nutzenmaximierung.
Welche Kritikpunkte werden an der normativen und deskriptiven Entscheidungstheorie geübt?
Der Text kritisiert die normative Entscheidungstheorie aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit empirischen Beobachtungen des menschlichen Entscheidungsverhaltens. Die deskriptive Theorie wird ebenfalls kritisch beleuchtet, wobei ihre Grenzen und Vereinfachungen angesprochen werden.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Homo oeconomicus, Bernoulli-Prinzip, Erwartungsnutzentheorie, Verhaltensökonomie, Prospect Theory, Referenzpunktabhängigkeit, Verlustaversion, Besitztumseffekt, begrenzte Rationalität, Entscheidungsfindung, normative Entscheidungstheorie und deskriptive Entscheidungstheorie.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur normativen Entscheidungstheorie, ein Kapitel zur Verhaltensökonomie (mit Fokus auf der Prospect Theory) und ein Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Wozu dient die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen schnellen Überblick über den Inhalt jedes Abschnitts und erleichtert das Verständnis der komplexen Themen der Entscheidungstheorie.
- Arbeit zitieren
- Lisa Grobe (Autor:in), 2020, Entscheidungsfindung der Verhaltensökonomie. Eine Anomalie zum Homo oeconomicus und dem Bernoulli-Prinzip, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/936180