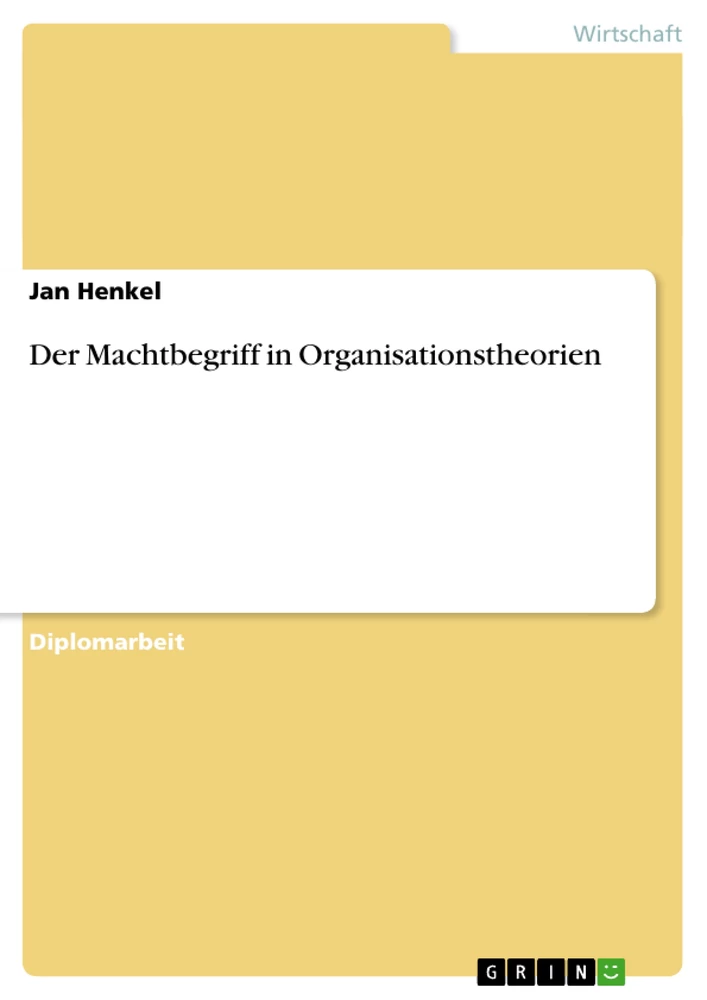Der Titel dieser Arbeit „Der Machtbegriff in Organisationstheorien“ nimmt eine Erkenntnis vorweg, die einer Erklärung bedarf. Es wird der Plural des Terminus Organisationstheorie verwendet, was impliziert, dass nicht nur von der Existenz einer einzigen Organisationstheorie ausgegangen werden kann. Um Klarheit in diesen Ansatz zu bringen, sollen zunächst die im Titel verarbeiteten Begriffe definiert werden. Die Erkenntnisse daraus werden dazu beitragen das Ziel der vorliegenden Arbeit zu formulieren, sowie die Vorgehensweise zu erläutern, wie dieses umgesetzt werden soll.
Die bekannteste und „heute wohl geläufigste Definition ” des Machtbegriffs stammt von Max Weber. Er definiert Macht als „die Möglichkeit innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Möglichkeit beruht ”. Webers Machtdefinition bildet die Grundlage zahlreicher Weiterentwicklungen , was eine nähere Betrachtung dessen Konzeption zu rechtfertigen scheint.
Webers Machtrelation bezieht ein Ungleichgewicht zwischen Machthaber und Machtunterworfenen mit ein, da letztere beispielsweise eine Handlung durchführen müssen, die sie aus freien Stücken, also aus ihrem eigenen Willen heraus, nicht durchführen wollen. Es kann von einer Asymmetrie zwischen Machthaber und Machtunterworfenen gesprochen werden. Weber versteht Macht demnach als Möglichkeit den eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen. Dabei wird Macht als allgemeine, beliebige Chance verstanden sich in sozialen Beziehungen durchzusetzen. Der Machtbegriff wird aufgrund dieser Tatsache auch als amorph bezeichnet, da eine Vielzahl von Eigenschaften dazu beitragen können, dass bestimmte Menschen auch gegen Widerstand ihren Willen durchsetzen. Weber polarisiert Wille auf der einen und Widerstand auf der anderen Seite und führt dies in soziale Beziehungen ein, die er mit dem Machtbegriff verknüpft. Macht wird in sozialen Beziehungen ausgeübt und dies impliziert, dass Macht mit subjektivem Handeln verbunden ist. Aufgrund der Tatsache, dass Macht sozial amorph und daher kaum fassbar ist, wird der Begriff der Herrschaft als Sonderfall von Macht von Max Weber eingeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Begriffsbestimmung
- 1.1.1 Der Begriff der Macht
- 1.1.2 Der Begriff der Organisation
- 1.1.3 Organisationstheorien
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit
- 1.1 Begriffsbestimmung
- 2. Der wissenschaftliche Hintergrund verschiedener Organisationstheorien
- 2.1 Klassische Organisationstheorien
- 2.1.1 Webers Bürokratiemodell
- 2.1.2 Taylors Wissenschaftliche Betriebsführung
- 2.1.3 Fayols Administrative Theorie
- 2.2 Die Human-Relations-Bewegung
- 2.3 Die Entscheidungstheorie
- 2.4 Der Kontingenzansatz
- 2.5 Die organisatorische Systemtheorie
- 2.6 Das Spielkonzept von Crozier und Friedberg
- 2.7 Neue Institutionenökonomie
- 2.7.1 Die Theorie der Verfügungsrechte
- 2.7.2 Der Prinzipal-Agent-Ansatz
- 2.7.3 Der Transaktionskostenansatz
- 2.8 Evolutionstheoretische Ansätze
- 2.9 Der Neo-Institutionalismus
- 2.10 Die Strukturationstheorie
- 2.11 Zwischenergebnis
- 2.1 Klassische Organisationstheorien
- 3. Das Verständnis von Macht
- 3.1 Das Machtbasenkonzept von French und Raven
- 3.1.1 Macht durch Legitimation
- 3.1.2 Macht durch Belohnung
- 3.1.3 Macht durch Bestrafung
- 3.1.4 Macht durch Identifikation
- 3.1.5 Macht durch Sachkenntnis
- 3.1.6 Macht durch Information
- 3.2 Macht als formale Autorität
- 3.3 Macht als Koalition
- 3.4 Macht als Abhängigkeit
- 3.4.1 Macht als Ressourcenabhängigkeit
- 3.4.2 Macht als Pfadabhängigkeit
- 3.5 Macht als Fluktuation
- 3.6 Macht als Asymmetrie
- 3.7 Macht als Handlungsspielraum
- 3.7.1 Die Generierung des Handlungsspielraums
- 3.7.2 Die vermehrte Berücksichtigung von Strukturen
- 3.8 Vernachlässigung von Macht
- 3.9 Macht als Kommunikation
- 3.1 Das Machtbasenkonzept von French und Raven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Machtbegriff im Kontext verschiedener Organisationstheorien. Ziel ist es, die unterschiedlichen Verständnisse von Macht innerhalb dieser Theorien zu analysieren und zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Machtbegriffs von Max Weber bis hin zu modernen Ansätzen.
- Der Machtbegriff nach Max Weber und dessen Weiterentwicklungen
- Analyse verschiedener Organisationstheorien und deren Implikationen für das Machtverständnis
- Vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Machtkonzepte
- Der Einfluss von Macht auf Organisation und Handeln
- Macht als strukturelles und relationales Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den Begriff der Macht und den der Organisation definiert und verschiedene Organisationstheorien einführt. Es dient der Klärung der zentralen Begriffe und formuliert die Zielsetzung und Methodik der Arbeit. Die Definition von Macht nach Max Weber wird als Ausgangspunkt der Analyse präsentiert und die Notwendigkeit einer pluralistischen Betrachtung von Organisationstheorien wird begründet.
2. Der wissenschaftliche Hintergrund verschiedener Organisationstheorien: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über diverse Organisationstheorien, von klassischen Ansätzen wie Webers Bürokratiemodell, Taylors wissenschaftlicher Betriebsführung und Fayols administrativer Theorie bis hin zu modernen Perspektiven wie der neuen Institutionenökonomie, dem Neo-Institutionalismus und der Strukturationstheorie. Der Fokus liegt auf der Darstellung des jeweiligen theoretischen Hintergrunds und der impliziten oder expliziten Behandlung des Machtbegriffs innerhalb dieser Theorien. Die Kapitel erläutern, wie jede Theorie Macht in organisationalen Kontexten versteht und wie sie das Handeln und die Strukturen von Organisationen erklärt. Der Vergleich der verschiedenen Ansätze bereitet den Weg für die detaillierte Analyse des Machtbegriffs in Kapitel 3.
3. Das Verständnis von Macht: Das Kernkapitel dieser Arbeit analysiert verschiedene Konzepte des Machtverständnisses. Es untersucht die Machtbasen nach French und Raven (Legitimation, Belohnung, Bestrafung, Identifikation, Sachkenntnis, Information), betrachtet Macht als formale Autorität, Koalition, Abhängigkeit (Ressourcen- und Pfadabhängigkeit), Fluktuation, Asymmetrie, Handlungsspielraum und Kommunikation. Jedes dieser Konzepte wird ausführlich erläutert, in seinen Implikationen für das Verständnis von Macht in Organisationen erörtert und mit anderen Ansätzen verglichen. Das Kapitel bietet eine umfassende und differenzierte Darstellung der verschiedenen Facetten des Machtbegriffs.
Schlüsselwörter
Macht, Organisationstheorien, Max Weber, Organisation, Autorität, Abhängigkeit, Ressourcen, Strukturen, Handlungsspielraum, Neo-Institutionalismus, Institutionenökonomie, Kontingenzansatz, Human-Relations-Bewegung, Bürokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Organisationstheorien und Macht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Machtbegriff im Kontext verschiedener Organisationstheorien. Ziel ist der Vergleich unterschiedlicher Machtverständnisse innerhalb dieser Theorien und die Darstellung der Entwicklung des Machtbegriffs von Max Weber bis zu modernen Ansätzen. Die Arbeit beleuchtet Macht als strukturelles und relationales Phänomen und untersucht dessen Einfluss auf Organisation und Handeln.
Welche Organisationstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Palette von Organisationstheorien, beginnend mit klassischen Ansätzen wie Webers Bürokratiemodell, Taylors wissenschaftlicher Betriebsführung und Fayols administrativer Theorie. Sie umfasst außerdem die Human-Relations-Bewegung, die Entscheidungstheorie, den Kontingenzansatz, die organisatorische Systemtheorie, das Spielkonzept von Crozier und Friedberg, die neue Institutionenökonomie (Theorie der Verfügungsrechte, Prinzipal-Agent-Ansatz, Transaktionskostenansatz), evolutionstheoretische Ansätze, den Neo-Institutionalismus und die Strukturationstheorie.
Wie wird der Machtbegriff definiert und untersucht?
Die Arbeit untersucht den Machtbegriff multiperspektivisch. Es werden verschiedene Machtkonzepte analysiert, darunter die Machtbasen nach French und Raven (Legitimation, Belohnung, Bestrafung, Identifikation, Sachkenntnis, Information), Macht als formale Autorität, Koalition, Abhängigkeit (Ressourcen- und Pfadabhängigkeit), Fluktuation, Asymmetrie, Handlungsspielraum und Kommunikation. Der Fokus liegt auf dem Vergleich dieser verschiedenen Konzepte und ihrer Implikationen für das Verständnis von Macht in Organisationen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) definiert grundlegende Begriffe wie Macht und Organisation, legt die Zielsetzung fest und beschreibt die Methodik. Kapitel 2 bietet einen Überblick über verschiedene Organisationstheorien und deren implizite/explizite Behandlung des Machtbegriffs. Kapitel 3 analysiert verschiedene Konzepte des Machtverständnisses detailliert und vergleicht diese.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Macht, Organisationstheorien, Max Weber, Organisation, Autorität, Abhängigkeit, Ressourcen, Strukturen, Handlungsspielraum, Neo-Institutionalismus, Institutionenökonomie, Kontingenzansatz, Human-Relations-Bewegung, Bürokratie.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse verschiedener Organisationstheorien und Machtkonzepte. Der Fokus liegt auf der systematischen Untersuchung und Gegenüberstellung unterschiedlicher Perspektiven auf Macht in Organisationen. Die Arbeit stützt sich auf existierende Literatur und theoretische Konzepte.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Organisationstheorien und dem Machtbegriff auseinandersetzen, beispielsweise Studenten, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich des Organisationsmanagements.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet eine Zusammenfassung. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen. (Hinweis: Hier wäre ein Link zum vollständigen Text einzubauen).
- Quote paper
- Diplom Volkswirt; M.A. Jan Henkel (Author), 2008, Der Machtbegriff in Organisationstheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93115