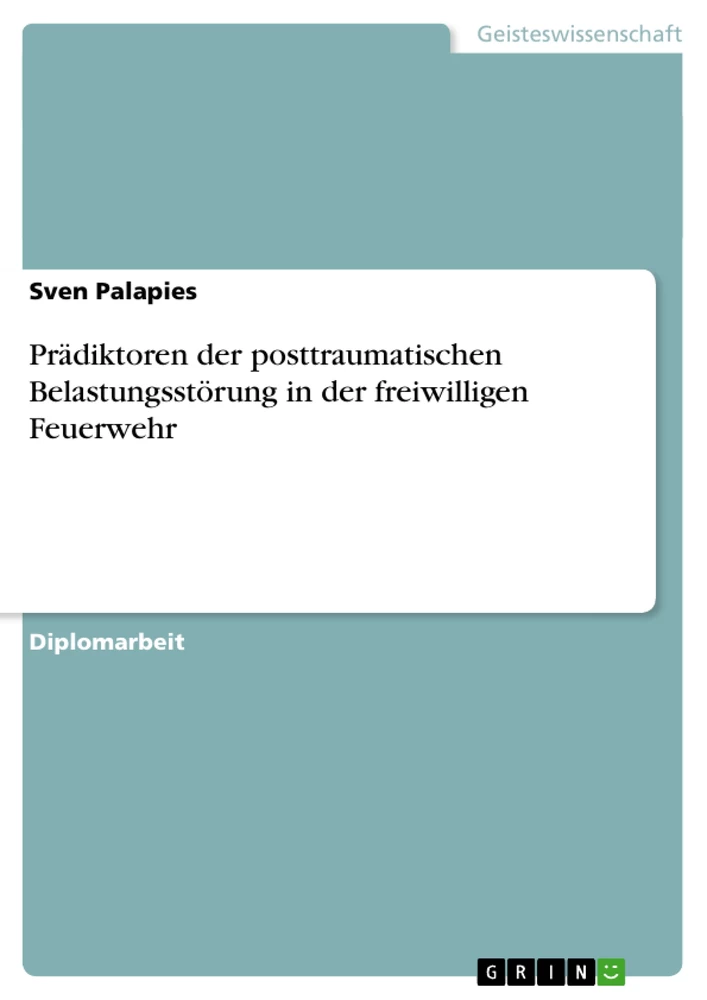Psychische Belastungen in Folge traumatischer Ereignisse sind, im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, erst seit relativ kurzer Zeit Gegenstand klinisch-psychologischer Forschung. In Anbetracht der Tatsache, dass schon seit Jahrhunderten in der Literatur und in Augenzeugenberichten über Leid und Schrecken, die durch Naturkatastrophen, Kriegserlebnisse und Folter bei Menschen verursacht wurden, berichtet wurde, erscheint die langjährige Ignorierung dieses Phänomens in der Klinischen Psychologie schwer nachvollziehbar. Erst die extrem belastenden Kriegserfahrungen und die dadurch ausgelösten starken psychischen Beeinträchtigungen vieler Vietnamveteranen führten erstmalig zur Aufnahme der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS bzw. posttraumatic stress disorder, PTSD) als eigenständige psychiatrische Diagnose in die Nomenklatur des DSM-III (APA, 1980), was mit einem wachsenden Interesse an diesem Forschungsgebiet koinzidierte.
Auch Feuerwehreinsätze bergen das Risiko, mit multiplen, potentiell traumatischen Stressoren, ob direkter oder indirekter Natur, konfrontiert zu werden und so die Entwicklung einer primären wie einer sekundären traumatischen Belastungsstörung auszulösen.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit besteht in der Überprüfung möglicher Risikofaktoren, die die Entwicklung einer PTBS begünstigen. In der Traumaforschung konnte durchweg gezeigt werden, das Trauma- und PTBS-Prävalenzen deutlich auseinanderklaffen. Das bedeutet, dass nicht jede Person, der ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, notwendigerweise auch an einer PTBS erkranken muss. Es herrscht vielmehr Konsens darüber, dass neben Traumamerkmalen substantielle Unterschiede in den Betroffenen selbst oder deren Umwelt vorliegen, die unabhängig von der Art und der Intensität der Traumatisierung zu einer erhöhten Vulnerabilität führen. Die Überprüfung solcher Prädiktoren, deren pathogene Relevanz in anderen Risikopopulationen bestätigt werden konnte und in einigen ätiologischen Modellen Berücksichtigung finden, sowie deren Zusammenwirken steht dabei im Fokus der vorliegenden Studie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Situation der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Stand 31.12.2002)
- 3. Theorie
- 3.1. Die Posttraumatische Belastungsstörung aus historischer Sicht
- 3.2 Gegenwärtige Nosologie
- 3.2.1 Diagnosekriterien der PTBS
- 3.2.1.1 Das Ereigniskriterium
- 3.2.1.2 Die Hauptsymptomgruppen (B, C und D)
- 3.2.1.3 Das Zeitkriterium E
- 3.2.1.4 Das Kriterium F
- 3.2.2 Auswirkungen der Unterschiede zwischen DSM-IV und ICD-10 auf die erhobenen Prävalenzen
- 3.2.3 Subsyndromale PTBS
- 3.2.1 Diagnosekriterien der PTBS
- 3.3 Verlauf
- 3.4 Komorbidität
- 3.5 Epidemiologie
- 3.5.1 Prävalenz traumatischer Ereignisse und der PTBS in der Normalbevölkerung
- 3.5.2 Prävalenz der PTBS in Risikopopulationen
- 3.5.3 Prävalenz der PTBS bei der Berufsfeuerwehr
- 3.5.4 Prävalenz der PTBS bei der Freiwilligen Feuerwehr
- 3.6 Ätiologie
- 3.6.1 Lerntheoretische Ansätze
- 3.6.2 Das Modell der chronischen PTBS von Ehlers und Clark (1999)
- 3.6.3 Das biopsychosoziale Modell nach Barlow (1988)
- 3.6.4 Psychobiologische Ansätze
- 3.6.5 Die Dual Representation Theory
- 3.7 Prädiktoren der PTBS
- 3.7.1 Definition von Stress aus kognitiver Perspektive
- 3.7.2 Das Stressverarbeitungsmodell von Lazarus
- 3.7.3 Prädiktoren
- 3.7.3.1 Kontrollüberzeugungen
- 3.7.3.2 Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung
- 3.7.3.3 Soziale Unterstützung
- 3.7.3.4 Coping-Strategien
- 3.7.3.5 Coping als Mediatorvariable
- 3.7.3.6 Kritische Lebensereignisse und Alltagsbelastungen
- 3.7.3.7 Peritraumatische Dissoziationen
- 3.8 Zusammenfassung
- 4. Fragestellungen und Hypothesen
- 4.1 Epidemiologische Fragestellungen zur Traumaexposition und PTBS-Prävalenz
- 4.2 Fragestellungen und Hypothesen zu den einzelnen Prädiktoren
- 4.3 Fragestellungen zum Zusammenwirken der einzelnen Prädiktoren
- 5. Methoden
- 5.1 Durchführung
- 5.2 Beschreibung der Stichprobe
- 5.3 Untersuchungsverfahren
- 5.4 Statistische Verfahren
- 5.5 Datenanalyse
- 6. Ergebnisse
- 7. Diskussion
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht Prädiktoren der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die das Risiko für die Entwicklung einer PTBS nach belastenden Ereignissen beeinflussen. Die Arbeit verknüpft epidemiologische Daten mit der Untersuchung verschiedener psychologischer Variablen.
- Prävalenz von PTBS bei Freiwilligen Feuerwehren
- Einfluss von Stressbewältigungsstrategien auf die PTBS-Entwicklung
- Rolle sozialer Unterstützung im Kontext traumatischer Ereignisse
- Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und PTBS
- Analyse verschiedener psychologischer Modelle zur PTBS-Ätiologie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Freiwilligen Feuerwehren ein und begründet die Relevanz der Forschungsfrage. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die zentralen Forschungsfragen.
2. Die Situation der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Stand 31.12.2002): Dieses Kapitel beschreibt die strukturellen Gegebenheiten und die Arbeitsbedingungen der Freiwilligen Feuerwehr im untersuchten Landkreis. Es liefert wichtige Kontextinformationen für die Interpretation der späteren Ergebnisse und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Belastungen dieser Berufsgruppe.
3. Theorie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur PTBS. Es behandelt die historische Entwicklung des Konstrukts, die diagnostischen Kriterien, epidemiologische Daten, verschiedene Ätiologiemodelle und relevante Prädiktoren der PTBS. Es dient als theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung.
4. Fragestellungen und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert präzise Forschungsfragen und Hypothesen, die im Rahmen der empirischen Untersuchung überprüft werden sollen. Es operationalisiert die theoretischen Konzepte und spezifiziert die zu erwartenden Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen.
5. Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Studie. Es erläutert die Stichprobenbeschreibung, die eingesetzten Messinstrumente (Fragebögen, Skalen), sowie die verwendeten statistischen Verfahren zur Datenanalyse. Die Transparenz der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Bewertung der Ergebnisse.
6. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es berichtet über die erhobenen Daten zur Traumaexposition, PTBS-Prävalenz und den verschiedenen Prädiktoren. Die Ergebnisse werden übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt und liefern die Grundlage für die Diskussion im folgenden Kapitel.
7. Diskussion: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Studie im Kontext des bestehenden Forschungsstandes. Es diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis und zukünftige Forschung. Methodische Limitationen der Studie werden kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Freiwillige Feuerwehr, Prädiktoren, Traumaexposition, Stressbewältigung, Soziale Unterstützung, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit, Coping, Epidemiologie, Risikofaktoren, Schutzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Prädiktoren der Posttraumatischen Belastungsstörung bei Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Prädiktoren der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. Das Hauptziel ist die Identifizierung von Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung einer PTBS nach belastenden Ereignissen beeinflussen. Die Arbeit kombiniert epidemiologische Daten mit der Analyse verschiedener psychologischer Variablen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: die Prävalenz von PTBS bei Freiwilligen Feuerwehren, den Einfluss von Stressbewältigungsstrategien auf die PTBS-Entwicklung, die Rolle sozialer Unterstützung im Kontext traumatischer Ereignisse, den Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und PTBS sowie die Analyse verschiedener psychologischer Modelle zur PTBS-Ätiologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, die Situation der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Theorie (einschließlich historischer Entwicklung der PTBS, Diagnostik, Epidemiologie, Ätiologie und Prädiktoren), Fragestellungen und Hypothesen, Methoden (Stichprobe, Verfahren, statistische Analysen), Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung.
Was wird im Theoriekapitel behandelt?
Das Theoriekapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur PTBS. Es beinhaltet die historische Entwicklung des Konstrukts, die diagnostischen Kriterien (DSM-IV und ICD-10), epidemiologische Daten (Prävalenz in der Normalbevölkerung und Risikopopulationen, inklusive Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr), verschiedene Ätiologiemodelle (lerntheoretische Ansätze, Modelle von Ehlers & Clark, Barlow, psychobiologische Ansätze, Dual Representation Theory) und relevante Prädiktoren (Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung, Coping-Strategien, peritraumatische Dissoziationen).
Welche Methoden wurden angewendet?
Das Methodenkapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, inklusive Stichprobenbeschreibung, verwendete Messinstrumente (Fragebögen, Skalen) und die angewandten statistischen Verfahren zur Datenanalyse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Ergebniskapitel präsentiert die Daten zur Traumaexposition, PTBS-Prävalenz und den verschiedenen Prädiktoren. Die Ergebnisse werden übersichtlich dargestellt und bilden die Grundlage für die Diskussion.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Kontext des bestehenden Forschungsstandes, diskutiert die Implikationen für die Praxis und zukünftige Forschung und reflektiert methodische Limitationen der Studie kritisch.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Freiwillige Feuerwehr, Prädiktoren, Traumaexposition, Stressbewältigung, Soziale Unterstützung, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit, Coping, Epidemiologie, Risikofaktoren, Schutzfaktoren.
Wo finde ich den detaillierten Inhaltsverzeichnis?
Der detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und zeigt die Gliederung der Arbeit bis zu den Unterpunkten auf.
Für welche Zielgruppe ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit, Angehörige der Feuerwehr und alle, die sich für die Thematik der PTBS und deren Prädiktoren interessieren.
- Quote paper
- Sven Palapies (Author), 2004, Prädiktoren der posttraumatischen Belastungsstörung in der freiwilligen Feuerwehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93078