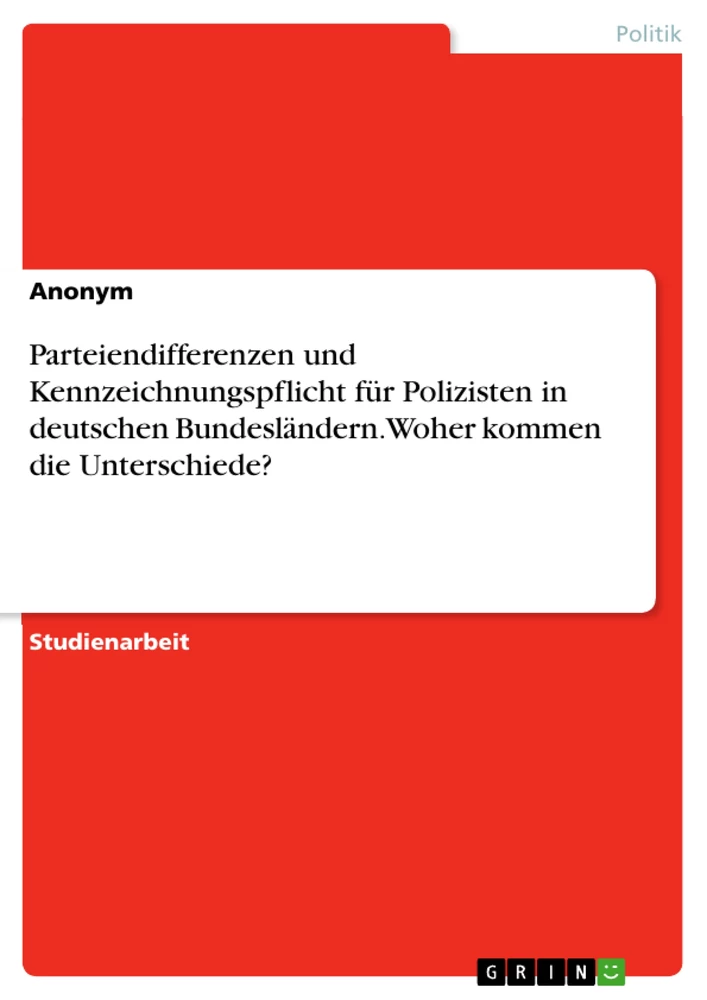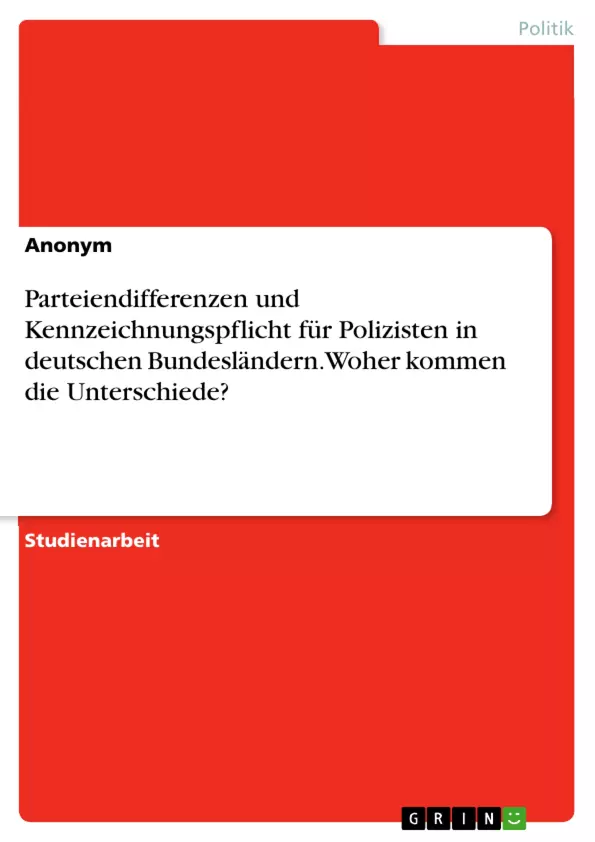Die folgende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich die Einführung oder Nicht-Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf Länderebene mit der sogenannten Parteiendifferenzhypothese erklären lässt. Im Rahmen dieser Forschungsfrage untersucht der Autor empirisch, ob "linke" und "rechte" Parteien in Fragen der Innen- und Sicherheitspolitik insbesondere bei der Einführung einer individuellen Kennzeichnungspflicht für Polizisten, einen Unterschied machen. Zu diesem Zweck untersucht er die Zusammensetzung der jeweiligen Landesregierungen zum Zeitpunkt der Einführung oder Nicht-Einführung eines solchen Gesetzes. Im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik gibt es bisher hauptsächlich Studien, die Unterschiede in der Höhe der Ausgaben für innere Sicherheit mit Parteiendifferenzen zu erklären versuchen. An Untersuchungen zu einzelnen "Policies" im Feld der Innenpolitik fehlt es hingegen.
Im Folgenden gilt es zunächst das genaue Konzept der Kennzeichnungspflicht und die Variationen in der Umsetzung in einzelnen Bundesländern zu klären. Im dritten Abschnitt wird die theoretische Grundlage der Argumentation, die Parteiendifferenzhypothese nach Hibbs, erläutert. Anschließend folgen die Thesen aus der von den Theorie abgeleiteten Erwartungen gegenüber dem Ergebnis der empirischen Untersuchung, sowie Daten und Forschungsdesign, bevor die Ergebnisse präsentiert und abschließend diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kennzeichnungspflicht in Deutschland
- Grundzüge der Parteiendifferenzhypothese und Bezug auf Sicherheitspolitik
- Parteienpositionen
- Hypothese/Erwartungen
- Fallauswahl
- Ergebnisse
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht, ob sich die Einführung oder Nicht-Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf Länderebene mit der Parteiendifferenzhypothese erklären lässt. Die Arbeit stellt die Frage, ob linke Parteien wie SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke die Einführung einer Kennzeichnungspflicht befürworten, während Parteien wie CDU, CSU und die AfD dieser kritisch gegenüberstehen.
- Kennzeichnungspflicht für Polizisten
- Parteiendifferenzhypothese
- Innen- und Sicherheitspolitik
- Landesregierungen
- Empirische Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Einführung oder Nicht-Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Deutschland. Die Forschungsfrage ist, ob sich die Einführung oder Nicht-Einführung der Kennzeichnungspflicht auf Länderebene mit der Parteiendifferenzhypothese erklären lässt.
- Kennzeichnungspflicht in Deutschland: Das Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Deutschland, beginnend mit der Einführung einer weißen Zahlenkombination auf dem Zylinder im Jahr 1848 in Berlin. Es beleuchtet die aktuelle Situation in den Bundesländern, wobei die Einführung einer gesetzlichen Regelung in Brandenburg im Jahr 2013 besonders hervorgehoben wird.
- Grundzüge der Parteiendifferenzhypothese und Bezug auf Sicherheitspolitik: Dieses Kapitel stellt die Theorie der Parteiendifferenzhypothese nach Hibbs (1977) vor und erläutert deren Anwendung auf das Politikfeld der inneren Sicherheit. Der Trade-Off zwischen Sicherheit und Bürgerrechten wird beleuchtet und es wird gezeigt, dass die Parteiendifferenzhypothese helfen kann, Unterschiede in der inneren Sicherheitspolitik verschiedener Parteien zu erklären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Kennzeichnungspflicht, Parteiendifferenzhypothese, Innen- und Sicherheitspolitik, Landesregierungen, empirische Untersuchung und die Anwendung der Theorie auf die Praxis der Einführung oder Nicht-Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Deutschland.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Parteiendifferenzen und Kennzeichnungspflicht für Polizisten in deutschen Bundesländern. Woher kommen die Unterschiede?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/924682