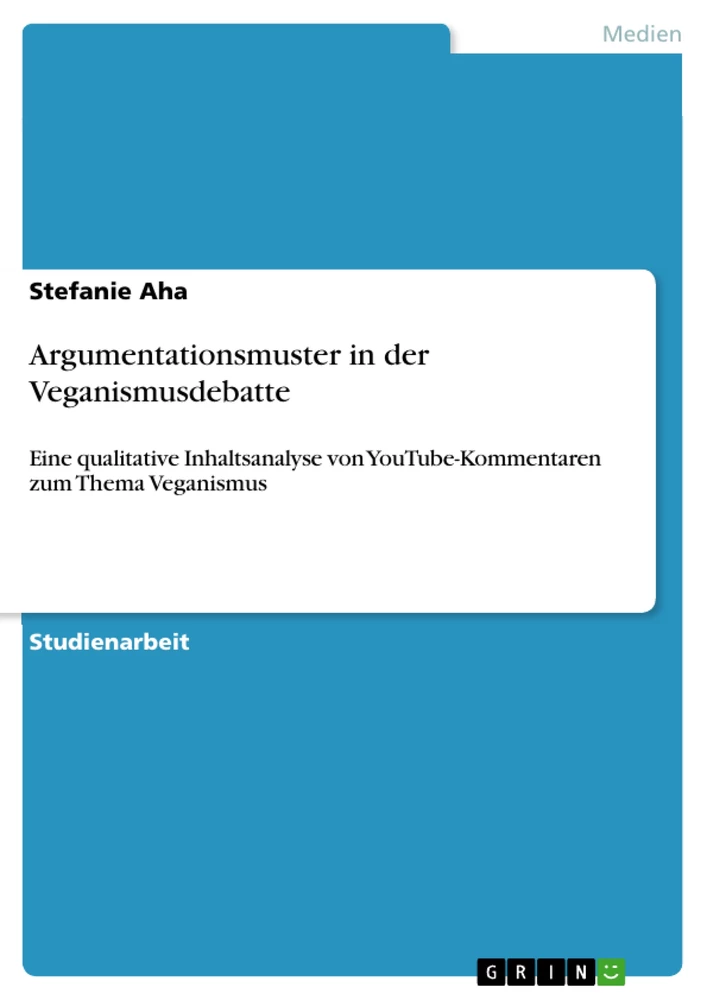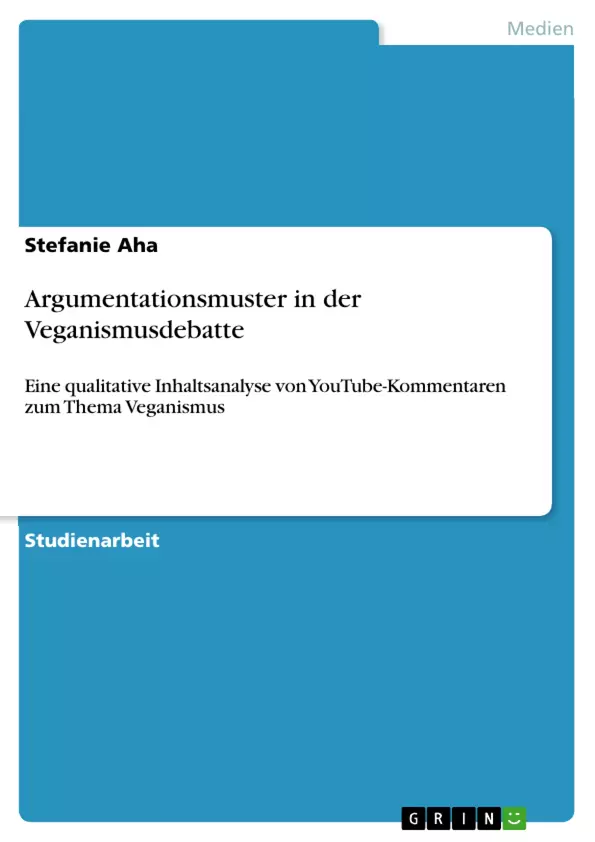Viele Menschen entscheiden sich bewusst vegan zu leben, andere wiederum möchten ihren gewohnten Lebensstil beibehalten. Doch wie werden diese Entscheidungen begründet? Lassen sich in der Diskussion dieses Themas wiederkehrende Muster in der Argumentation auf inhaltlicher Ebene feststellen? Welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede
und Auffälligkeiten lassen sich in der Argumentation für Veganismus und der Argumentation gegen Veganismus erkennen? Diese Forschungsfragen sollen im Rahmen dieser Arbeit mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht werden.
Als Untersuchungsgegenstand wurden Online-Kommentare ausgewählt, da diese diskursive Prozesse beobachtbar machen. Die Kommentatoren protokollieren beim Verfassen von Beiträgen ihren Standpunkt, wodurch eine greifbare Datengrundlage entsteht. Die Möglichkeit, die eigene Meinung hinter einem Nicknamen und nicht dem eigenen Klarnamen Preis zu geben, führt im Idealfall zu eindeutigen Positionierungen. Da YouTube nach Facebook die meist genutzte Social-Web-Plattform weltweit ist und auch als Suchmaschine genutzt wird, weisen die Kommentarspalten unter den Videos meist rege Beteiligung auf. Hinzu kommt, dass die Plattform in Deutschland vor allem von jüngeren Personen, aber auch von älteren Personen genutzt wird.
Bevor die qualitative Inhaltsanalyse dargestellt wird, soll zunächst eine theoretische Einordnung des Untersuchungsgegenstandes stattfinden. Dafür wird Veganismus für den Rahmen dieser Arbeit definiert. Im Anschluss wird YouTube als Social-Web-Plattform beschrieben und die Nutzergruppe dargestellt. Da Internetdaten untersucht werden, wird daraufhin ausführlich auf Eigenschaften und Besonderheiten von Online-Kommentaren eingegangen, um die Auswahl dieser Daten für die Analyse deutlich zu machen. Die untersuchten Kommentare werden der Kommentarspalte zweier YouTube-Videos entnommen, die nach den Kriterien Aktualität, Klickzahlen und Neutralität ausgewählt wurden. Nach einer Beschreibung der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse durch eine starke Orientierung am Ablaufmodell von Mayring/Brunner (2006), wird das Kategoriensystem vorgestellt, das induktiv am Untersuchungsmaterial entwickelt wurde und zur Beantwortung der Forschungsfragen dient.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung in das Thema
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund
- 2.1: Erster Unterpunkt
- 2.2: Zweiter Unterpunkt
- Kapitel 3: Empirische Studie
- 3.1: Methoden
- 3.2: Ergebnisse
- 3.3: Diskussion der Ergebnisse
- Kapitel 4: Ausblick und Schlussfolgerungen (ohne Zusammenfassung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, [hier die Zielsetzung des Werkes einfügen, z.B.: einen umfassenden Überblick über ein bestimmtes Thema zu geben und wichtige Forschungsfragen zu diskutieren.]. Die Arbeit stützt sich dabei auf [hier die Grundlage der Arbeit nennen, z.B.: bereits existierende Literatur, empirische Daten etc.].
- Einführung in das Thema
- Theoretischer Rahmen
- Präsentation empirischer Befunde
- Analyse der Ergebnisse
- Diskussion der Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung in das Thema: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, beschreibt die Relevanz und den Kontext, und formuliert die zentralen Forschungsfragen. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und skizziert die methodische Vorgehensweise. Die Einführung bietet dem Leser ein fundiertes Verständnis des Themas und bereitet ihn auf die folgenden Kapitel vor. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Begründung der Forschungslücke und der Bedeutung der Thematik für die jeweilige Fachdisziplin. Es werden wichtige Begriffe und Konzepte definiert und ihre Bedeutung für die weitere Argumentation verdeutlicht.
Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden relevante Theorien und Modelle vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung der relevanten Literatur und der Ableitung von Hypothesen oder Forschungsfragen. Die einzelnen Unterkapitel (falls vorhanden) bauen aufeinander auf und schaffen ein kohärentes theoretisches Gerüst für die empirische Untersuchung (falls vorhanden) im folgenden Kapitel. Die Auswahl der Theorien erfolgt nach klaren Kriterien, die in der Einführung erläutert wurden.
Kapitel 3: Empirische Studie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Thema. Es werden die angewandten Methoden detailliert beschrieben, die Datenerhebung und -aufbereitung erläutert, und die Ergebnisse in einer klaren und verständlichen Form präsentiert. Die Ergebnisse werden umfassend interpretiert und in Bezug zu dem theoretischen Hintergrund des zweiten Kapitels gesetzt. Die Darstellung der Ergebnisse ist so gestaltet, dass sie die zentralen Forschungsfragen beantworten und die Hypothesen (falls vorhanden) überprüfen können. Eine kritische Reflexion der methodischen Limitationen der Studie ist Bestandteil dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Hier die Schlüsselwörter einfügen: [z.B.: Thema X, Theorie Y, Methode Z, Empirische Forschung, Datenanalyse, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen].
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der wissenschaftlichen Arbeit einfügen]
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über [Thema der Arbeit]. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund, eine empirische Studie (falls zutreffend), eine Diskussion der Ergebnisse und abschließende Schlussfolgerungen. Der Fokus liegt auf [Hauptthemen der Arbeit]. Die Arbeit zielt darauf ab, [Zielsetzung der Arbeit] zu erreichen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich am Anfang der Arbeit und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf. Typischerweise beinhaltet sie eine Einführung, ein Kapitel zum theoretischen Hintergrund, ein Kapitel zur empirischen Studie (sofern vorhanden), und ein Kapitel mit Schlussfolgerungen. Die genaue Anzahl und die spezifischen Titel der Kapitel können variieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: [Auflistung der wichtigsten Themenschwerpunkte, z.B.: Einführung in das Thema, Theoretischer Rahmen, Präsentation empirischer Befunde, Analyse der Ergebnisse, Diskussion der Implikationen]. Diese Themen werden systematisch und strukturiert behandelt, wobei die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauen.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Beschreibung des jeweiligen Themenbereichs. Die Einführung stellt das Thema vor, definiert wichtige Begriffe und erläutert die Forschungsfragen. Das Kapitel zum theoretischen Hintergrund präsentiert relevante Theorien und Modelle. Das Kapitel zur empirischen Studie (falls vorhanden) beschreibt die Methodik, die Ergebnisse und deren Interpretation. Die Schlussfolgerungen fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutieren deren Implikationen.
Welche Methoden wurden verwendet (falls zutreffend)?
Falls die Arbeit eine empirische Studie beinhaltet, werden die verwendeten Methoden im entsprechenden Kapitel detailliert beschrieben. Dies umfasst die Datenerhebung, die Datenanalyse und die statistischen Verfahren. Die Wahl der Methoden wird begründet und ihre Limitationen kritisch diskutiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt (falls zutreffend)?
Die Ergebnisse der empirischen Studie (falls vorhanden) werden klar und prägnant präsentiert. Sie werden in Bezug zum theoretischen Hintergrund gesetzt und interpretiert. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in einer Form, die es erlaubt, die Forschungsfragen zu beantworten und die Hypothesen (falls vorhanden) zu überprüfen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutieren deren Implikationen. Sie beantworten die Forschungsfragen und liefern einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten. Die Schlussfolgerungen berücksichtigen die Limitationen der Studie und bieten eine fundierte Bewertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit kann mit folgenden Schlüsselwörtern beschrieben werden: [Hier die Schlüsselwörter einfügen, z.B.: Thema X, Theorie Y, Methode Z, Empirische Forschung, Datenanalyse, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen].
- Arbeit zitieren
- Stefanie Aha (Autor:in), 2019, Argumentationsmuster in der Veganismusdebatte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/922978