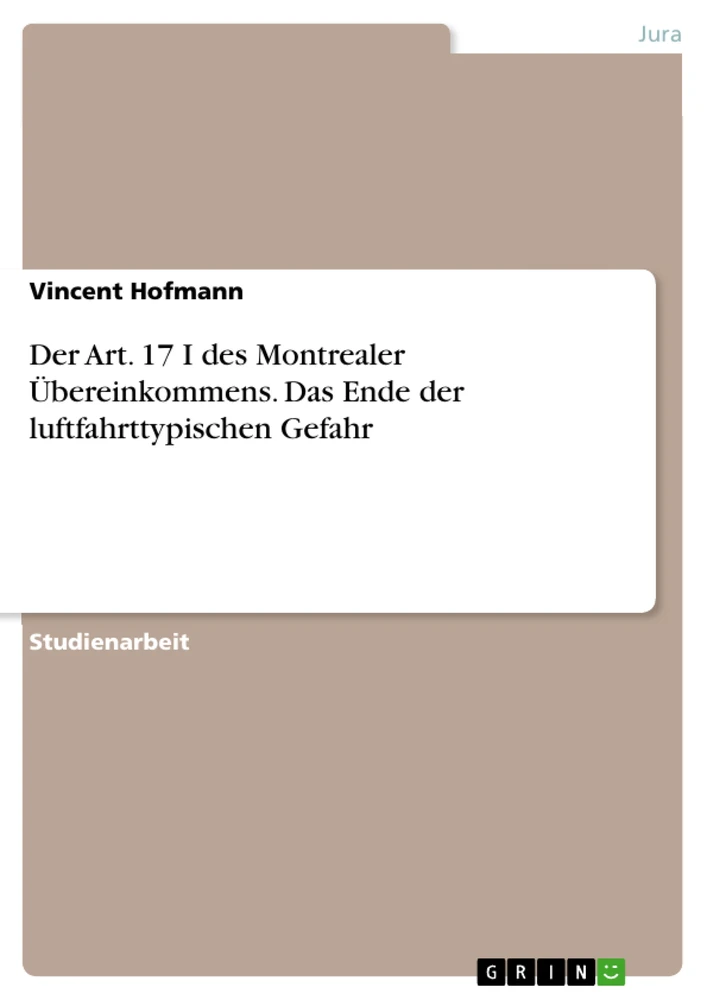Diese Arbeit behandelt den Aufstieg und das Ende des Erfordernisses der luftfahrttypischen Gefahr für die Haftung für Passagierschäden im Rahmen des Art. 17 I Montrealer Übereinkommen. Die Arbeit setzt sich intensiv mit den Gründen des für und wider dieses Erfordernisses auseinander und geht insbesondere auf die aktuelle Rechtsprechung in Europa sowie den USA ein. Auch wird versucht zu erklären, woher das Erfordernis der luftfahrttypischen Gefahr stammt und wagt einen Ausblick auf die zukünftige Anwendung dieses Erfordernisses.
Am 04.11.2003 trat das Übereinkommen vom 28. Mai 1999 zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Montrealer Übereinkommen) mit Hinterlegung der 30. Ratifizierungsurkunde unter anderem in Deutschland in Kraft. Mittlerweile gilt es in 136 Staaten und stellt ein umfassendes Regelwerk zur Haftung für den internationalen Lufttransport zwischen den Unterzeichnerstaaten dar. Das Montrealer Übereinkommen (MÜ) löste das bis dahin geltende und noch aus dem Jahr 1929 stammende Warschauer Abkommen (WA) ab. Die vielfachen Versuche, das Warschauer Abkommen zu modernisieren, hatten zu einem zersplitterten Regelwerk geführt, welches die Rechtsanwendung enorm erschwerte. Dieser Zustand sollte durch das MÜ beendet werden. Bereits zu Zeiten des WA war in der Fachwelt umstritten, ob der zum Tod oder einer Verletzung eines Passagiers führende Unfall aus einer luftfahrttypischen Gefahr resultieren muss.
Diese Arbeit versucht einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage zu leisten. Um dies beantworten zu können, soll zunächst das Haftungssystem des MÜ beschrieben werden. Anschließend folgt eine Darstellung des Streits über das Erfordernis der luftfahrttypischen Gefahr im Rahmen des Passagierschadens nach Art. 17 I MÜ. Die Stellungnahme, ob eine solche luftfahrttypische Gefahr erforderlich ist, soll auch mittels des Vergleichs mit anderen Haftungsvorschriften im internationalen Personentransport begründet werden und hängt maßgeblich davon ab, wann die Sperrwirkung des MÜ nationale Haftungsvorschriften ausschließt. Der letzte Teil dieser Arbeit behandelt die aktuelle Rechtsprechung in Europa und den USA zur Frage der luftfahrttypischen Gefahr und endet mit einem Ausblick, auf welche Haftungsmaßstäbe sich Airlines in Zukunft in diesen Jurisdiktionen einstellen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur der Haftung für Passagierschäden im MÜ
- Anwendungsbereich
- Das Haftungssystem des MÜ für Passagierschäden
- Luftfahrttypische Gefahr
- Die Begründung der luftfahrttypischen Gefahr
- Wortlaut und Systematik
- Historische Argumente
- Sinn und Zweck I
- Exklusivität des MÜ
- Sinn und Zweck II
- Alternative Vorschläge
- Ergebnis
- Vergleich mit anderen Haftungen
- Die Luftfahrttypik in der Praxis
- BGH NJW 2018, 861
- EuGH C-532/18
- US Entscheidungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Haftung von Luftfahrtunternehmen für Schäden an Passagieren im internationalen Luftverkehr. Der Fokus liegt dabei auf dem Streit um das Erfordernis der „luftfahrttypischen Gefahr" im Rahmen des Montrealer Übereinkommens (MÜ).
- Das Haftungssystem des Montrealer Übereinkommens (MÜ) für Passagierschäden
- Die Frage der „luftfahrttypischen Gefahr" im Rahmen des Passagierschadens nach Art. 17 I MÜ
- Der Vergleich des MÜ mit anderen Haftungsvorschriften im internationalen Personentransport
- Die Rechtsprechung in Europa und den USA zur „luftfahrttypischen Gefahr"
- Der Ausblick auf zukünftige Haftungsmaßstäbe für Airlines in diesen Jurisdiktionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt das Montrealer Übereinkommen (MÜ) als zentrales Regelwerk für die Haftung im internationalen Luftverkehr vor. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und die Bedeutung des MÜ im Kontext des Warschauer Abkommens (WA).
- Das zweite Kapitel behandelt die Struktur der Haftung für Passagierschäden im MÜ. Es werden der Anwendungsbereich des Übereinkommens und das Haftungssystem für Passagierschäden erläutert.
- Das dritte Kapitel widmet sich der „luftfahrttypischen Gefahr". Es wird die Bedeutung des Begriffs im Kontext des Passagierschadens und der Haftung nach Art. 17 I MÜ dargestellt.
- Das vierte Kapitel untersucht die Begründung der „luftfahrttypischen Gefahr" unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Wortlaut und Systematik des MÜ, historische Argumente, Sinn und Zweck des Übereinkommens sowie alternative Vorschläge.
- Das fünfte Kapitel vergleicht das MÜ mit anderen Haftungsvorschriften im internationalen Personentransport und analysiert, wann die Sperrwirkung des MÜ nationale Haftungsvorschriften ausschließt.
- Das sechste Kapitel beleuchtet die aktuelle Rechtsprechung in Europa und den USA zur Frage der „luftfahrttypischen Gefahr". Es analysiert wichtige Gerichtsentscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH), des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und der US-amerikanischen Gerichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet wichtige Themen wie die Haftung von Luftfahrtunternehmen im internationalen Luftverkehr, das Montrealer Übereinkommen (MÜ), das Warschauer Abkommen (WA), die „luftfahrttypische Gefahr", die Sperrwirkung des MÜ, die Rechtsprechung zu Passagierschäden und den Vergleich mit anderen Haftungsvorschriften im Personentransport.
- Quote paper
- Vincent Hofmann (Author), 2020, Der Art. 17 I des Montrealer Übereinkommens. Das Ende der luftfahrttypischen Gefahr, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/915493