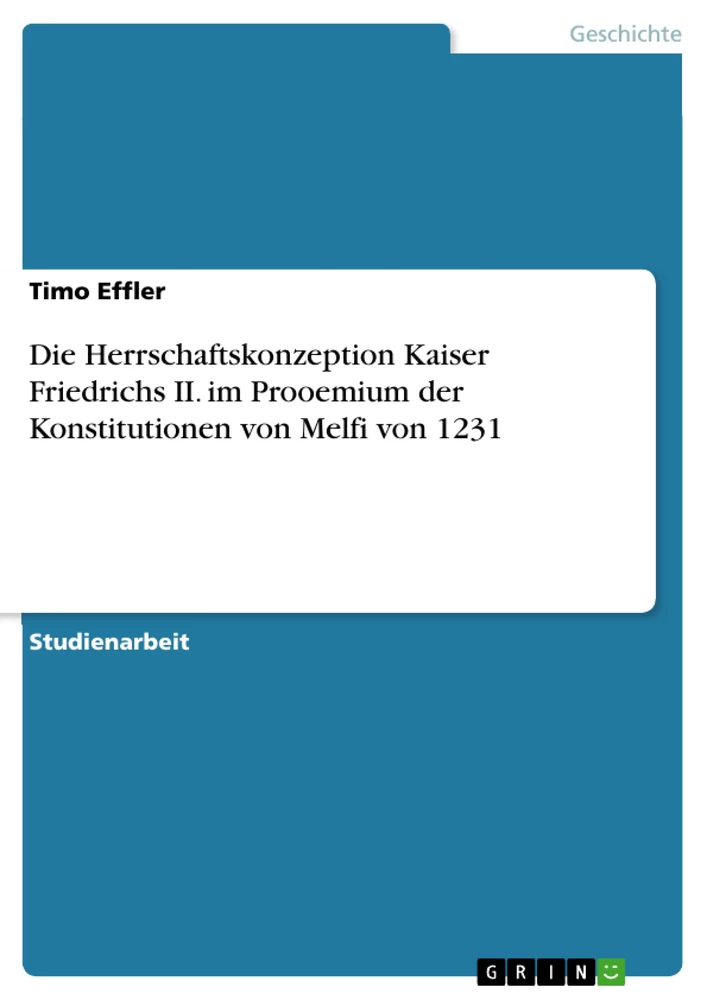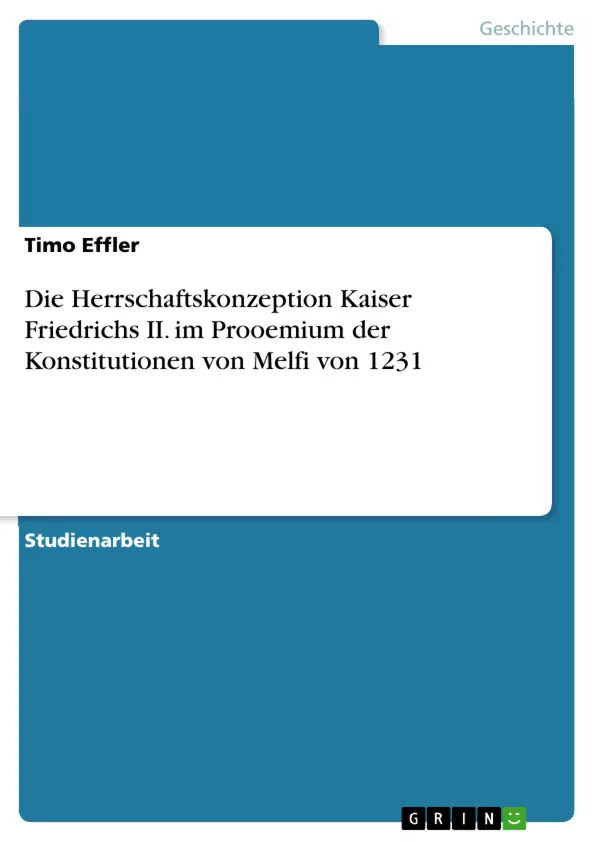Nach Jahren der Abwesenheit Friedrichs, der 1212 seine Heimat Süditalien verlassen hatte, um sich auf deutschem Boden in Aachen (1215) zum König krönen zu lassen, und der sich aufgrund seiner Exkommunikation und des Kreuzzuges in den 1220ern auch nur sporadisch in Süditalien aufhalten konnte, herrschte im Königreich Sizilien faktisch Anarchie. Der lokale Adel hatte sich in Abwesenheit des Herrschers ohne Rücksicht auf Besitz- und Rechtsansprüche u.a. auch des Kronlandes bemächtigt und dieses Vorgehen durch die Berufung auf fragwürdige Gesetze legitimieren lassen. Zudem war das Königreich Sizilien ohnehin als heterogener Schmelztiegel verschiedener Kulturen und somit auch Rechtstraditionen (römisch-langobardisch, normannisch-fränkisch, byzantinisch, arabisch, jüdisch, kanonisch) nur schwer verwaltbar.
Es war also vonnöten allgemeines und für alle gleichermaßen gültiges Recht zu setzen, um die Ordnung im Königreich Sizilien wiederherzustellen und seine eigene Herrschaft auf ein festes Fundament zu stellen. Festzuhalten bleibt, dass man im 13. Jahrhundert, in dem die Kanzleien ihre Hochphase hatten, generell zur schriftlichen Fixierung neigte. In dieses Zeitalter fällt vielleicht die Geburtsstunde der Bürokratie. Mit Sicherheit lässt sich jedoch sagen, dass bezüglich der Rechtstradition ein Wandel zu konstatieren ist. Die Rechtsvereinheitlichung hatte nun Priorität vor dem bisher gültigen Personalitätsprinzip (jeder wurde in Rechtsfragen nach den Grundsätzen seines Stammes beurteilt). Dass jeder, der in einem gewissen Territorium lebt, nach den Gesetzen dieses Landes beurteilt wird (Territorialitätsprinzip), ist als Ergebnis dieser Entwicklung zu sehen.
Ein solches Gesetzeswerk, das „Kernstück seiner Reformen“ , ist in seiner Bedeutung nur zu verstehen, wenn man sich bewusst ist, dass es die Folge einer veränderten Weltsicht ist. Glücklicherweise lässt sich das neue, besser: das erstmals in dieser Deutlichkeit formulierte, politische Programm Friedrichs, das mit den Konstitutionen einhergeht, aus deren Vorwort, dem Proömium, herauslesen.
Demnach ist es Ziel dieser Arbeit, anhand des Proömiums der Konstitutionen von Melfi wichtige Grundzüge der Auffassung von Herrschaft, wie sie von Kaiser Friedrich II. propagiert wurde, abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Das Prooemium der Konstitutionen von Melfi
- Lateinischer Text
- Eigene Übersetzung
- Darstellung
- Einleitung
- Intitulatio
- Die Schöpfungsgeschichte
- Der Sündenfall und die Notwendigkeit von Herrschaft
- Die Aufgaben des Herrschers und seine Beziehung zu Gott
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Prooemium der Konstitutionen von Melfi aus dem Jahr 1231 und untersucht die darin dargestellte Herrschaftskonzeption Kaiser Friedrichs II. Die Arbeit beleuchtet die theologischen und philosophischen Grundlagen der Kaiseridee, die Friedrich II. in seinem Prooemium zum Ausdruck bringt.
- Die Rolle der göttlichen Voraussicht in der Schöpfung
- Die Bedeutung der menschlichen Natur und die Folgen des Sündenfalls
- Die Aufgaben und Pflichten des Herrschers in Bezug auf die Kirche und das Volk
- Die Rechtfertigung der Herrschaft durch göttliches Mandat
- Die Bedeutung des Rechts als Grundlage der Herrschaftsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem lateinischen Text des Prooemiums und bietet eine eigene Übersetzung desselben. Das zweite Kapitel analysiert den Text in sechs Abschnitten: Einleitung, Intitulatio, Schöpfungsgeschichte, Sündenfall, Aufgaben des Herrschers, und Fazit. In der Einleitung wird der Kontext des Prooemiums und dessen Bedeutung innerhalb der Konstitutionen von Melfi dargestellt. Die Intitulatio präsentiert Friedrich II. als rechtmäßigen und legitimen Herrscher. Die Schöpfungsgeschichte beleuchtet die göttliche Ordnung und die Stellung des Menschen in der Welt. Der Abschnitt über den Sündenfall und die Notwendigkeit von Herrschaft untersucht die Folgen des menschlichen Fehlers und die Notwendigkeit einer gerechten Herrschaftsordnung. Die Aufgaben des Herrschers fokussieren sich auf die Beziehungen zwischen dem Kaiser, der Kirche und dem Volk. Der abschließende Teil zieht ein Fazit der Argumentation des Prooemiums und hebt die Bedeutung der in diesem Text dargestellten Herrschaftskonzeption hervor.
Schlüsselwörter
Kaiser Friedrich II., Konstitutionen von Melfi, Prooemium, Herrschaftskonzeption, göttliche Voraussicht, Schöpfungsgeschichte, Sündenfall, Rechtfertigung der Herrschaft, Aufgaben des Herrschers, Kirche, Volk, Rechtsordnung.
- Quote paper
- Timo Effler (Author), 2007, Die Herrschaftskonzeption Kaiser Friedrichs II. im Prooemium der Konstitutionen von Melfi von 1231, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/91070