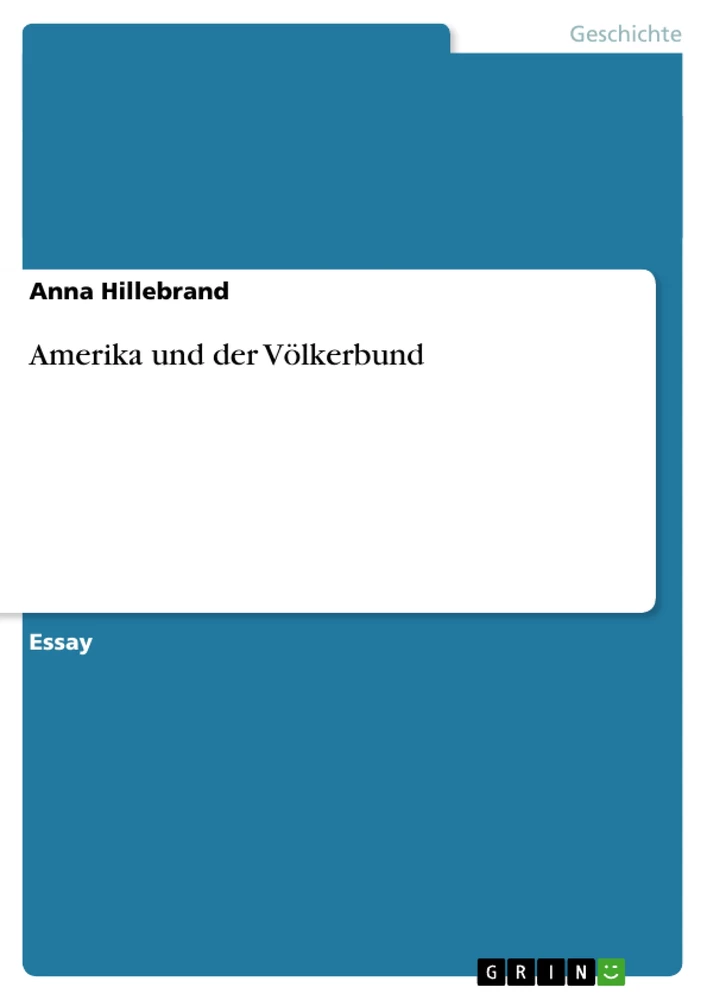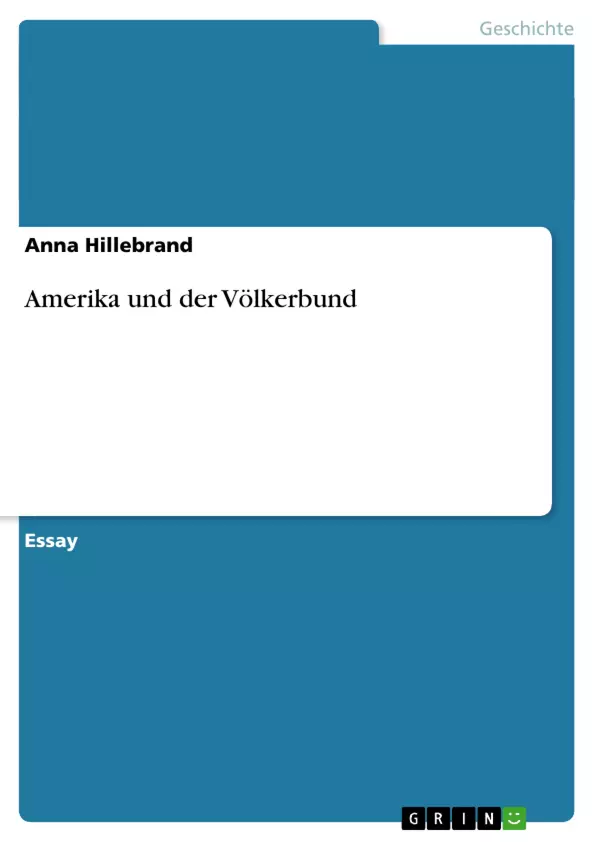Als die Amerikaner am 6. April 1917 in den ersten Weltkrieg eintraten, betonten sie bereits, dass es
ihnen hauptsächlich darum ginge, den Frieden zu sichern. So bemühten sie sich auch nach Ende
des ersten Weltkriegs weiter um die internationale Friedenssicherung.
Zur konkreten Umsetzung äußerte sich der damalige amerikanische Präsident Woodrow Wilson auf
der Pariser Friedenskonferenz (18.01.1919-21.01.1919) mit seinem 14-Punkte Plan. In diesen
wurden nicht nur die Kriegsziele Amerikas deutlich, sondern auch eine Reihe von Bedingungen, die
die demokratische Friedenssicherung in Europa sichern sollten. Eine Bedingung war beispielsweise
das Ende der Geheimdiplomatie. Der 14. Punkt war jedoch einer der wichtigsten, er enthielt die
Forderung nach einer Gründung eines überstaatlichen Zusammenschlusses, eines Völkerbundes.
Dieser sollte künftig die Beziehungen zwischen den Völkern friedlich regeln, um gewaltvolle
Auseinandersetzungen zu vermeiden. Allerdings schien es dabei so, als ob sich die USA zunächst
keine Gedanken über mögliche negative Auswirkungen eines solchen Bundes machen würden.
Anders reagierten die Franzosen und Engländer, die frühzeitig Studien in Auftrag gaben, um
mögliche negative Auswirkungen des Völkerbundes aufzudecken. Zudem arbeiteten beide schon an
einem konkreten Satzungsentwurf. Als die Engländer dann im März 1918 ihre Studie, die von
Lord Phillimore geleitet wurde, beendeten und auch die Franzosen ihren Bericht, für den Léon
Bourgeois mitverantwortlich war, kurze Zeit später abgeschlossen, war Woodrow Wilson förmlich
dazu gezwungen sich intensiver mit seinem Gedanken des Völkerbundes und dessen konkreten
Aufbau zu machen. Folglich beauftragte er Colonel House, einen seiner Vertrauten, einen
Satzungsentwurf im Namen der Amerikaner anzufertigen. Letztendlich legten die USA zwei
Entwürfe vor, in denen nicht nur die politische Unabhängigkeit, sondern auch die territoriale
Integrität der einzelnen Mitgliedsstaaten gefordert wurde. Dieser Gedanke ist sicherlich als
Erweiterung der Monroe-Doktrin, die die bisherige Außenpolitik der USA gut widerspiegelt,
anzusehen. Die beiden amerikanischen Entwürfe befassten sich zudem noch mit der Frage der
Abrüstung. Ein Staat solle nur so viele Waffen, Truppen, etc. besitzen, wie für die Garantie der
inneren Sicherheit erforderlich seien. Seien nicht mehr Waffen erforderlich, so solle abgerüstet
werden.
Inhaltsverzeichnis
- Amerika und der Völkerbund
- These 1: Die USA in der Gründungs- und Aufbauphase des Völkerbundes
- These 2: Woodrow Wilsons Versuch, die amerikanische Außenpolitik zu revolutionieren
- These 3: Die USA und der Völkerbund: Eine eingeschränkte Zusammenarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht das Verhältnis der USA zum Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Dabei werden die Ziele und Ambitionen von Präsident Woodrow Wilson, die Rolle der USA bei der Gründung und im Aufbau des Völkerbundes sowie die Gründe für die Nicht-Mitgliedschaft der USA im Vordergrund stehen. Der Text befasst sich auch mit der Frage, ob und inwieweit die USA trotz ihrer Nicht-Mitgliedschaft mit dem Völkerbund zusammenarbeiteten.
- Die Rolle der USA bei der Gründung und dem Aufbau des Völkerbundes
- Die Ziele und Ambitionen von Präsident Woodrow Wilson in Bezug auf die amerikanische Außenpolitik
- Die Gründe für die Nicht-Mitgliedschaft der USA im Völkerbund
- Die Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Völkerbund trotz der Nicht-Mitgliedschaft
- Die Auswirkungen des Völkerbundes auf die amerikanische Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die aktive Rolle der USA in der Gründungs- und Aufbauphase des Völkerbundes. Woodrow Wilsons 14-Punkte-Plan wird vorgestellt, der neben Kriegszielen auch die Forderung nach einem überstaatlichen Zusammenschluss, einem Völkerbund, beinhaltet. Es wird aufgezeigt, wie Wilson versucht hat, Einfluss auf die Gestaltung des Völkerbundes zu nehmen und seine Idee zu verwirklichen.
Das zweite Kapitel untersucht die Gründe, warum die USA trotz Wilsons Bemühungen nie Mitglied des Völkerbundes wurden. Es wird argumentiert, dass Wilsons Versuch, die amerikanische Außenpolitik zu revolutionieren, zu einem Konflikt mit der traditionellen Isolationismuspolitik der USA führte. Viele Amerikaner, insbesondere Senatoren, sahen in der Mitgliedschaft im Völkerbund eine Unterordnung unter europäische Interessen und eine Abkehr von der Monroe-Doktrin.
Das dritte Kapitel zeigt auf, dass die USA trotz ihrer Nicht-Mitgliedschaft eine gewisse Zusammenarbeit mit dem Völkerbund pflegten. Dies wird am Beispiel der Mandschurei-Krise illustriert, in der die USA sich mit dem Völkerbund gegen japanische Expansionspolitik im Fernen Osten zusammenschlossen. Es wird aber auch betont, dass diese Zusammenarbeit begrenzt und von Egoismus geprägt war, da die USA ihre Nicht-Mitgliedschaft stets betonten und sich nicht an alle Entscheidungen des Völkerbundes gebunden fühlten.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt die Themen Völkerbund, amerikanische Außenpolitik, Woodrow Wilson, Monroe-Doktrin, Isolationismus, Mandschurei-Krise, Hoover-Stimson-Doktrin, Briand-Kellogg-Pakt, Internationale Zusammenarbeit, Friedenssicherung, und internationale Beziehungen. Die Analyse des Verhältnisses der USA zum Völkerbund erfordert die Berücksichtigung historischer Zusammenhänge, politischer Doktrinen und internationaler Ereignisse.
- Arbeit zitieren
- Anna Hillebrand (Autor:in), 2007, Amerika und der Völkerbund, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90007