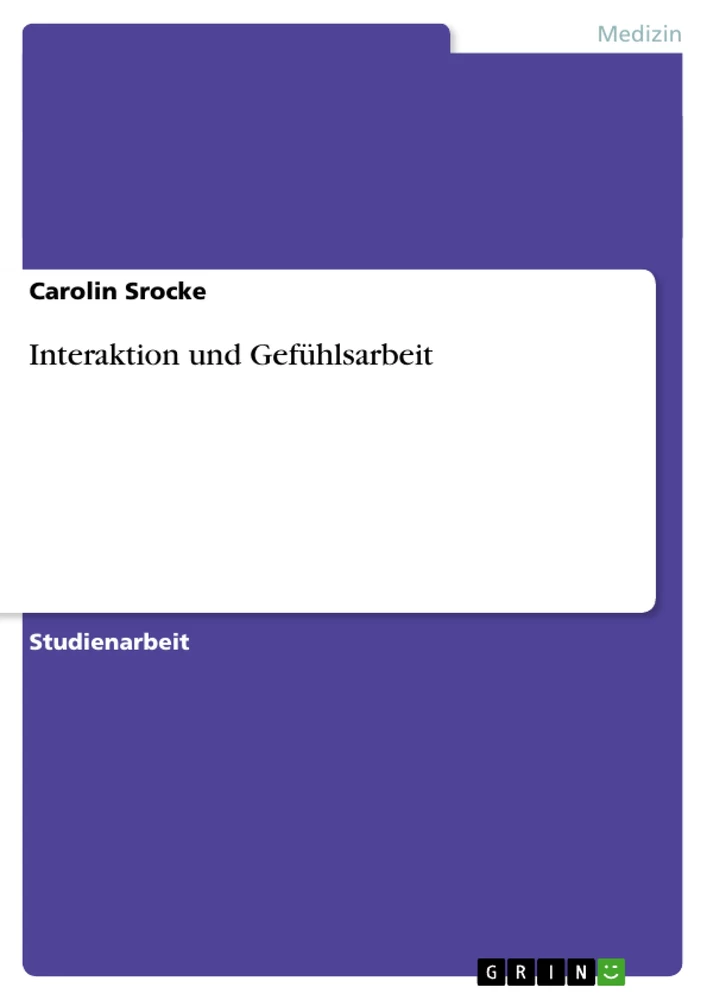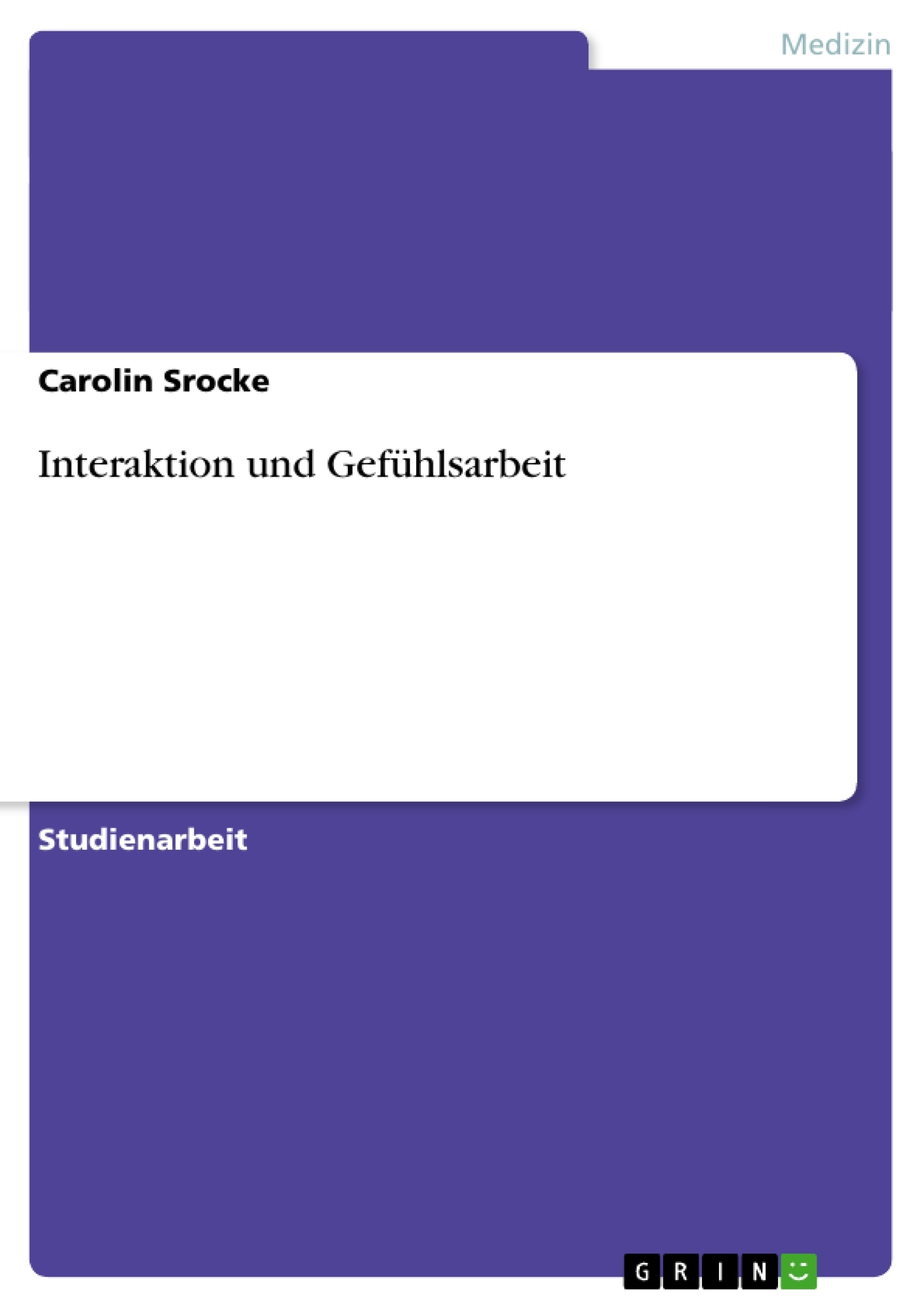Gefühlsarbeit in personenbezogenen Dienstleistungsberufen wird täglich und in fast allen Situationen geleistet, die im direkten Kontakt zum Patienten stehen. Oft werden solche Interaktionen zwischen Pflegepersonal und Patient überhaupt nicht als Gefühlsarbeit wahrgenommen oder als diese gedeutet; schließlich sieht das Berufsbild der Pflege es als selbstverständlich vor, in jeder Situation emotional richtig zu handeln und auch bei größten Belastungen ( ob durch betriebswirtschaftliche oder andere Faktoren beeinflusst) mit einem freundlichen geduldigen Wesen auf Patienten einzugehen.
Der Begriff Gefühlsarbeit wird als „allgemeingültige deutsche Übersetzung aus meist amerikanischen Veröffentlichungen und Untersuchungen“ verwendet, meint jedoch im Ursprung verschiedenste inhaltliche Themen und Bedeutungen. Das heißt, es gibt keine einheitliche Definition für Gefühlsarbeit. Strauss, Anselm et al. deuten Gefühlsarbeit als „die Arbeit, die Angehörige personenbezogener Dienstleistungsberufe im Blick auf die Gefühle anderer erbringen. Dazu gehören z. B. Vertrauensarbeit, Fassungsarbeit und Identitätsarbeit“ . Laut Dunkel meint Gefühlsarbeit den „beruflich- fachlichen Umgang mit Gefühlen“ Andere Begriffe, die die Bedeutung der Gefühlsarbeit überschneiden sind z. B. Emotionsarbeit (J. Gerhard 1988) und Gefühlsregulierung (B. Badura 1990).
Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich schon oft im täglichen Praxisalltag in der Klinik Situationen erlebt habe, die mich belastet haben, und die mich auch nach Feierabend nicht losließen. Oft denke ich darüber nach, ob ich mich zu sehr in Patienten oder Angehörige einfühle und mich damit belaste, aber andererseits gehört auch diese Arbeit zu meinem Beruf. Um eventuell besser zu verstehen, wie ich mit meinen eigenen Gefühlen und auch der der Patienten umgehen kann, werde ich dieses Thema bearbeiten. Als Grundlage dazu habe ich mich auf die Arbeit „Die Last des Mitfühlens- Aspekte der Gefühlsregulierung in sozialen Berufen am Beispiel der Krankenpflege“ von Gabriele Overlander (Krankenschwester, Soziologin und Sozialpsychologin) bezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Belastungen in Pflegeberufen
- 3 Vorstellung der Forschungsmethode
- 4 Forschungsergebnisse
- 4.1 Leibliche Bedürfnisse
- 4.2 Hygiene
- 4.3 Gefühle des Ekels
- 4.4 Scham- und Peinlichkeitslasten
- 4.5 Lasten der Beherrschung der eigenen Gefühle
- 4.6 Entwicklung von Mitleid zu Empathie
- 4.7 Machtverhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal
- 5 Zusammenfassung
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gefühlsarbeit in Pflegeberufen und deren Auswirkungen auf das Pflegepersonal. Ziel ist es, die emotionalen Belastungen im Kontext der täglichen Praxis zu beleuchten und besser zu verstehen, wie mit den eigenen Gefühlen und denen der Patienten umgegangen werden kann. Die Arbeit stützt sich auf die Forschung von Gabriele Overlander.
- Emotionale Belastungen im Pflegeberuf
- Gefühlsarbeit und deren Definition
- Allgemeine Belastungsfaktoren in der Pflege (Arbeitszeiten, körperliche Belastung, Personalmangel)
- Entwicklung des Umgangs mit Gefühlen in der Pflege im Laufe der Zeit
- Das Machtverhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gefühlsarbeit in personenbezogenen Dienstleistungsberufen ein und erläutert die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs. Sie beschreibt die Motivation der Autorin, dieses Thema aufgrund persönlicher Erfahrungen im Klinikalltag zu bearbeiten, und benennt die Arbeit von Gabriele Overlander als Grundlage.
2 Allgemeine Belastungen in Pflegeberufen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Belastung" im arbeitsmedizinischen Kontext und differenziert zwischen direkt messbaren und psychosozialen Belastungsfaktoren. Es werden verschiedene Belastungsschwerpunkte in Pflegeberufen herausgearbeitet, wie z.B. Schichtarbeit mit ihren Auswirkungen auf den Tag-Nacht-Rhythmus und soziale Einschränkungen, körperliche Belastungen durch schwere Arbeit und gesundheitsgefährdende Stoffe, sowie der immense psychische Druck durch Personalmangel, Zeitdruck und den Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Patienten. Die asymmetrische Helferbeziehung und deren Auswirkungen auf das Pflegepersonal werden ebenfalls thematisiert.
3 Vorstellung der Forschungsmethode: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethode der Arbeit von Gabriele Overlander, die sich mit den emotionalen Lasten von Pflegepersonal auseinandersetzt. Es wird die qualitative Inhaltsanalyse von Krankenpflegelehrbüchern über einen Zeitraum von etwa einem Jahrhundert (1874-1987) vorgestellt, um die Entwicklung von Verhaltensanweisungen zur Gefühlsarbeit zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Verhaltensvorgaben, die eine starke Kontrolle der eigenen Gefühle und des eigenen Verhaltens erfordern. Die Ausgangsthese ist, dass berufliche Verhaltensmuster langfristig sozial geformt und erlernt sind.
Schlüsselwörter
Gefühlsarbeit, Pflegeberuf, emotionale Belastung, psychosoziale Belastung, Arbeitsbedingungen, Machtverhältnis, Empathie, Mitleid, qualitative Inhaltsanalyse, Krankenpflegelehrbücher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gefühlsarbeit in Pflegeberufen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gefühlsarbeit in Pflegeberufen und deren Auswirkungen auf das Pflegepersonal. Sie beleuchtet die emotionalen Belastungen im Kontext der täglichen Praxis und analysiert den Umgang mit eigenen und den Gefühlen der Patienten. Die Arbeit basiert auf der Forschung von Gabriele Overlander und untersucht die Entwicklung des Umgangs mit Gefühlen in der Pflege im Laufe der Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Emotionale Belastungen im Pflegeberuf, Gefühlsarbeit und deren Definition, allgemeine Belastungsfaktoren in der Pflege (Arbeitszeiten, körperliche Belastung, Personalmangel), Entwicklung des Umgangs mit Gefühlen in der Pflege, das Machtverhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal, leibliche Bedürfnisse, Hygiene, Ekel, Scham und Peinlichkeit, die Beherrschung der eigenen Gefühle und die Entwicklung von Mitleid zu Empathie.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die qualitative Inhaltsanalyse von Krankenpflegelehrbüchern aus einem Zeitraum von 1874 bis 1987. Diese Analyse untersucht die Entwicklung von Verhaltensanweisungen zur Gefühlsarbeit und den Fokus auf die Kontrolle der eigenen Gefühle und des Verhaltens im Laufe der Zeit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse von Krankenpflegelehrbüchern zeigen die Entwicklung des Umgangs mit Gefühlen in der Pflege auf. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der emotionalen Belastung, wie z.B. die leiblichen Bedürfnisse der Patienten, Hygieneaspekte, Ekel, Scham- und Peinlichkeitsgefühle, die Beherrschung der eigenen Gefühle und die Entwicklung von Mitleid zu Empathie. Das Machtverhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal wird ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Allgemeine Belastungen in Pflegeberufen, Vorstellung der Forschungsmethode, Forschungsergebnisse (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Aspekten der emotionalen Belastung), Zusammenfassung und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gefühlsarbeit, Pflegeberuf, emotionale Belastung, psychosoziale Belastung, Arbeitsbedingungen, Machtverhältnis, Empathie, Mitleid, qualitative Inhaltsanalyse, Krankenpflegelehrbücher.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die emotionalen Belastungen im Pflegeberuf zu beleuchten und ein besseres Verständnis für den Umgang mit eigenen und den Gefühlen der Patienten zu entwickeln.
Wo finde ich das vollständige Dokument?
Das vollständige Dokument ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses FAQ bietet nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen.
- Arbeit zitieren
- Carolin Srocke (Autor:in), 2007, Interaktion und Gefühlsarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/88201