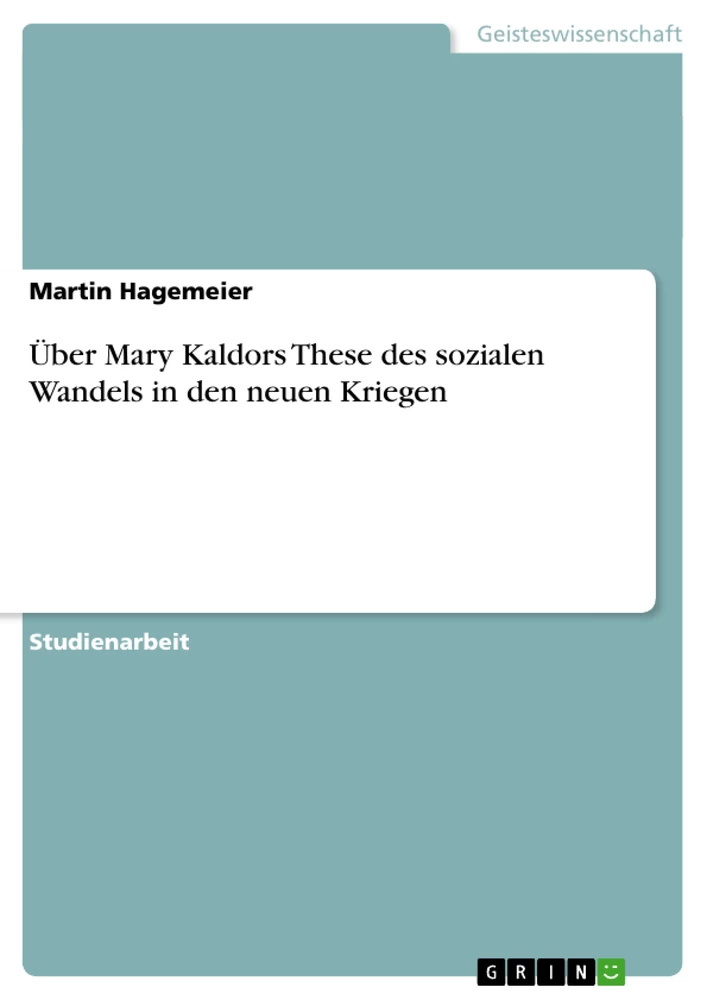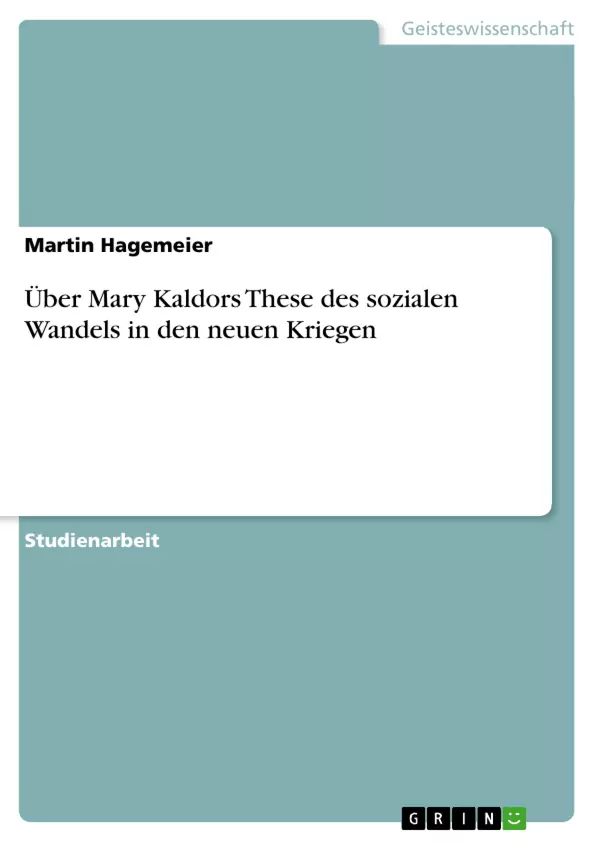In meiner Hausarbeit möchte ich das Phänomen der sogenannten neuen Kriege besprechen. In die Diskussion eingeführt wurde es unter anderem durch Veröffentlichungen von Mary Kaldor. Ihr Buch „Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung“ dient mir dabei als Ausgangspunkt.
Grob dargestellt kann man es als Gegenentwurf zum kulturellen Paradigma in der Betrachtung von Krieg und Gewalt beschreiben, als Unterfangen die strukturellen Bedingungen von Krieg und Gewalt zu analysieren. Ein wesentliches Merkmal der neuen Kriege ist die Nivellierung der Grenzen zwischen staatlicher und privater Gewalt, zwischen Krieg und organisierter Kriminalität. Mary Kaldors These, die hinter dieser nach analytischer Klärung verlangenden Entwicklung steht, ist ein grundlegender Wandel der sozialen Basis von organisierter Gewalt, den sie zurückgeführt auf ökonomische und politische Veränderungen seit Beginn der 80er Jahre.
Eine einfache Entgegnung gegen die neuen Kriege ist ein „so neu sind sie gar nicht“: Viele Muster und Verhaltensweisen sind seit Ende des 2. Weltkrieges virulent; warum also jetzt ein neues analytisches Muster erstellen, wo sich die Aufmerksamkeit, vielleicht erst durch das Ende der Blockkonfrontation, wieder auf die Konflikte in der sogenannten Dritten Welt richtet?
Mary Kaldor gegen solche Einwände verteidigend werde ich besprechen inwiefern die Theorie der neuen Kriege einen neuen Typus organisierter Gewalt beschreibt und abschließend auf die von Kaldor vorgeschlagenen Handlungsmöglichkeiten eingehen. Zur Unterstützung dieses Konzeptes möchte ich die von Georg Elwert entwickelte Theorie der Gewaltmärkte hinzunehmen, um die strukturellen Aspekte und ökonomischen Motivationen der neuen Kriege besser auszuleuchten.
Aus der Konfrontation mit den verschiedenartigen Konfliktgebieten im postsowjetischen Raum und aus dem Vergleich mit den scheinbar andersartigen Konflikten in Asien und Afrika zur gleichen Zeit, entwickelte die Sozialwissenschaftlerin Mary Kaldor ihre Theorie der neuen Kriege. Sie erkannte ein neues Verhaltensmuster, welches in diesen Konflikten hervortritt und welches sie als neuen Typ von organisierter Gewalt beschreibt. Trotz aller Unterschiede zwischen den Konflikten, deren ethnischen, kulturellen und historischen Hintergründen, konstatiert Mary Kaldor eine grundlegende Veränderung der sozialen Basis, in den Konflikt behafteten Gesellschaften, welcher sie sich mit ihrer Theorie annähert.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE BEDINGUNGEN DER NEUEN KRIEGE.
- DIE POLITIK DER IDENTITÄT......
- DIE ART Der KriegsfühRUNG.
- DIE GLOBALISIERTE KRIEGSWIRTSCHAFT.
- KRITIK AN DER THEORIE..
- GEWALTMÄRKTE, EIN ERGEBNIS SOZIALEN WANDELS ........
- SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der "neuen Kriege", wie es von Mary Kaldor beschrieben wird. Sie verwendet "Neue und alte Kriege" als Ausgangspunkt und analysiert die strukturellen Bedingungen von Krieg und Gewalt, insbesondere die Nivellierung der Grenzen zwischen staatlicher und privater Gewalt sowie zwischen Krieg und organisierter Kriminalität.
- Die "neuen Kriege" als ein Wandel in der sozialen Basis organisierter Gewalt.
- Kritik an der These der "neuen Kriege" und ihre Unterscheidung von "alten" Kriegen und "Low Intensity Conflict".
- Die Rolle der "Politik der Identität" und der globalisierten Kriegswirtschaft in der Entstehung neuer Kriege.
- Das Konzept der "Gewaltmärkte" als Ergänzung zur Theorie der "neuen Kriege".
- Die Bedeutung des Staatszerfalls und der Privatisierung von Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt die "neuen Kriege" als Gegenentwurf zum kulturellen Paradigma in der Betrachtung von Krieg und Gewalt vor. Sie beschreibt Mary Kaldors Theorie als eine Analyse der strukturellen Bedingungen von Krieg und Gewalt und thematisiert die Nivellierung der Grenzen zwischen staatlicher und privater Gewalt sowie zwischen Krieg und organisierter Kriminalität.
- Die Bedingungen der neuen Kriege: Mary Kaldor stellt die "neuen Kriege" als eine neue Form organisierter Gewalt vor, die sich von den traditionellen Kriegen und den Theorien zum "Low Intensity Conflict" unterscheidet. Kaldor analysiert die Veränderungen in der sozialen Basis von Konflikten und die Auswirkungen der Globalisierung auf die Entstehung neuer Kriege.
- Die Politik der Identität: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle der "Politik der Identität" in der Entstehung neuer Kriege. Kaldor argumentiert, dass die Politik der Identität, die auf scheinbar traditionellen Identitäten (Ethnos, Stamm, Religion) basiert, nicht die Hauptursache der neuen Kriege ist, sondern eher eine nachträgliche Legitimation des Handelns.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen "neue Kriege", "privatisierte Gewalt", "Politik der Identität", "globalisierte Kriegswirtschaft", "Gewaltmärkte", "Staatszerfall", "Kaldor", "Elias", "Elwert".
- Quote paper
- M. A. Martin Hagemeier (Author), 2003, Über Mary Kaldors These des sozialen Wandels in den neuen Kriegen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87819