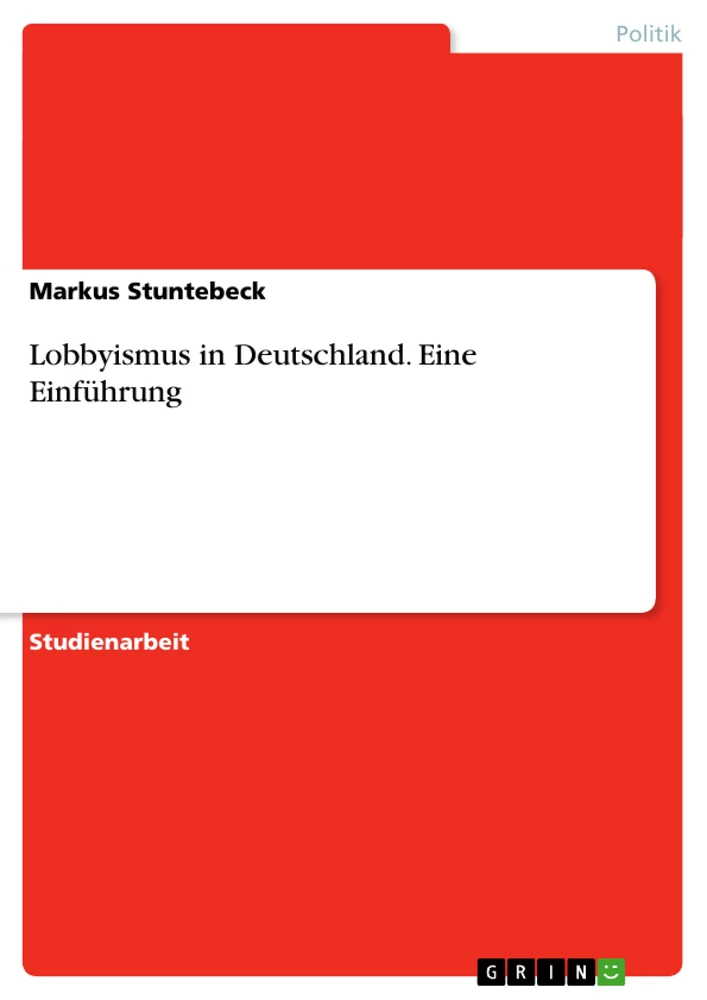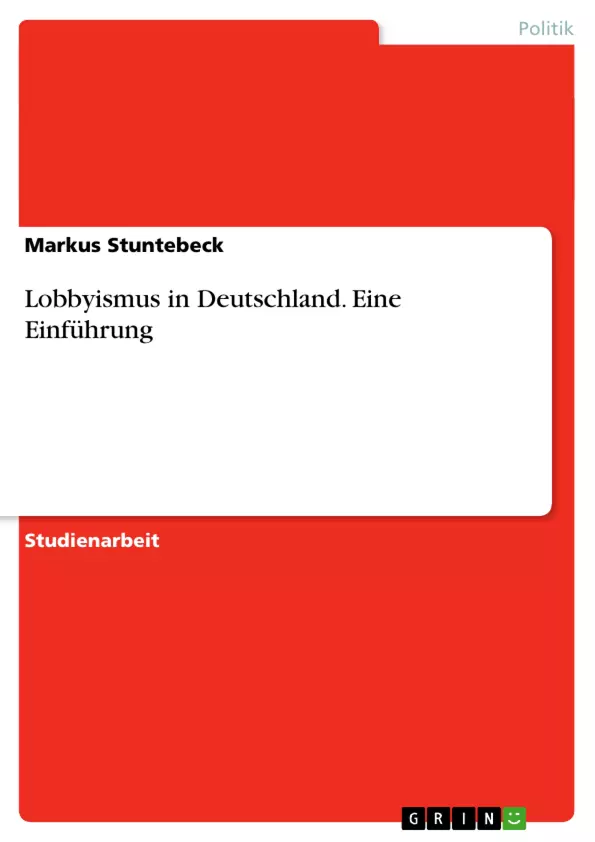Der Eindruck der Öffentlichkeit und das Bild in den Medien über den Lobbyismus sind mehr oder minder durchweg negativ. Schlagzeilen wie „Das gekaufte Parlament“, „Die Lobby regiert das Land“ oder auch bezogen auf die Lobbyisten „Die heimlichen Herrscher“ sind allerorts zu finden.
Gleichzeitig ist über die innere Struktur dieses Phänomens, dessen Anfänge durchaus lange zurückreichen, nicht viel bekannt. Vielfach wird diese Unkenntnis als Ursache für das schlechte Bild in der Öffentlichkeit ausgemacht. Hier ist jedoch zu klären, ob erstens dieses Bild tatsächlich einer Grundlage entbehrt und zweitens die Unkenntnis über dieses Feld nicht auch den Akteuren dienlich ist.
Gleichzeitig impliziert diese Stereotypisierung der Lobbyisten eine Homogenität, die es zu untersuchen gilt. Gibt es diese Homogenität überhaupt? Und falls das Feld doch differenzierter ist, wie ist es um den Einfluss und die Chancengleichheit der einzelnen Akteure bestellt?
Eine Annäherung an das Thema soll über die Definition des Lobbyismus stattfinden. In der Fachliteratur werden die Begriffe Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung durchaus kontrovers diskutiert. Es soll versucht werden, die Argumente der Diskussion wiederzugeben und als logische Schlussfolgerung die Begrifflichkeiten zu kategorisieren. Hierzu werden nicht nur die theoretischen Grundlagen beleuchtet, stets soll die Argumentation auch an realen Akteuren und Zusammenhängen geprüft und angewandt werden.
Den Abschluss bildet schließlich ein Blick auf die innere Struktur des Lobbying. Intention hierbei ist die Klärung der oben aufgeworfenen Fragen und Probleme. Darüber hinaus sollen die vorherigen theoretischen Erkenntnisse bezüglich der Begriffsdefinition untermauert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff Lobbyismus
- Erste Definition
- Interessenvertretung versus Lobbying
- Lobbyismus im politischen System
- Theoretische Grundlagen
- Das Verhältnis zur Demokratie
- Aktives Lobbying im Politikprozess
- Zwischenfazit
- Die innere Struktur des Lobbyings
- Akteure
- Adressaten
- Instrumente
- Methoden
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht das Phänomen des Lobbyismus in Deutschland. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis für die Struktur und Funktionsweise von Lobbying zu entwickeln und gängige Missverständnisse zu korrigieren. Dabei wird insbesondere der kontroverse Umgang mit den Begriffen Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung von Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung
- Der Einfluss von Lobbyismus auf das politische System Deutschlands
- Die Rolle verschiedener Akteure im Lobbying-Prozess
- Methoden und Strategien des Lobbyismus
- Das Verhältnis von Lobbyismus und Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet das negative öffentliche Bild des Lobbyismus, das oft auf Unkenntnis der inneren Strukturen des Phänomens zurückgeführt wird. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Stimmt das negative Bild der Öffentlichkeit, und dient die Unkenntnis über Lobbyismus den Akteuren? Die Arbeit untersucht die Heterogenität der Akteure und deren Einfluss und Chancengleichheit. Sie kündigt eine begriffliche Klärung von Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung an, die anhand realer Akteure und Zusammenhänge geprüft wird. Der Fokus liegt auf der Analyse der inneren Struktur des Lobbyings, um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten und die theoretischen Erkenntnisse zu untermauern.
Zum Begriff Lobbyismus: Dieses Kapitel nähert sich dem Begriff des Lobbyismus über verschiedene Definitionen an. Zunächst wird eine unpräzise und unkritische Beschreibung von Peter Köppl vorgestellt, die dann durch eine weitaus kritischeren Definition von Thomas Leif und Rudolf Speth ergänzt wird, welche Lobbying als Beeinflussung der Regierung durch Personen beschreibt, die selbst nicht am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Die darauf folgende Diskussion über die Abgrenzung zwischen Lobbying und Interessenvertretung zeigt unterschiedliche Positionen von Leif/Speth, Köppl und Wehrmann auf. Während erstere eine Differenzierung vornehmen, sieht Wehrmann eine solche als unnötig an, da punktuelles Eingreifen und langfristige Vertretung untrennbar miteinander verbunden seien. Das Kapitel legt den Grundstein für eine differenzierte Betrachtung der Thematik.
Schlüsselwörter
Lobbyismus, Lobbying, Interessenvertretung, politische Beeinflussung, Interessengruppen, Demokratie, Akteure, Methoden, Deutschland, öffentliches Bild, Theoretische Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Text "Lobbyismus in Deutschland"
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert das Phänomen des Lobbyismus in Deutschland. Er untersucht dessen Struktur und Funktionsweise und versucht, gängige Missverständnisse zu korrigieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abgrenzung zwischen den Begriffen Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung; der Einfluss von Lobbyismus auf das politische System Deutschlands; die Rolle verschiedener Akteure im Lobbying-Prozess; Methoden und Strategien des Lobbyismus; und das Verhältnis von Lobbyismus und Demokratie.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung: Stellt das negative öffentliche Bild des Lobbyismus dar und formuliert zentrale Forschungsfragen. Zum Begriff Lobbyismus: Vergleicht verschiedene Definitionen von Lobbyismus und diskutiert die Abgrenzung zu Interessenvertretung. Weitere Kapitel befassen sich mit Lobbyismus im politischen System, der inneren Struktur des Lobbyings (Akteure, Adressaten, Instrumente, Methoden) und einer abschließenden Betrachtung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Struktur und Funktionsweise von Lobbying zu entwickeln und gängige Missverständnisse zu korrigieren. Er beleuchtet den kontroversen Umgang mit den Begriffen Lobbyismus, Lobbying und Interessenvertretung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lobbyismus, Lobbying, Interessenvertretung, politische Beeinflussung, Interessengruppen, Demokratie, Akteure, Methoden, Deutschland, öffentliches Bild, Theoretische Grundlagen.
Wie wird der Begriff Lobbyismus im Text definiert und abgegrenzt?
Der Text präsentiert unterschiedliche Definitionen von Lobbyismus, beginnend mit einer unpräzisen Beschreibung und fortschreitend zu kritischeren Definitionen, die Lobbying als Beeinflussung der Regierung durch außenstehende Personen beschreiben. Die Abgrenzung zu Interessenvertretung wird kontrovers diskutiert, wobei verschiedene Positionen unterschiedlicher Autoren präsentiert werden.
Welche Rolle spielt die Demokratie im Kontext des Lobbyismus?
Der Text untersucht das Verhältnis von Lobbyismus und Demokratie als einen zentralen Aspekt. Es wird beleuchtet, wie Lobbyismus das politische System beeinflusst und ob dies im Einklang mit demokratischen Prinzipien steht.
Wer sind die Akteure im Lobbying-Prozess?
Der Text beschreibt die verschiedenen Akteure des Lobbying-Prozesses, ohne diese explizit zu benennen. Die Analyse der Akteure ist ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung der inneren Struktur des Lobbyings.
Welche Methoden und Strategien des Lobbyismus werden behandelt?
Der Text erwähnt Methoden und Strategien des Lobbyismus, aber ohne diese im Detail aufzulisten. Die Analyse der Methoden ist Teil der Untersuchung der inneren Struktur des Lobbyings.
- Quote paper
- Markus Stuntebeck (Author), 2007, Lobbyismus in Deutschland. Eine Einführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87378