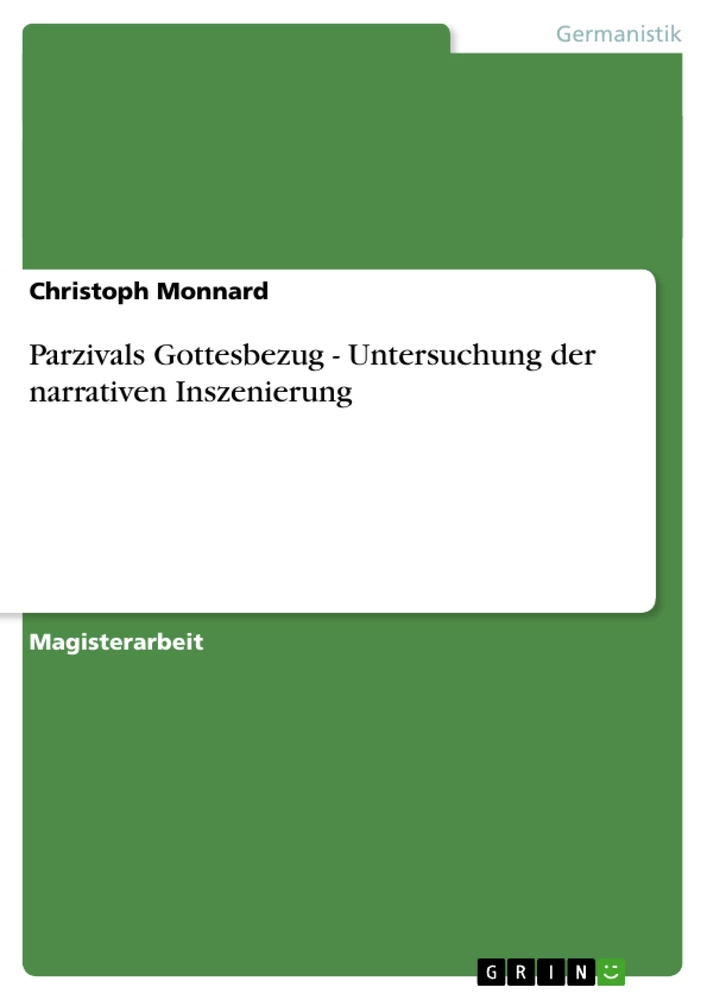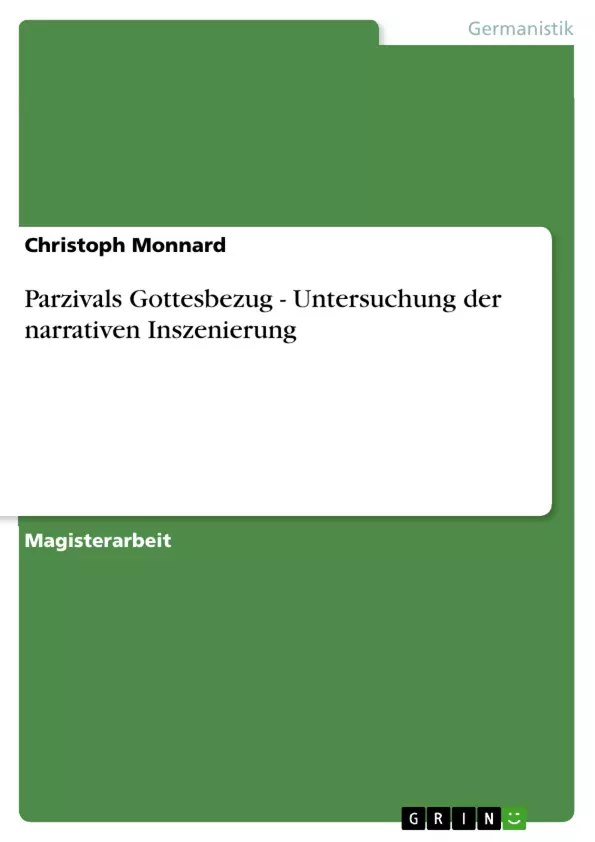Eine der wohl umstrittensten Fragen der Mediävistik formiert sich um den Parzival Wolframs von Eschenbach. Es handelt sich hierbei um den zweiten erfolgreichen Versuch der Erringung des so genannten Grals durch den Titelhelden Parzival. Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang, dass der Gral dem Berufenen nur eine Chance eingeräumt hatte, ihn zu erreichen und eine zweite ausdrücklich ausschloß. Das Erreichen des Grals und das damit verbundene Erlösen des noch amtierenden Gralskönigs, der an einer unheilbaren Verletzung leidet, werden von dem Gral selbst an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die zentrale Vorgabe ist die, wie der Hörer/ Leser nach der Hälfte der Erzählung erfährt, dass der Auserwählte bei seiner ersten Konfrontation mit dem Gral die Frage nach dem Leiden des noch amtierenden, aber an einer unheilbaren Verletzung erkrankten Gralskönigs stellen muss. Hinzu kommt, dass er diese Frage aus eigenem Antrieb stellen muss, ohne vorher zu wissen, dass genau dies seine Aufgabe ist. Ebenso erging von dem Gral das Verbot, dass der Auserwählte von niemandem vorher auf seine Aufgabe und die Form der Durchführung hingewiesen werden darf. Stellt er diese Frage nicht, so verwirkt er dadurch für immer sein Anrecht auf den Gral und der Gralskönig wird nicht von seinem Leiden erlöst. Da nun Wolframs Parzival bei seiner ersten Begegnung mit dem Gral diese Frage nicht stellt, erhält er den Gral nicht, erlöst auch den Gralskönig nicht von seinem Leid und wird darüber hinaus von der Gralsbotin Cundrîe verflucht. Entgegen der zuvor deutlich gemachten Regel, erhält Parzival, der mittlerweile Artusritter geworden ist, jedoch eine zweite Chance, die Frage zu stellen und den Gral zu erwerben. Zudem wird er zuvor noch über den Hintergrund der Frage und der Tatsache, dass er diese stellen muss, aufgeklärt, was neben dem generellen Widerspruch der zweiten Möglichkeit auch noch gegen die damit verbundenen Bedingungen bzw. Verbote verstößt. Es scheint demnach ein innerlitarischer Widerspruch innerhalb Wolframs Werk vorzuliegen.
Wolfram belässt es jedoch nicht bei der einfachen Gegenüberstellung von Gral und Berufenem, sondern verknüpft diese beiden Krisenherde mit einer weiteren, übergeordneten Instanz: und zwar dem christlichen Gott. Im Gesamtbild ergibt sich daraus, dass der zum Gral (...)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wolfram von Eschenbach
- 2.1 Der Dichter und sein Publikum
- 2.2 Wolframs Wirkungsästhetik
- 2.3 Die Religiosität Wolframs und das Religiöse in seinen Werken
- 3. Gottesbilder in der mittelalterlichen Dichtung
- 3.1 Gottesvorstellung und Gottesdienst im hohen Mittelalter
- 3.2 Gottes Gnade und das Gottesgnadentum
- 3.3 helfe und triuwe
- 4. Zwischenmenschliche Beziehungen in der mittelalterlichen Gesellschaft
- 4.1 Das Lehnswesen
- 4.2 Die Stellung der Kirche im hohen Mittelalter
- 5. Parzival: Artusritter oder Ausnahmeheld?
- 5.1 Parzivals art
- 5.2 Parzivals Wissen über Gott
- 5.2.1 Gotteslehre von Herzeloyde
- 5.2.2 Gotteslehre von Gurnemanz
- 5.2.3 Gotteslehre von Trevrizent
- 6. Parzivals Gottesbezug
- 6.1 Die Ritterbegegnung (Vers 120,11 – 124,24)
- 6.2 Verfluchung durch Sigune (Vers 251,29 - 255,30)
- 6.3 Verfluchung durch Cundrîe (Vers 312,2– 319,19)
- 6.4 Parzivals Aufbruch vom Artushof (Vers 329,14 – 333,30)
- 6.5 Parzival und der graue Ritter (Vers 446,1 – 452,9)
- 6.6 Einkehr bei Trevrizent (Vers 452,15 - 502,30)
- 6.7 Feirefizkampf (Vers 734,18 – 754,30)
- 6.8 Berufung Parzivals durch Cundrîe (Vers 778,13 – 786,12)
- 6.9 Anfortas Erlösung (Vers 787,1– 799,13)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die narrative Inszenierung des Gottesbezugs in Wolframs von Eschenbachs Parzival. Sie beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen Parzivals anfänglichem Scheitern und seinem späteren Erfolg beim Erreichen des Grals im Kontext der mittelalterlichen Gottesvorstellungen und gesellschaftlichen Strukturen. Die Arbeit analysiert die Rolle Gottes im Werk und seine Beziehung zu Parzivals Entwicklung als Ritter und Mensch.
- Parzivals Entwicklung und sein Verhältnis zu Gott
- Die Bedeutung des Grals als religiöses Symbol
- Die Darstellung von Gottesbildern im mittelalterlichen Kontext
- Der Einfluss mittelalterlicher gesellschaftlicher Strukturen auf die Handlung
- Interpretation des scheinbaren inneren Widerspruchs in Wolframs Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Problematik des Parzival ein: den scheinbaren Widerspruch zwischen Parzivals erster Begegnung mit dem Gral und seiner späteren Erlösung des Gralskönigs. Sie stellt die Frage nach der Rolle Gottes im Werk und deutet die unterschiedlichen Interpretationen des Parzival an, die von einer ritterlichen Heiligenvita bis hin zur Vermittlung einer wahren Gott-Mensch-Beziehung reichen. Die Einleitung legt den Fokus auf die theologischen Aspekte des Werkes und kündigt die anschließende Analyse an.
2. Wolfram von Eschenbach: Dieses Kapitel behandelt den Autor Wolfram von Eschenbach, sein Publikum und seine Wirkungsästhetik. Es analysiert die religiösen Elemente in seinen Werken und legt die Grundlage für das Verständnis seines Gottesbildes im Kontext des Parzival.
3. Gottesbilder in der mittelalterlichen Dichtung: Das Kapitel beschreibt die Gottesvorstellung und den Gottesdienst im hohen Mittelalter, die Bedeutung von Gottes Gnade und dem Gottesgnadentum sowie die Konzepte von "helfe und triuwe" im religiösen Kontext. Es liefert den historischen und theologischen Rahmen für die Interpretation des Gottesbezugs in Parzival.
4. Zwischenmenschliche Beziehungen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet das Lehnswesen und die Rolle der Kirche im hohen Mittelalter, um die sozialen und politischen Bedingungen zu verstehen, in denen Parzival agiert. Es stellt die gesellschaftlichen Normen dar, die Parzivals Handlungen beeinflussen.
5. Parzival: Artusritter oder Ausnahmeheld?: Dieses Kapitel analysiert Parzivals Entwicklung zum Artusritter und untersucht sein Wissen über Gott. Es wird die Bedeutung der Gotteslehren von Herzeloyde, Gurnemanz und Trevrizent für Parzivals religiöse Entwicklung erörtert, um sein Verständnis von Gott und dessen Rolle im Kontext seiner Reise darzustellen.
Schlüsselwörter
Parzival, Wolfram von Eschenbach, Gral, Gottesbezug, Mittelalter, Religiosität, Artusroman, Ritter, Heiliger, Gottesgnadentum, helfe und triuwe, theologische Interpretation, innerliterarischer Widerspruch.
Häufig gestellte Fragen zu "Wolframs von Eschenbachs Parzival: Eine Analyse des Gottesbezugs"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die narrative Inszenierung des Gottesbezugs in Wolframs von Eschenbachs Parzival. Sie analysiert den scheinbaren Widerspruch zwischen Parzivals anfänglichem Scheitern und seinem späteren Erfolg beim Erreichen des Grals im Kontext der mittelalterlichen Gottesvorstellungen und gesellschaftlichen Strukturen. Der Fokus liegt auf der Rolle Gottes im Werk und seiner Beziehung zu Parzivals Entwicklung als Ritter und Mensch.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Parzivals Entwicklung und sein Verhältnis zu Gott; die Bedeutung des Grals als religiöses Symbol; die Darstellung von Gottesbildern im mittelalterlichen Kontext; der Einfluss mittelalterlicher gesellschaftlicher Strukturen auf die Handlung; und die Interpretation des scheinbaren inneren Widerspruchs in Wolframs Werk. Zusätzlich werden Wolfram von Eschenbach selbst, seine Wirkungsästhetik und das Verständnis von Gott im hohen Mittelalter beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Problematik des scheinbaren Widerspruchs in Parzivals Gralserfahrung ein. Kapitel 2 (Wolfram von Eschenbach) behandelt den Autor, sein Publikum und seine religiösen Ansichten. Kapitel 3 (Gottesbilder im Mittelalter) beschreibt die mittelalterliche Gottesvorstellung und relevante Konzepte wie "helfe und triuwe". Kapitel 4 (Zwischenmenschliche Beziehungen) beleuchtet das Lehnswesen und die Rolle der Kirche im Mittelalter. Kapitel 5 (Parzival: Artusritter oder Ausnahmeheld?) analysiert Parzivals Entwicklung und sein Wissen über Gott, basierend auf den Gotteslehren verschiedener Figuren. Kapitel 6 (Parzivals Gottesbezug) analysiert konkrete Textstellen im Parzival, um Parzivals Gottesbezug zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parzival, Wolfram von Eschenbach, Gral, Gottesbezug, Mittelalter, Religiosität, Artusroman, Ritter, Heiliger, Gottesgnadentum, helfe und triuwe, theologische Interpretation, innerliterarischer Widerspruch.
Welche konkreten Textstellen aus Parzival werden analysiert?
Kapitel 6 analysiert verschiedene, explizit genannte Textstellen aus Parzival, darunter Parzivals Ritterbegegnungen, Verfluchungen durch Sigune und Cundrîe, seinen Aufbruch vom Artushof, seine Begegnung mit dem grauen Ritter, seinen Aufenthalt bei Trevrizent, den Feirefizkampf, Cundrîes Berufung Parzivals und Anfortas' Erlösung.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung ist die Untersuchung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Parzivals anfänglichem Gralversagen und seinem späteren Erfolg. Die Arbeit fragt nach der Rolle Gottes in diesem Prozess und nach der Bedeutung des Grals als religiöses Symbol im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft und Theologie.
- Quote paper
- Christoph Monnard (Author), 2007, Parzivals Gottesbezug - Untersuchung der narrativen Inszenierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87329