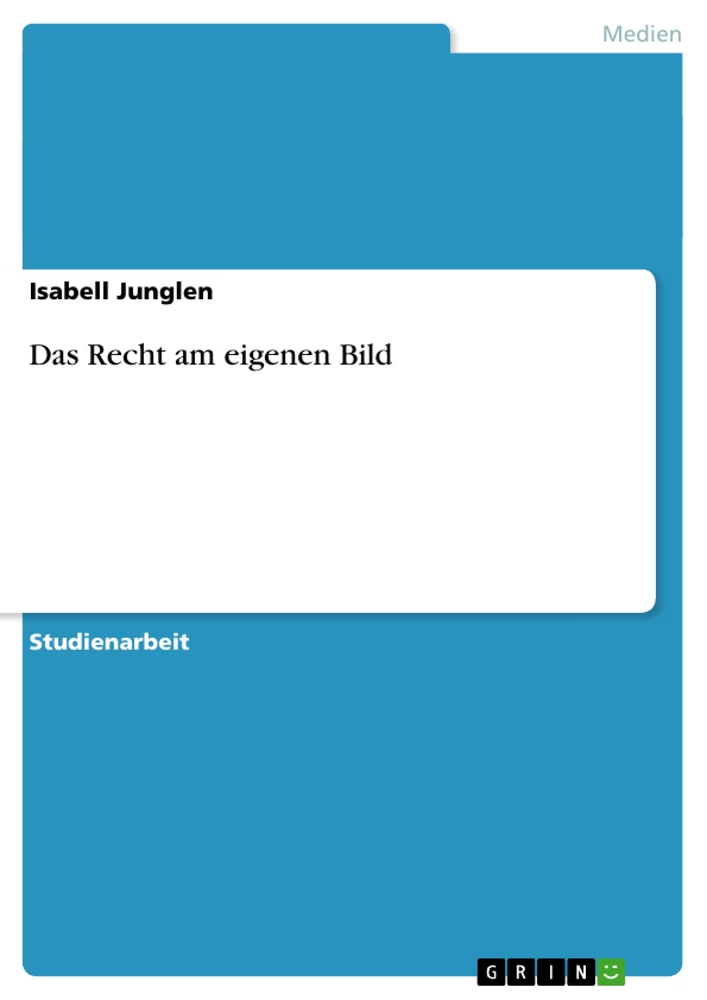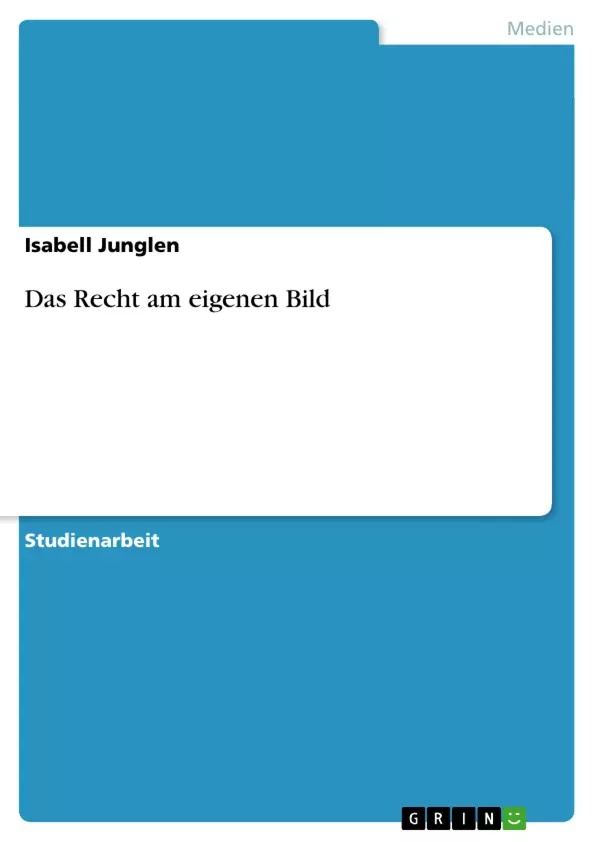Die Erfindung der Fotografie bot erstmals die Möglichkeit Bilder von Personen für andere verfügbar zu machen und bildete somit den Anlass zur Regelung des Schutz der Persönlichkeit, welche durch die Verbreitung von Bildnissen verletzt werden kann. Der Bildjournalismus ist in den Bereich der Medien einzuordnen und wird insbesondere von der Presse, dem Internet und dem Fernsehen genutzt. Wir befinden uns in einem Zeitalter der Visualisierung der Kommunikation, in dem das Bild eine entscheidende Rolle einnimmt und nicht selten als wichtiger angesehen wird als das geschriebene oder das gesprochene Wort. Die Publikation eines Fotos hat häufig eine deutlich größere Wirkung auf den Betrachter und einen größeren Erinnerungseffekt als eine verbale Darstellung eines bestimmten Ereignisses. In der heutigen Informations- und Mediengesellschaft werden die unterschiedlichsten Persönlichkeitsmerkmale von Personen, v.a. denen des öffentlichen Lebens, wie deren Bildnis oder deren Name teils ohne Skrupel und Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten zu deren Lebzeiten und auch danach zu Werbezwecken oder Auflagensteigerungen ausgenutzt. Somit stellt sich immer wieder das Problem der Verletzung des Persönlichkeitsrechts, welches zu Beginn dieser Seminararbeit einführend erläutert werden soll. In seinen Anfängen war die praktische Bedeutung des Rechts am eigenen Bild auf Fotos von Personen im öffentlichen Leben, Fotos zu Werbezwecken oder auf in Zeitungen, Zeitschriften sowie dem Fernsehen veröffentlichten Bildnissen beschränkt. Vor allem die enormen technischen Entwicklungen, besonders im Bereich der Digitalfotografie und der Filmkameras, sowie der Erfindung von Fotohandys und der Entstehung des Internets, welches jedem jederzeit die Möglichkeit zur Veröffentlichung von Bildern bietet, haben zu einer nie da gewesenen Bilderflut und einer damit einhergehenden Fülle an Rechtsverletzungen geführt, die nunmehr weite Kreise der Bevölkerung betrifft. Einen Schutz gegen derartige Persönlichkeitsverletzungen bildet das Recht am eigenen Bild. Nur in den seltensten Fällen kennt jemand den Namen der Fotografen, allerdings ist der Bekanntheitsgrad der Bilder meist enorm.
Inhaltsverzeichnis
- 1. DIE EINLEITUNG
- 2. DIE EINORDNUNG DES RECHTS AM EIGENEN BILD
- 2.1 DAS ALLGEMEINE PERSÖNLICHKEITSRECHT
- 2.2 DIE PRESSE- UND INFORMATIONSFREIHEIT
- 3. DAS RECHT AM EIGENEN BILD
- 3.1 DIE GESCHICHTE DES RECHTS AM EIGENEN BILD
- 3.2 DER GRUNDSATZ DES RECHTS AM EIGENEN BILD NACH § 22 KUG
- 3.2.1 DER SCHUTZBEREICH
- 3.2.2 DER BEGRIFF DES BILDNISSES
- 3.2.3 DER BEGRIFF DER EINWILLIGUNG
- 3.3 DIE AUSNAHMETATBESTÄNDE DES BILDNISSCHUTZES NACH § 23 I KUG
- 3.3.1 DIE BILDNISSE AUS DEM BEREICH DER ZEITGESCHICHTE
- 3.3.2 DIE BILDER VON PERSONEN ALS BEIWERK
- 3.3.3 DIE BILDER VON VERSAMMLUNGEN, AUFZÜGEN UND ÄHNLICHEN VORGÄNGEN
- 3.3.4 DIE BILDNISSE ZUM ZWECKE DER KUNST UND WISSENSCHAFT
- 3.4 DIE VERLETZUNG EINES BERECHTIGTEN INTERESSE NACH § 23 II KUG
- 3.5 DIE AUSNAHMEN IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE LAUT § 24 KUG
- 3.6 DIE RECHTSFOLGEN BEI DER VERLETZUNG DES RECHTS AM EIGENEN BILD
- 4. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Recht am eigenen Bild im Kontext des deutschen Rechts. Ziel ist es, die Einordnung des Rechts am eigenen Bild innerhalb des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und im Verhältnis zur Presse- und Informationsfreiheit zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die gesetzlichen Regelungen des Kunsturhebergesetzes (KUG) und deren Ausnahmen.
- Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine Beziehung zum Recht am eigenen Bild
- Die gesetzlichen Regelungen des Rechts am eigenen Bild im KUG (§ 22 ff.)
- Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild (Zeitgeschichte, Beiwerk, öffentliches Interesse)
- Die Auswirkungen technischer Entwicklungen auf das Recht am eigenen Bild
- Rechtsfolgen bei Verletzung des Rechts am eigenen Bild
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Rechts am eigenen Bild ein und beschreibt die zunehmende Bedeutung von Bildern in der heutigen Informationsgesellschaft. Sie hebt den Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse an Bildberichterstattung und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, der Pressefreiheit, den Regelungen des KUG und den Rechtsfolgen von Verletzungen auseinandersetzen wird. Die rasante Entwicklung der Bildtechnologie und die damit verbundene Zunahme von Rechtsverletzungen werden als Ausgangspunkt der Problematik dargestellt. Ein Beispiel aus der Presseberichterstattung veranschaulicht die Praxis der Rechtsverletzungen im Journalismus.
2. Die Einordnung des Rechts am eigenen Bild: Dieses Kapitel ordnet das Recht am eigenen Bild im Kontext des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein, welches als absolutes Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB beschrieben wird. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, basierend auf Art. 1 Abs. 1 GG (Würde des Menschen) und Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit), wird als Grundlage für die Herausarbeitung des Rechts am eigenen Bild hervorgehoben. Das Kapitel legt somit die juristische Basis für die weiteren Ausführungen zur Thematik.
Schlüsselwörter
Recht am eigenen Bild, Persönlichkeitsrecht, Kunsturhebergesetz (KUG), Pressefreiheit, Informationsfreiheit, § 22 KUG, § 23 KUG, § 24 KUG, Bildnis, Einwilligung, öffentliches Interesse, Bundesgerichtshof (BGH), Digitalfotografie, Medien, Bildjournalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Recht am eigenen Bild
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Recht am eigenen Bild im deutschen Recht. Sie untersucht die Einordnung dieses Rechts im allgemeinen Persönlichkeitsrecht und im Verhältnis zur Presse- und Informationsfreiheit. Die Arbeit analysiert detailliert die gesetzlichen Regelungen des Kunsturhebergesetzes (KUG), insbesondere § 22, § 23 und § 24 KUG, einschließlich ihrer Ausnahmen und Rechtsfolgen bei Verletzungen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Einordnung des Rechts, eine detaillierte Betrachtung des KUG, eine Schlussbetrachtung, sowie ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die zentralen Themen umfassen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine Beziehung zum Recht am eigenen Bild, die gesetzlichen Regelungen des Rechts am eigenen Bild im KUG (§ 22 ff.), Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild (z.B. Zeitgeschichte, Beiwerk, öffentliches Interesse), die Auswirkungen technischer Entwicklungen auf das Recht am eigenen Bild und die Rechtsfolgen bei Verletzung des Rechts am eigenen Bild.
Wie wird das Recht am eigenen Bild im Kontext des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingeordnet?
Die Arbeit ordnet das Recht am eigenen Bild als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein, welches als absolutes Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB gilt und auf Art. 1 Abs. 1 GG (Würde des Menschen) und Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit) basiert. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche gesetzlichen Regelungen des KUG werden behandelt?
Die Seminararbeit analysiert detailliert die Regelungen des KUG, insbesondere § 22 KUG (Grundsatz des Rechts am eigenen Bild), § 23 KUG (Ausnahmetatbestände des Bildnisschutzes) und § 24 KUG (Ausnahmen im öffentlichen Interesse). Die einzelnen Paragraphen werden im Detail erklärt und ihre Anwendung anhand von Beispielen erläutert.
Welche Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild, darunter Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, Bilder von Personen als Beiwerk, Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen sowie Bildnisse zum Zwecke der Kunst und Wissenschaft. Die Grenzen dieser Ausnahmen werden kritisch beleuchtet.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild?
Die Seminararbeit beschreibt die Rechtsfolgen, die sich aus einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild ergeben. Diese werden im Kontext der jeweiligen gesetzlichen Regelungen des KUG erläutert.
Welche Rolle spielt die Presse- und Informationsfreiheit?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen dem Recht am eigenen Bild und der Presse- und Informationsfreiheit. Sie analysiert, wie dieser Konflikt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des KUG und der Rechtsprechung gelöst wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen Recht am eigenen Bild, Persönlichkeitsrecht, Kunsturhebergesetz (KUG), Pressefreiheit, Informationsfreiheit, § 22 KUG, § 23 KUG, § 24 KUG, Bildnis, Einwilligung, öffentliches Interesse, Bundesgerichtshof (BGH), Digitalfotografie, Medien und Bildjournalismus.
- Quote paper
- Isabell Junglen (Author), 2006, Das Recht am eigenen Bild, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87030