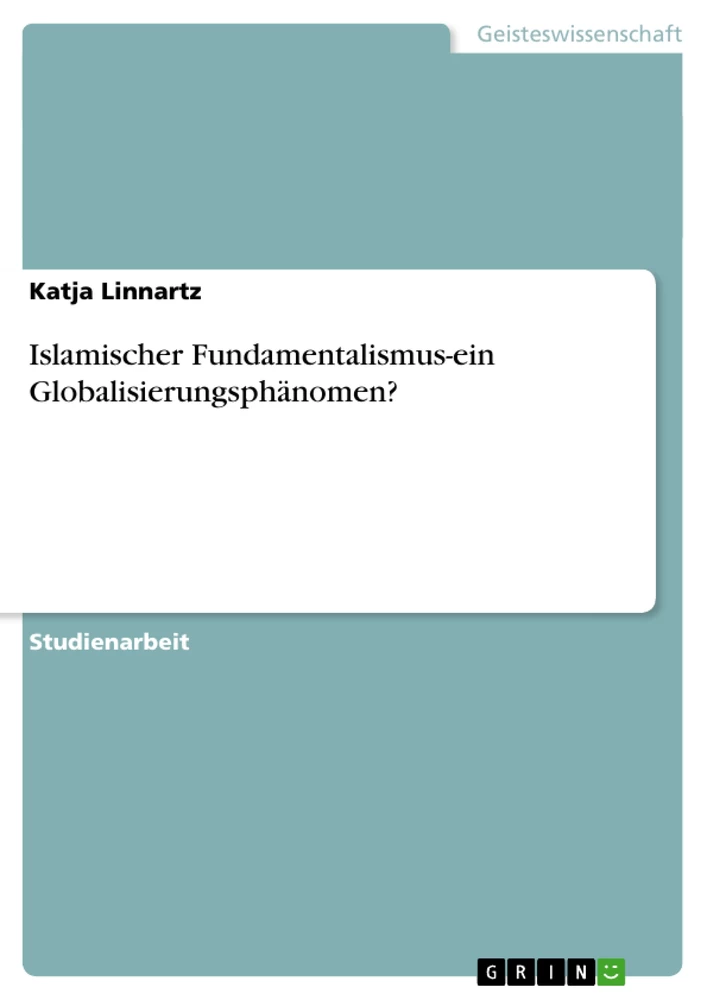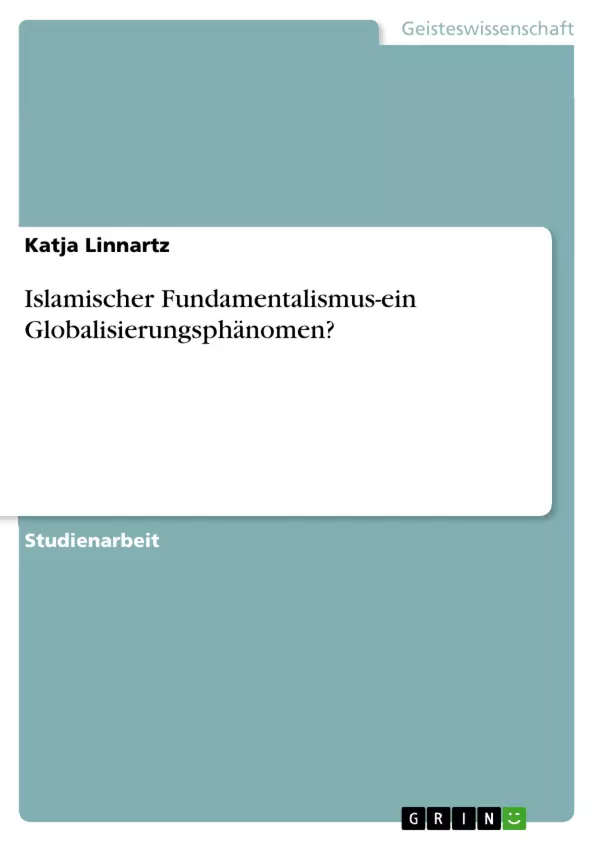"Ist uns [...] bewußt, [...] welche Folgen wir mit unserer Art des Wirtschaftens, Produzierens und Vermarktens hervorrufen, in welch unerhörtem Ausmaß wir mit diesen uns selbstverständlich erscheinenden Mechanismen in jahrhundertealte traditionelle kulturelle Praxen anderer Völker eingreifen?", fragte Bundestagspräsident Wolfgang Thierse kürzlich in einer Rede anläßlich der Eröffnung des Interantional Dialogue for Young Elites der Firma Daimler Chrysler und der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse des 11. Septembers muß die einzige Antwort auf diese Frage wohl ein eindeutiges Nein sein. Nicht einmal ansatzweise können wir noch einschätzen, welchen Konsequenzen des sich immer mehr verselbständigenden Globalisierungs- und Modernisierungsprozesses wir noch werden ins Auge blicken müssen. Ein solcher Aspekt ist sicherlich das in den letzten Jahren vermehrt auftretende Entstehen fundamentalistischer Bewegungen, und führen wir Thierses Gedanken in diesem Zusammenhang weiter, dann drängt sich sehr schnell und unweigerlich die Frage auf, inwieweit die aktuellen Entwicklungen in der islamischen Welt als Ausdrucksmodi der kulturellen Globalisierung gewertet werden können.
Fast zeitgleich mit der in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts einsetzenden letzten Globalisierungswelle, auf die wir uns für gewöhnlich beziehen, wenn wir von „Globalisierung“ sprechen, nämlich mit der arabischen Niederlage im 6-Tage-Krieg von 19673 oder doch zumindest aller spätestens mit der iranischen Revolution von 1979 lassen die Experten im allgemeinen das Aufleben des sogenannten islamischen Fundamentalismus beginnen. Somit scheint der Gedanke, daß es sich dabei nicht um zwei völlig eigenständige, lediglich zufällig gleichzeitig stattfindende Prozesse handeln könnte, nicht allzu abwegig.
Die vorliegen Arbeit wird daher nach einem Zusammenhang dieser beiden Phänomene fragen und sich mit der Problematik beschöftigen, inwieweit das Aufleben des islamischen Fundamentalismus durch den Globalisierungsprozeß beeinflußt wurde und ob es vielleicht sogar als eine Folge- bzw. Begleiterscheinung desselben bezeichnet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführende Bemerkungen zum Thema der Arbeit
- Struktur der Arbeit
- Definitionen
- Definition von Globalisierung
- Allgemeine Definition von Globalisierung
- Globalization = Americanization
- Definition von Fundamentalismus
- Allgemeine Definition von Fundamentalismus
- Definition von Islamischem Fundamentalismus
- Globalisierung und Fundamentalismus
- Fundamentalismus als sinnstiftendes Element
- Individuelle Orientierungssuche in einer globalen Welt der Moderne
- Individuelle Orientierungssuche im islamischen Fundamentalismus
- Fundamentalismus als identitätsstiftendes Element
- Verteidigung der kulturellen Identität gegen die „Universalkultur“
- Verteidigung des Wertesystems gegen die „Verwestlichung“
- Fundamentalismus als sozialpolitisches Element
- Fundamentalismus als revolutionistisches Element
- Auflehnung gegen wachsende ökonomisch-soziale Ungleichheiten
- Soziale Verortung der Anhängerschaft
- Die Rolle der Medien
- Fazit
- Ausblick - Gibt es Chancen zu einer „Konfliktlösung“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Globalisierung und islamischem Fundamentalismus. Sie strebt danach, zu beleuchten, inwieweit der Prozess der Globalisierung das Entstehen und die Verbreitung des islamischen Fundamentalismus beeinflusst hat.
- Die Definition und unterschiedlichen Ausprägungen von Globalisierung und Fundamentalismus
- Die Rolle des islamischen Fundamentalismus als Reaktion auf die Herausforderungen der modernen, globalisierten Welt.
- Der Einfluss der Globalisierung auf die Identitätsbildung und die Suche nach Sinn im islamischen Fundamentalismus.
- Die Analyse von islamischem Fundamentalismus als Ausdruck von sozialen und politischen Protesten gegen Ungleichheiten und Verwestlichung.
- Die Bedeutung der Medien im Kontext von Globalisierung und Fundamentalismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Ereignisse des 11. Septembers heraus. Die Arbeit untersucht die Frage, ob das Aufleben des islamischen Fundamentalismus als eine Folge der Globalisierung gesehen werden kann.
Der zweite Teil widmet sich der Definition der beiden Begriffe "Globalisierung" und "Fundamentalismus" mit besonderem Fokus auf den islamischen Fundamentalismus.
Der dritte Teil analysiert die Beziehung zwischen Globalisierung und islamischem Fundamentalismus. Dieser Teil beleuchtet, wie der Fundamentalismus als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung angesehen werden kann, wie zum Beispiel die Suche nach Sinn und Identität im Kontext von Modernisierung, Säkularisierung und Verwestlichung. Außerdem werden die sozialen und politischen Aspekte des islamischen Fundamentalismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Globalisierung, des islamischen Fundamentalismus, der Modernisierung, der Verwestlichung, der Identitätsbildung und der Suche nach Sinn in einer globalisierten Welt. Darüber hinaus werden die Rolle der Medien, soziale und politische Ungleichheiten sowie die Herausforderungen der kulturellen Globalisierung diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Katja Linnartz (Autor:in), 2002, Islamischer Fundamentalismus-ein Globalisierungsphänomen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8645