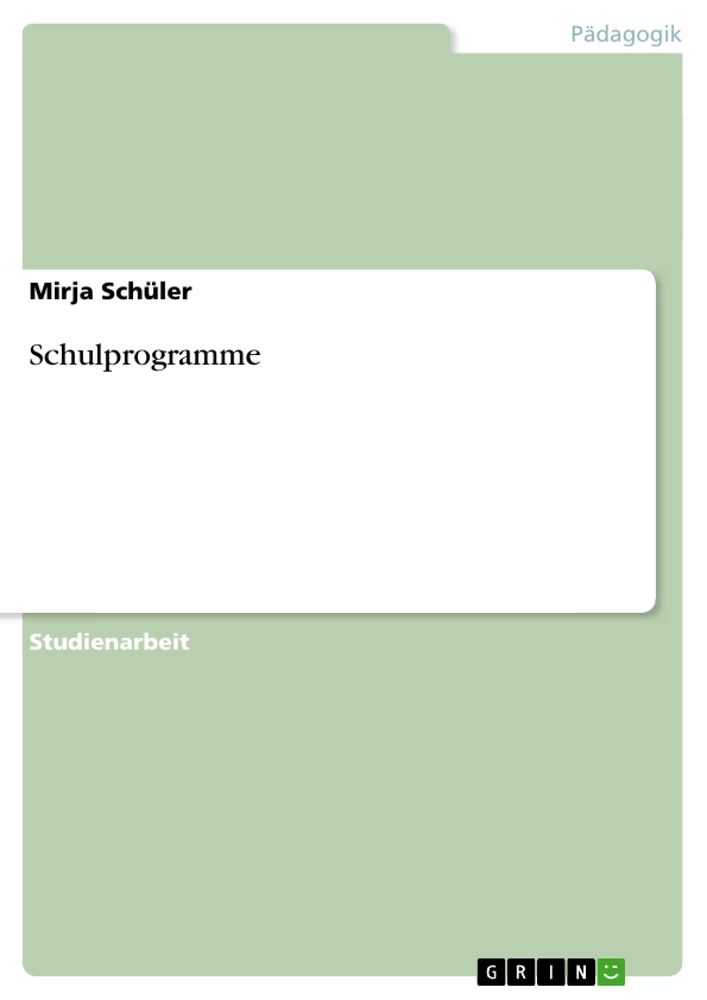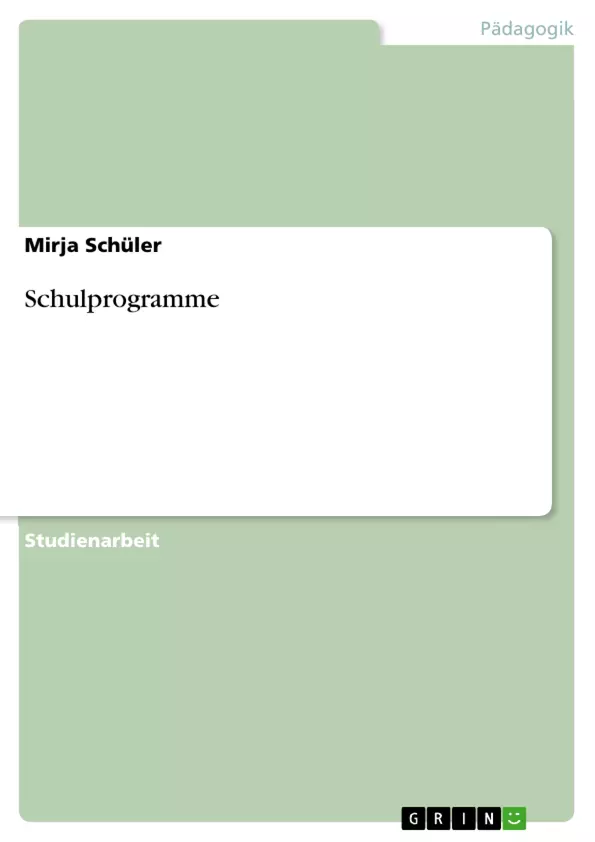Die beruflichen Schulen sind seit Jahren Mittelpunkt der Kritik am dualen Ausbildungssystem:
Häufig wird ein veralteter Unterricht und eine schlechte Ausstattung der Schulen angeführt, welche nicht mehr den Bedürfnissen des Berufsalltages entspricht. Der Schulunterricht kann keine berufliche Handlungskompetenz vermitteln, da er zu stark theoretisch ausgerichtet und der Anteil an allgemeinbildendem Unterricht enorm groß ist. Statt dessen führt der Berufsschulunterricht oftmals zu trägem Wissen, d.h. Wissen, das nicht zur Anwendung kommt, das in bestehendes Vorwissen nicht integriert wird und zu wenig vernetzt und damit zusammenhangslos ist. Die Lerninhalte des Berufsschulunterrichts werden nicht mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmt, und die Lernkooperation zwischen Schule und Betrieben ist meist sehr dürftig. Die Wirtschaft fordert daher von den beruflichen Schulen zunehmend Modernisierung, Flexibilität und Qualität.
In der bildungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Diskussion vieler Länder hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Einzelschule als „pädagogische Handlungseinheit“ der Ort ist, an dem Schulentwicklung stattfindet. Hinter dieser Erkenntnis steht die Erfahrung, dass die einzelne Schule ihre Aufgabe weit besser meistern kann, wenn sie sich den Vorstellungen und Bedürfnissen der Menschen und Institutionen öffnet, die in der Schule und mit der Schule leben, arbeiten und lernen. Hieraus entstand die Idee des Schulprogramms, welches als Hilfsmittel der Schulentwicklung dazu dienen soll, die kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der einzelnen Schule aufrecht zu erhalten und zu fördern.
In Hamburg trifft dieser Auftrag auf eine Schullandschaft, in der viele Schulen sich seit langem selbstständig weiterentwickelt und vielfältige Innovationen angestoßen haben. Die Voraussetzungen sind daher gut, sich des Mediums Schulprogramm zu bedienen, um wichtige schulische Gestaltungs- und Verständigungsprozesse zu strukturieren und zu dokumentieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gründe für Schulprogramme an beruflichen Schulen
- 2 Das Schulgesetz als Rahmen der Schulprogrammentwicklung
- 3 Begriffsbestimmung und -abgrenzung
- 4 Notwendige Bestandteile eines Schulprogramms
- 5 Entwicklungsschwerpunkte
- 5.1 Unterricht und Erziehung
- 5.2 Schulleben
- 5.3 Organisation und Kommunikation
- 6 Funktionen des Schulprogramms
- 6.1 Schulprogramme als Instrument der inneren Schulentwicklung
- 6.2 Das Schulprogramm als Marketinginstrument
- 6.3 Das Schulprogramm als Kontrollinstrument der Schulaufsicht
- 6.4 Das Schulprogramm zur Kooperation und Kommunikation mit Ausbildungsbetrieben
- 6.5 Das Schulprogramm als Kooperationsgrundlage gegenüber Dritten
- 7 Probleme bei der Erstellung von Schulprogrammen bzw. der Erfüllung der Funktionen
- 7.1 Rahmenbedingungen
- 7.2 Mobilisierungsprobleme
- 7.3 Fehlende Konsequenz und Schwierigkeiten bei der Evaluation
- 7.4 Schulprogramme als Werbemaßnahme
- 7.5 Rolle der Schulaufsicht
- 7.6 Das Duale System: Wirtschaft und Berufsschule
- 7.7 Beteiligung verschiedener Interessengruppen am Schulprogramm
- 8 Erste Ergebnisse/Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument untersucht die Notwendigkeit und den Wert von Schulprogrammen an beruflichen Schulen. Es beleuchtet die Gründe, die zur Entwicklung von Schulprogrammen führten, und beschreibt den Rahmen, der durch das Schulgesetz gesetzt wird. Darüber hinaus werden wichtige Bestandteile eines Schulprogramms und dessen Funktionen im Hinblick auf die Schulentwicklung, Marketing, Qualitätskontrolle und Kooperation analysiert.
- Die Kritik am dualen Ausbildungssystem und die Notwendigkeit der Modernisierung beruflicher Schulen
- Der rechtliche Rahmen für Schulprogrammentwicklung im Schulgesetz
- Die Funktionen des Schulprogramms als Instrument der inneren Schulentwicklung, des Marketings, der Qualitätskontrolle und der Kooperation
- Die Herausforderungen bei der Erstellung und Umsetzung von Schulprogrammen
- Die Auswirkungen von Schulprogrammen auf die Schulentwicklung und das duale System
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Gründe, die zur Einführung von Schulprogrammen an beruflichen Schulen führten. Es kritisiert den bestehenden Zustand des dualen Ausbildungssystems und die Notwendigkeit der Modernisierung beruflicher Schulen. Das zweite Kapitel fokussiert auf das Schulgesetz als rechtlichen Rahmen für die Entwicklung von Schulprogrammen und beschreibt die Anforderungen und Vorgaben für deren Erstellung. Im dritten Kapitel werden die Begriffe "Schulprofil", "Schulleitbild" und "Schulprogramm" definiert und voneinander abgegrenzt. Das vierte Kapitel behandelt die notwendigen Bestandteile eines Schulprogramms, während das fünfte Kapitel verschiedene Entwicklungsschwerpunkte behandelt, wie z.B. Unterricht und Erziehung, Schulleben und Organisation und Kommunikation. Kapitel sechs befasst sich mit den verschiedenen Funktionen des Schulprogramms, darunter die Rolle als Instrument der inneren Schulentwicklung, Marketinginstrument, Kontrollinstrument der Schulaufsicht, Instrument zur Kooperation mit Ausbildungsbetrieben und als Grundlage für die Kooperation mit Dritten.
Schlüsselwörter
Schulprogramme, berufliche Schulen, duale Ausbildung, Schulgesetz, Schulentwicklung, Marketing, Qualitätskontrolle, Kooperation, Schulaufsicht, Bildung, Erziehung, Unterricht, Schulleben, Organisation, Kommunikation.
- Arbeit zitieren
- Mirja Schüler (Autor:in), 2002, Schulprogramme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8614