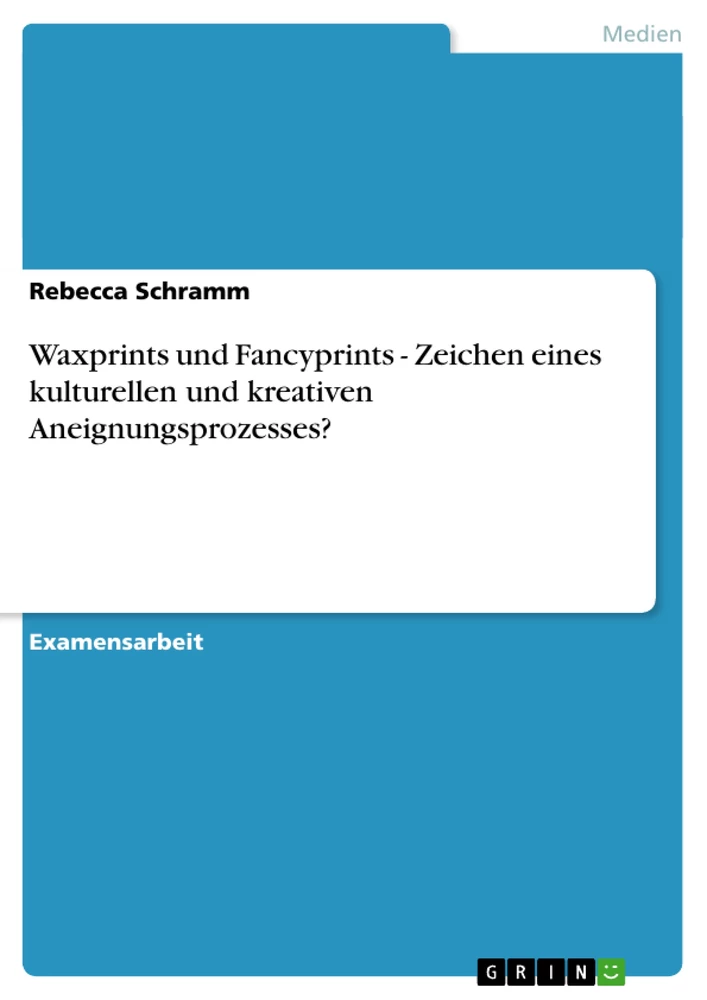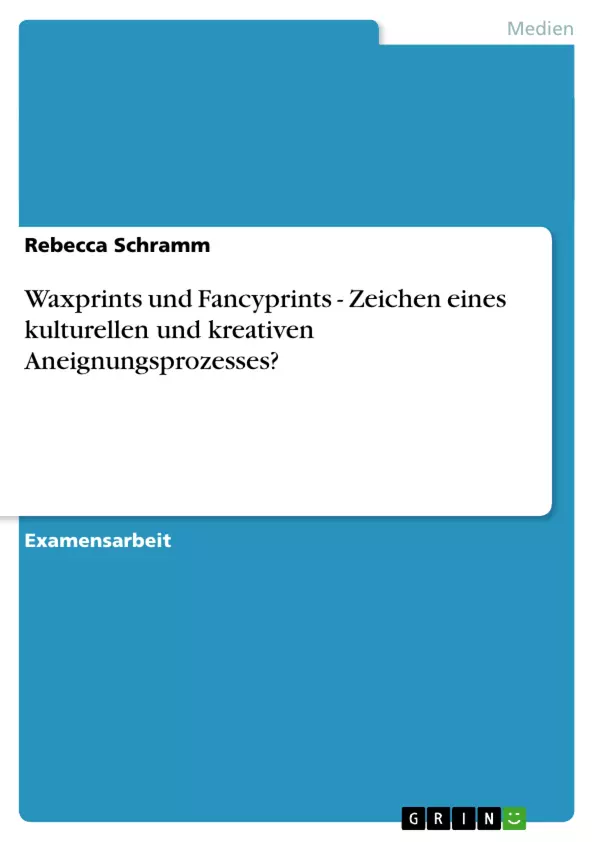Krieg, Krankheiten, Armut, Korruption, Sklavenhandel, Kolonialismus, Stagnation, Unterentwicklung, Abgeschlossenheit, Primitivität: dieser Katalog könnte endlos weitergeführt werden und beschreibt die Klischees, die viele Europäer1 mit Afrika verbinden. Kann ein solches Bild in eine Arbeit über westafrikanische Stoffe passen, die als Zeichen von Kreativität, kultureller Dynamik und Modebewusstsein gelten? Die Antwort auf diese Frage ist klar mit einem „Nein“ zu beantworten und soll auf den Perspektivenwechsel verweisen, der in dieser Arbeit eingenommen wird und der sich eindeutig gegen die genannten Stereotypen der „Afrikanität“ richtet.
Die Stoffe, die in Reisereportagen oft einseitig als bunt, farbenfroh, wildgemustert und typisch afrikanisch beschrieben werden und unter den Bezeichnungen Waxprints und Fancyprints geläufig sind, sind ein Beleg für die modische Aktivität Westafrikas, die sich in der Aufnahme fremder Innovationen, ihrer Umgestaltung, Uminterpretation und ihrer Kombination mit Lokalem widerspiegelt. Diese Stoffe können nicht einfach unter dem europäischen Wunsch nach Exotik abgehandelt werden, sondern bedürfen einer differenzierten Betrachtung ihrer Geschichte, Herstellung und Nutzung um sich von eurozentristischen Sichtweisen zu lösen.
So „afrikanisch“, wie viele Medien die Stoffe darstellen, waren sie nicht immer. Ursprünglich sind es niederländische Kopien der indonesischen Batik, die über den frühen Transatlantikhandel nach Westafrika gelangten und dort eine anspruchsvolle Kundschaft fanden, die nicht jedes Produkt in ihre Konsumgewohnheiten aufnahm. Damit begann ein stetiger Handel mit den Waxprints und den kostengünstigeren Fancyprints zwischen Europa und Westafrika, der von dem europäischen Streben geprägt war, die Wünsche der Konsumenten an die Stoffe zu erfüllen und zu der Traditionalisierung der Stoffe führte, wie die vorliegende Arbeit es im Einzelnen noch aufzeigen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 LITERATURLAGE, FRAGESTELLUNGEN, ARBEITSTHESEN UND VORGEHENSWEISE
- 1.2 GEOGRAPHISCHE EINORDNUNG WESTAFRIKAS
- 2. DEFINITIONEN
- 2.1 BEGRIFFSEINORDNUNG VON WAXPRINT UND FANCYPRINT
- 2.2 DER ETHNOLOGISCHE ANEIGNUNGSBEGRIFF
- 2.3 DAS MODELL DER KULTURELLEN ANEIGNUNG MATERIELLER GEGENSTÄNDE
- 3. GESCHICHTLICHE HINTERGRÜNDE
- 3.1 TEXILHANDEL ZWISCHEN EUROPA UND WESTAFRIKA
- 3.2 DIE KULTURGESCHICHTE DER WESTAFRIKANISCHEN INDUSTRIESTOFFE
- 4. DIE HERSTELLUNG
- 4.1 DIE INDONESISCHE BATIK
- 4.2 INDUSTRIELLE HERSTELLUNGSVERFAHREN
- 4.3 DIE WESTAFRIKANISCHEN FÄRBETECHNIKEN
- 5. DIE MOTIVE
- 5.1 DAS ARCHIV DER MOTIVE
- 5.2 KATEGORISIERUNG DER MUSTER
- 6. DIE SPRACHE DER MOTIVE
- 6.1 NAMENSGEBUNG
- 6.2 NONVERBALE KOMMUNIKATION
- 7. INWIEFERN KANN MAN BEI DEN WAX- UND FANCYPRINTS VON EINEM ANEIGNUNGSPROZESS AUSGEHEN?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aneignung von Waxprints und Fancyprints in Westafrika. Ziel ist es, den Prozess der kulturellen Integration dieser ursprünglich europäischen Stoffe zu analysieren und zu belegen, inwieweit ein ethnologisches Aneignungsmodell auf diesen Fall zutrifft. Die Arbeit greift auf bestehende Literatur zu westafrikanischen Textilien und ethnologischen Aneignungstheorien zurück.
- Der historische Handel mit Textilien zwischen Europa und Westafrika
- Die Herstellung von Waxprints und Fancyprints im Vergleich zur indonesischen Batik
- Die Bedeutung der Namensgebung und die sprachliche Funktion der Stoffe
- Die Rolle von Waxprints und Fancyprints in der nonverbalen Kommunikation
- Anwendung eines ethnologischen Modells der kulturellen Aneignung auf den Fall der westafrikanischen Stoffe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht Waxprints und Fancyprints als Zeichen kultureller Aneignung in Westafrika, widerlegt eurozentristische Stereotypen über afrikanische Stoffe und fokussiert auf deren modische Aktivität und kreative Umgestaltung im lokalen Kontext. Die Stoffe, zunächst niederländische Kopien indonesischer Batik, entwickelten sich durch Handel zwischen Europa und Westafrika zu einem Ausdruck kultureller Dynamik und Modebewusstsein.
1.1 Literaturlage, Fragestellungen, Arbeitsthesen und Vorgehensweise: Die Arbeit analysiert die spärliche wissenschaftliche Literatur zu Pagnes, wobei ethnologische und kunsthistorische Ansätze im Vordergrund stehen. Offene Fragen zum Aneignungsprozess werden erörtert, die zu Arbeitsthesen führen, welche die aktive und kreative Aneignung von Waxprints und Fancyprints durch westafrikanische Bevölkerungsgruppen als Ergebnis soziokultureller Umstände und Strukturen untersuchen.
1.2 Geographische Einordnung Westafrikas: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Geographie, Bevölkerung und Wirtschaftsstruktur Westafrikas, um den kulturellen Kontext der Studie zu beleuchten. Es werden die relevanten Ethnien und ihre sprachliche Zugehörigkeit sowie die klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Region beschrieben.
2. Definitionen: Hier werden die Begriffe Waxprint, Fancyprint und Pagne definiert und voneinander abgegrenzt. Der ethnologische Aneignungsbegriff wird erläutert, wobei der Fokus auf dem Prozess der lokalen Interpretation und Umdeutung fremder Güter liegt. Das Modell der kulturellen Aneignung materieller Gegenstände nach Hans Peter Hahn wird vorgestellt, das die Phasen Erwerb, Transformation und Traditionalisierung umfasst.
3. Geschichtliche Hintergründe: Dieser Abschnitt beschreibt den historischen Textilhandel zwischen Europa und Westafrika, beginnend mit dem Transsahara-Handel und der späteren Öffnung der transatlantischen Handelsroute. Die Entwicklung der Javaprints als Vorläufer der Waxprints wird erläutert, sowie die Rolle der Kolonialisierung bei der Etablierung der europäischen Industriedrucke auf dem westafrikanischen Markt.
4. Die Herstellung: Dieser Teil befasst sich mit den Herstellungsverfahren von indonesischer Batik und industriellen Waxprints und Fancyprints. Die verschiedenen Arten von Waxprints (wax print, wax cover, wax block) und ihre Herstellungsschritte werden detailliert beschrieben, ebenso die Unterschiede zu den Rollerprints. Schließlich wird ein Überblick über traditionelle westafrikanische Färbetechniken (Indigo-Färbung, Adire, Plangi, Tritik, Adinkra) gegeben.
5. Die Motive: Dieser Abschnitt behandelt die Vielfalt der Motive auf Wax- und Fancyprints, die in Archiven der Herstellerfirmen dokumentiert sind. Verschiedene Klassifizierungssysteme der Motive werden vorgestellt und verglichen, die auf unterschiedlichen Kriterien basieren (Hauptmotive, Inspirationsquellen, Botschaften, etc.).
6. Die Sprache der Motive: Die Namensgebung von Waxprints und Fancyprints wird im Kontext der westafrikanischen Kultur analysiert. Die Bedeutung von Sprichwörtern und die Verwendung von Stoffnamen zur nonverbalen Kommunikation, insbesondere im Rahmen sozialer Konflikte und in polygamen Ehen, wird detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Waxprints, Fancyprints, Pagne, kulturelle Aneignung, Westafrika, Indonesische Batik, Textilhandel, Namensgebung, nonverbale Kommunikation, Hans Peter Hahn, Tradition, Moderne, Identität, Interkultureller Austausch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aneignung von Waxprints und Fancyprints in Westafrika
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Aneignung von Waxprints und Fancyprints in Westafrika. Sie analysiert den Prozess der Integration dieser ursprünglich europäischen Stoffe in die westafrikanische Kultur und prüft die Anwendbarkeit eines ethnologischen Aneignungsmodells auf diesen Fall.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Textilhandel zwischen Europa und Westafrika, die Herstellung von Waxprints und Fancyprints im Vergleich zur indonesischen Batik, die Bedeutung der Namensgebung und die sprachliche Funktion der Stoffe, die Rolle der Stoffe in der nonverbalen Kommunikation und die Anwendung eines ethnologischen Modells der kulturellen Aneignung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit greift auf bestehende Literatur zu westafrikanischen Textilien und ethnologischen Aneignungstheorien zurück. Sie analysiert die Motive, die Namensgebung und die Verwendung der Stoffe in verschiedenen sozialen Kontexten. Ein zentrales Element ist die Anwendung des kulturellen Aneignungsmodells nach Hans Peter Hahn.
Wie sind Waxprints und Fancyprints entstanden?
Ursprünglich waren Waxprints niederländische Kopien der indonesischen Batik. Durch den Handel zwischen Europa und Westafrika entwickelten sie sich zu einem wichtigen Bestandteil der westafrikanischen Kultur und Mode.
Wie werden Waxprints und Fancyprints hergestellt?
Die Arbeit vergleicht die Herstellung von indonesischer Batik mit den industriellen Verfahren zur Herstellung von Waxprints und Fancyprints. Sie beschreibt verschiedene Arten von Waxprints und ihre Herstellungsschritte und gibt einen Überblick über traditionelle westafrikanische Färbetechniken.
Welche Bedeutung haben die Motive auf den Stoffen?
Die Arbeit analysiert die Vielfalt der Motive auf Wax- und Fancyprints und präsentiert verschiedene Klassifizierungssysteme. Sie untersucht die Bedeutung der Motive im Kontext der westafrikanischen Kultur und deren Botschaften.
Welche Rolle spielen die Stoffe in der Kommunikation?
Die Arbeit untersucht die Namensgebung von Waxprints und Fancyprints und deren Bedeutung in der nonverbalen Kommunikation. Sie analysiert die Verwendung von Stoffnamen im Kontext sozialer Konflikte und in polygamen Ehen.
Welches Aneignungsmodell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet das ethnologische Aneignungsmodell nach Hans Peter Hahn, welches die Phasen Erwerb, Transformation und Traditionalisierung umfasst.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, inwieweit ein ethnologisches Aneignungsmodell auf den Fall der westafrikanischen Stoffe zutrifft und beleuchtet die aktive und kreative Aneignung von Waxprints und Fancyprints durch westafrikanische Bevölkerungsgruppen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Waxprints, Fancyprints, Pagne, kulturelle Aneignung, Westafrika, Indonesische Batik, Textilhandel, Namensgebung, nonverbale Kommunikation, Hans Peter Hahn, Tradition, Moderne, Identität, interkultureller Austausch.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Schramm (Autor:in), 2007, Waxprints und Fancyprints - Zeichen eines kulturellen und kreativen Aneignungsprozesses?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85557