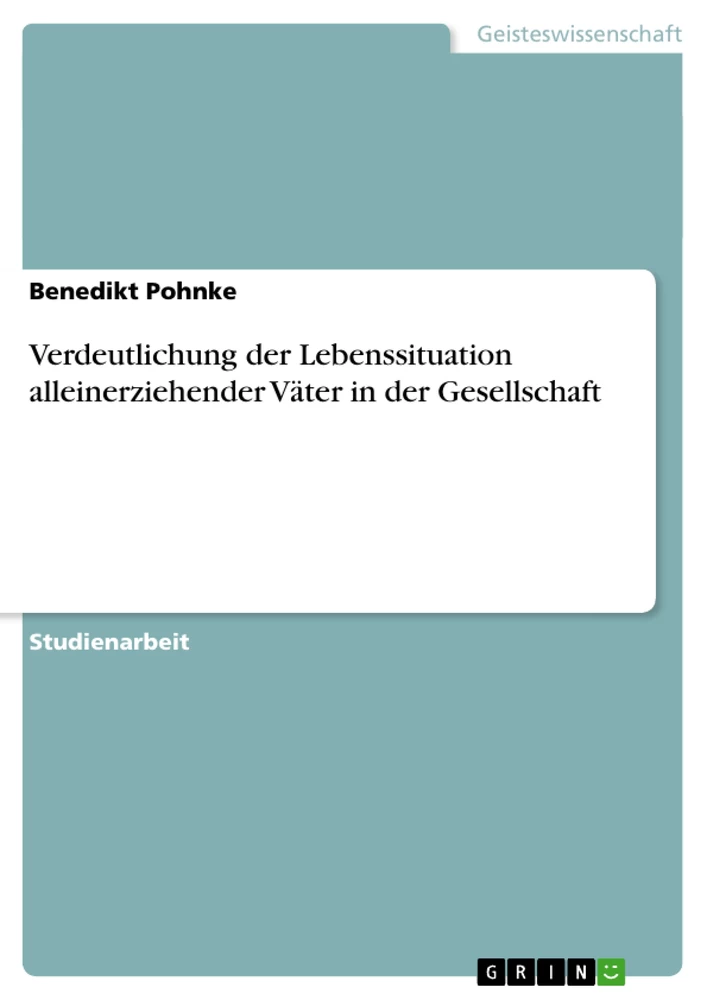Die Einelternfamilien sind in Deutschland eine sehr weitverbreitete Familienform. So gab es laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 1994 insgesamt 1.631.000 alleinerziehende Mütter und Väter in Deutschland. Dies macht einen prozentualen Anteil von 17,2% aus, gemessen an allen Familien mit minderjährigen Kindern.
Diese statistischen Daten liegen zum einen der Tatsache zugrunde, dass auch die Zahl der geschiedenen Familien mit Kindern in den letzten Jahrzehnten immens in die Höhe geschnellt ist. Korrespondierend dazu wird die Dauer von Partnerschaften, auch ohne den traditionellen Trauschein, tendenziell kürzer. Insgesamt lässt sich also ein Strukturwandel der Familie beobachten, auf dessen Gründe ich im zweiten Kapitel meiner Hausarbeit noch näher eingehen möchte.
Zum anderen sind Männer (traditionell) noch immer und nun zum Glück auch Frauen (tendenziell) u.a. aufgrund gesellschaftlicher Rahmenbedingungen - also auch Missstände wie hohe Arbeitslosigkeit - mehr denn je darauf bedacht, ihre Existenz z.B. durch eine erfolgreiche berufliche Karriere zu sichern.
Trotzdem ist das traditionell verhärtete Rollenmuster, dass Frauen für die Erziehung der Kinder und Männer fürs Geldverdienen zuständig sind, in unserer Gesellschaft leider noch immer weitesgehend vorherrschend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen und familiensoziologische Erläuterungen
- Womit beschäftigt sich die Familiensoziologie?
- Struktureller und funktionaler Wandel von Ehe und Familie
- Ein-Eltern-Familien
- Lebensbewältigung alleinerziehender Väter
- Anforderungen an die Väter im Alltag
- Erziehung
- Haushaltsführung
- Konsequenzen für das Berufsleben
- Anforderungen an die Väter im Alltag
- Persönliche Situation alleinerziehender Väter
- Neue Rollenfindung
- Status in der Gesellschaft
- Soziale Isolation?
- Bedeutung des Alleinseins
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Lebenssituation alleinerziehender Väter in Deutschland. Sie zielt darauf ab, die Herausforderungen und Chancen dieser ungewöhnlichen Familienform zu beleuchten und die Rolle der Väter in der Gesellschaft zu analysieren.
- Die Herausforderungen der neuen Rollenfindung alleinerziehender Väter.
- Die Vereinbarkeit von Beruf, Haushalt und Erziehung in Ein-Eltern-Familien.
- Die soziale Isolation und die Bedeutung des Alleinseins für alleinerziehende Väter.
- Der gesellschaftliche Status und die Akzeptanz von alleinerziehenden Vätern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Ein-Eltern-Familien in Deutschland ein und erläutert die wachsende Bedeutung dieser Familienform im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Familiensoziologie und analysiert den strukturellen und funktionalen Wandel von Ehe und Familie, insbesondere die Entwicklung der Ein-Eltern-Familie.
Das dritte Kapitel untersucht die Lebensbewältigung alleinerziehender Väter im Alltag, die Anforderungen an ihre Erziehung und Haushaltsführung sowie die Auswirkungen auf ihr Berufsleben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der persönlichen Situation alleinerziehender Väter, ihrer neuen Rollenfindung, ihrem Status in der Gesellschaft, der Frage der sozialen Isolation und der Bedeutung des Alleinseins.
Schlüsselwörter
Ein-Eltern-Familien, alleinerziehende Väter, Familiensoziologie, Rollenkonflikte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Isolation, gesellschaftlicher Status, Lebensbewältigung.
- Quote paper
- Benedikt Pohnke (Author), 2001, Verdeutlichung der Lebenssituation alleinerziehender Väter in der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8530