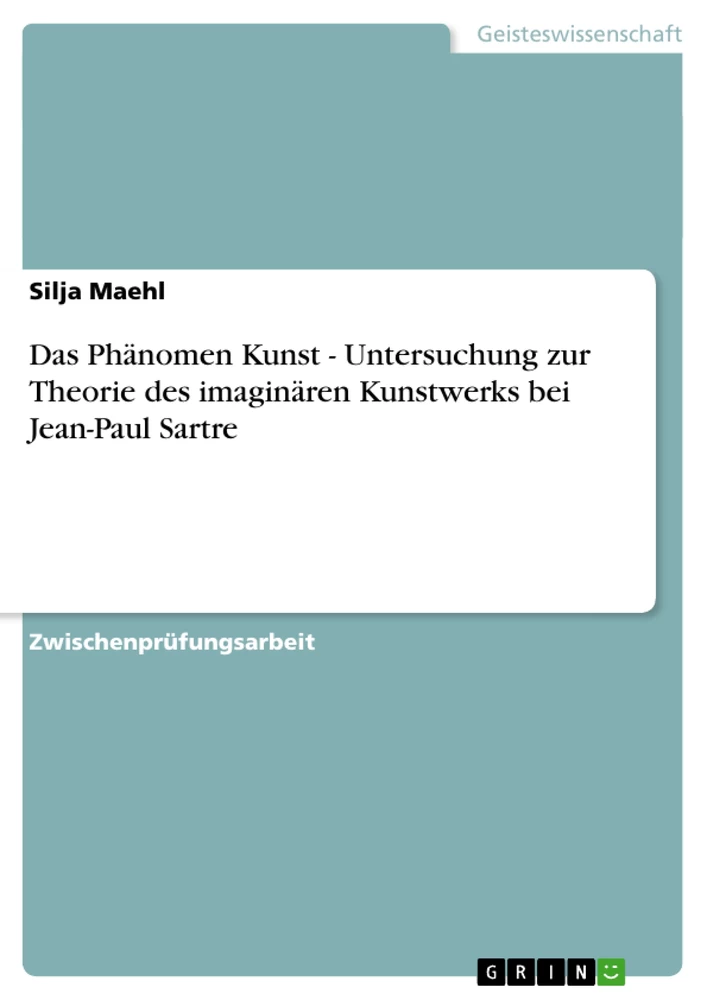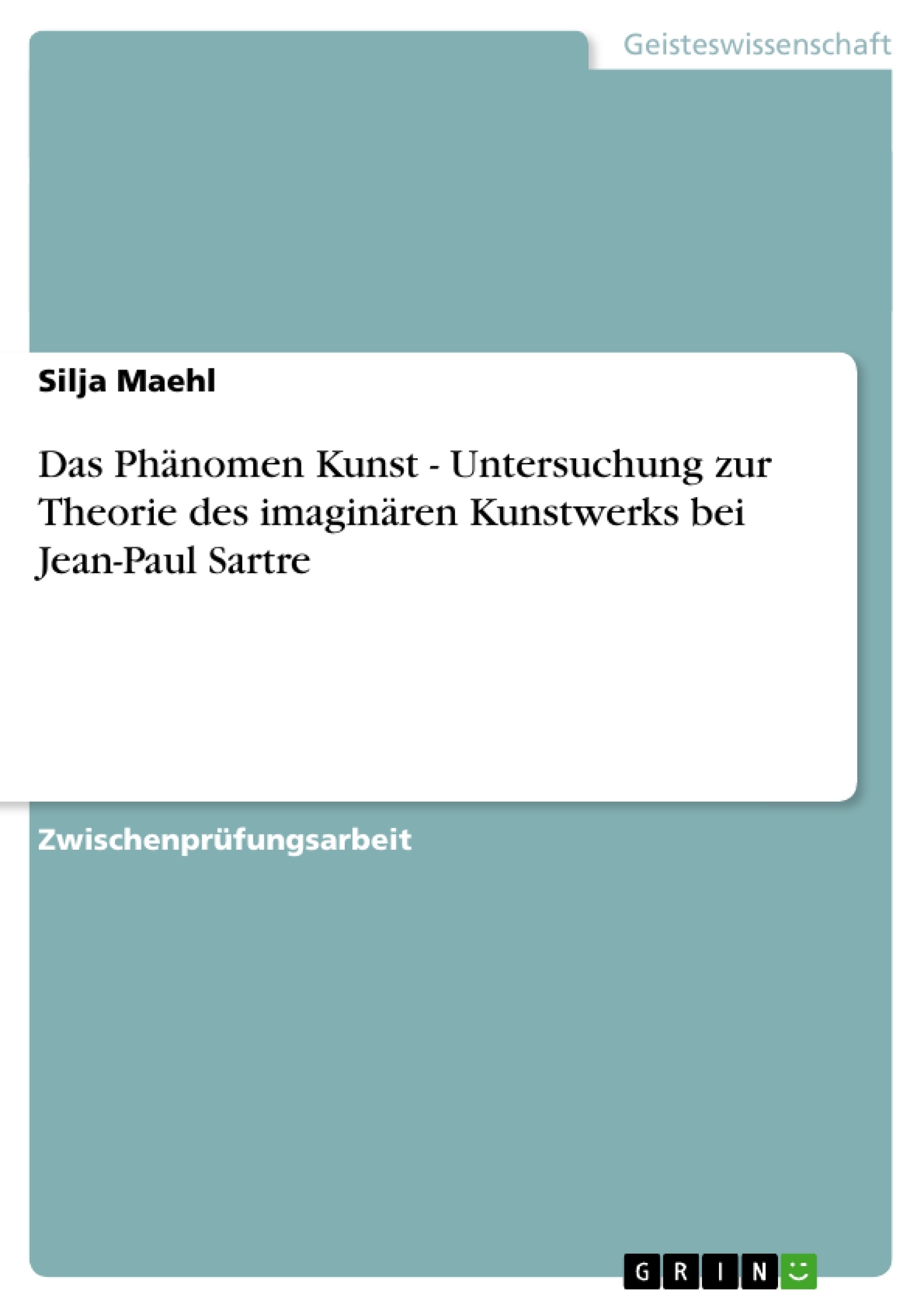Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht das Kunstverständnis Jean-Paul Sartres. Hier möchte ich vor allem die Position Sartres vom Kunstwerk als imaginärem Phänomen untersuchen. Trotz der großen Vielfalt seiner Themen - Phänomenologie, Ontologie, Existenzphilosophie, Politik, Psychologie uvm. - haben seine philosophischen Werke, Essays, Reden, Dramen und Romane explizit oder implizit immer wieder die Kunst zum Gegenstand. Eine Ästhetik in einem systematischen Sinne hat er allerdings nicht verfasst. Daher ist es schwierig, ihn auf eine Theorie festzulegen, da er manchmal Jahre später Gedanken in einen neuen, aktuellen Zusammenhang gestellt hat. Dennoch gibt es Konstanten, die ich herausstellen möchte.
Ich beginne damit, den Gedanken Lambert Wiesings zu erklären, dass zwischen Phänomenologie und Kunst eine innere Verwandtschaft bestehe. Dabei geht es mir nicht um eine Analyse der Theorien Wiesings. Ich möchte seine Gedanken im Laufe meiner Arbeit dahingehend nutzen, vom Verhältnis von Kunst und Phänomenologie zum Kunst-Verständnis des Phänomenologen und Existenzphilosophen Sartre überzuleiten. Denn Sartres ästhetische Theorie ist eine phänomenologische.
Wiesing stellt sich die Frage, warum sich die Phänomenologie mit der Kunst - vor allem mit der avantgardistischen - so schwer tut. Hier möchte ich kurz die semiotische und die materialistische Position vorstellen. Im Hauptteil meiner Arbeit geht es mir um die Position Sartres, der sich von diesen beiden Ansätzen abgrenzt. Diese Gegenüberstellung ist nützlich, um zu zeigen, dass Sartre der Kunst eine Funktion sui generis geben will, die bei den eben genannten Positionen für ihn nicht gegeben ist.
Anschließend lege ich Sartres Bedingungen für den Kunststatus eines Werkes dar - seien es ein Roman oder ein Bild. Im Vordergrund meiner Untersuchungen steht dabei sein Essay „Was ist Literatur?“, aber ich behalte seine weiteren Publikationen zum Thema Literatur, Malerei und damit Kunst im Allgemeinen dabei im Blick. Was ist Kunst für Sartre? Welche Rolle spielt bei ihm der Künstler? Welche der Rezipient? Welche ausschließliche Funktion hat das Phänomen Kunst bei ihm?
Schließlich werde ich einige kritische Anmerkungen zu Sartre machen und hier auf mögliche Auswege im Werke seines Kollegen und philosophischen Gesprächspartners Maurice Merleau-Ponty verweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phänomenologie und Kunst
- Das semiotische und das materialistische Kunstverständnis
- Sartres Kunstverständnis
- Was ist und was kann die Kunst?
- Der Künstler
- Der Rezipient
- Kritische Auseinandersetzung mit Sartre
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jean-Paul Sartres Kunstverständnis, insbesondere seine Theorie des Kunstwerks als imaginäres Phänomen. Sie beleuchtet Sartres Position im Kontext der phänomenologischen Ästhetik und setzt sie in Bezug zu semiotischen und materialistischen Kunstverständnissen. Die Arbeit analysiert Sartres Kriterien für den Kunststatus eines Werkes und die Rolle von Künstler und Rezipient.
- Sartres phänomenologische Kunsttheorie
- Vergleich mit semiotischen und materialistischen Ansätzen
- Die Rolle der Imagination in Sartres Ästhetik
- Die Funktion des Kunstwerks bei Sartre
- Kritische Auseinandersetzung mit Sartres Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit widmet sich Jean-Paul Sartres Kunstverständnis, insbesondere der Betrachtung des Kunstwerks als imaginäres Phänomen. Sie erläutert die Schwierigkeit, Sartres Position auf eine einheitliche Theorie zu reduzieren, da er seine Gedanken im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Phänomenologie und Kunst her und kündigt den Vergleich mit semiotischen und materialistischen Ansätzen an, um Sartres eigenständige Position herauszuarbeiten.
Phänomenologie und Kunst: Dieses Kapitel untersucht die methodische Verwandtschaft von Phänomenologie und Kunst, basierend auf Lambert Wiesings These von der Imaginarität als gemeinsamer Struktur. Es wird erläutert, wie die Phänomenologie – als Philosophie der Korrelation zwischen Bewusstsein und Gegenstand – der Bildbetrachtung ähnelt, da beide aktive Gestaltungsprozesse mit Synthese und Interpretation beinhalten. Der Unterschied liegt in der Verankerung der Gegenstände in Raum und Zeit bei der sinnlichen Wahrnehmung im Gegensatz zur ausschließlichen Existenz im Bewusstsein bei der Imagination. Die Kapitel verdeutlicht die unterschiedlichen Positionen von Husserl, Sartre und Merleau-Ponty bezüglich des Verhältnisses von Wahrnehmung und Imagination.
Schlüsselwörter
Jean-Paul Sartre, Kunstverständnis, Phänomenologie, Imagination, Ästhetik, imaginäres Kunstwerk, semiotischer Ansatz, materialistischer Ansatz, Künstler, Rezipient, Kunststatus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jean-Paul Sartres Kunstverständnis
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Jean-Paul Sartres Kunstverständnis, insbesondere seine Theorie des Kunstwerks als imaginäres Phänomen. Sie vergleicht Sartres Position mit semiotischen und materialistischen Kunstverständnissen und untersucht die Rolle von Künstler und Rezipient im Entstehungsprozess und der Rezeption des Kunstwerks.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Sartres phänomenologische Kunsttheorie, den Vergleich mit semiotischen und materialistischen Ansätzen, die Rolle der Imagination in Sartres Ästhetik, die Funktion des Kunstwerks nach Sartre und eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Theorie. Sie beleuchtet auch die methodische Verwandtschaft von Phänomenologie und Kunst und die unterschiedlichen Positionen von Husserl, Sartre und Merleau-Ponty bezüglich Wahrnehmung und Imagination.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Phänomenologie und Kunst, Das semiotische und das materialistische Kunstverständnis, Sartres Kunstverständnis (mit Unterkapiteln zu „Was ist und was kann die Kunst?“, „Der Künstler“ und „Der Rezipient“), Kritische Auseinandersetzung mit Sartre und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht und erläutert Jean-Paul Sartres Kunstverständnis, seine Kriterien für den Kunststatus eines Werkes und die Rolle von Künstler und Rezipient. Sie zeigt die Einbettung von Sartres Position in den Kontext der phänomenologischen Ästhetik und vergleicht sie mit anderen Kunstverständnissen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Jean-Paul Sartre, Kunstverständnis, Phänomenologie, Imagination, Ästhetik, imaginäres Kunstwerk, semiotischer Ansatz, materialistischer Ansatz, Künstler, Rezipient, Kunststatus.
Wie wird Sartres Kunstverständnis in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Sartres Kunstverständnis als eine Theorie des Kunstwerks als imaginäres Phänomen. Sie betont die Schwierigkeit, seine Position auf eine einheitliche Theorie zu reduzieren, aufgrund seiner sich weiterentwickelnden Gedanken im Laufe der Zeit. Die Arbeit analysiert seine Kriterien für den Kunststatus und die Bedeutung von Künstler und Rezipient.
Wie werden Sartres Ansichten mit anderen Kunstverständnissen verglichen?
Die Arbeit vergleicht Sartres phänomenologische Kunsttheorie explizit mit semiotischen und materialistischen Ansätzen, um seine eigenständige Position herauszuarbeiten und zu kontextualisieren.
Welche Rolle spielt die Phänomenologie in Sartres Kunstverständnis?
Die Phänomenologie bildet die methodische Grundlage für Sartres Kunstverständnis. Die Arbeit untersucht die methodische Verwandtschaft von Phänomenologie und Kunst, insbesondere die Rolle der Imagination als gemeinsamer Struktur, und beleuchtet den Vergleich der Perspektiven von Husserl, Sartre und Merleau-Ponty bezüglich Wahrnehmung und Imagination.
- Arbeit zitieren
- Silja Maehl (Autor:in), 2003, Das Phänomen Kunst - Untersuchung zur Theorie des imaginären Kunstwerks bei Jean-Paul Sartre, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84296