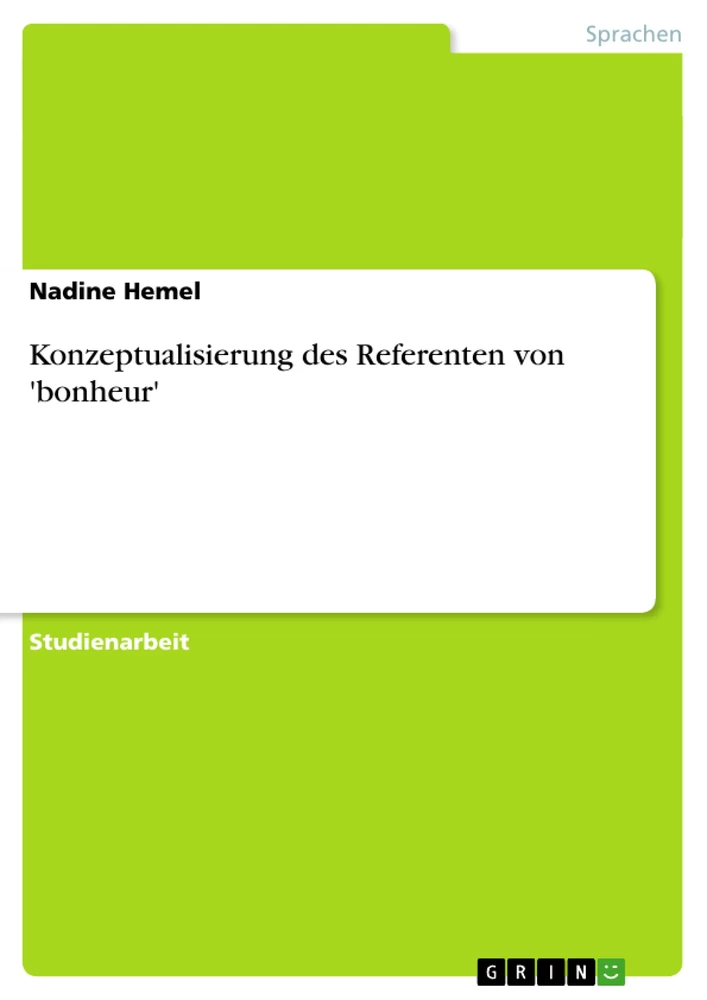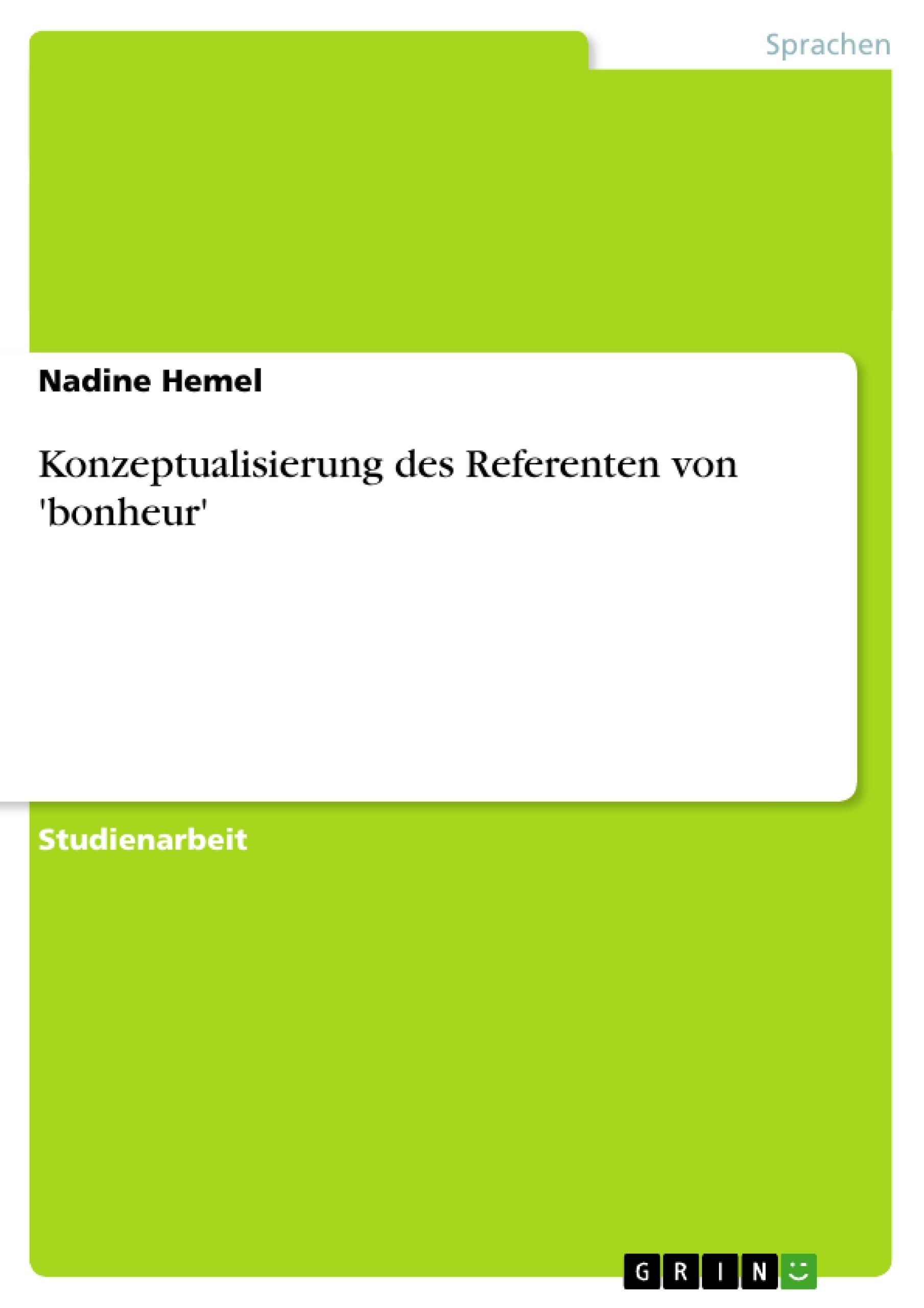Diese Arbeit ist der Versuch einer komparativen Analyse der Wortprofile von bonheur
und joie im Sinne der kognitiven Semantik, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Wort
bonheur liegt. Den theoretischen Hintergrund bilden Wittgenstein, der die Wichtigkeit
des Gebrauchs der Worte unterstreicht, sowie Lakoff und Johnsons konzeptuelle
Metaphern. Ziel ist einerseits die Beschreibung der Konzeptualisierung der Referenten
der Begriffe bonheur und joie in der französischen Sprache, und, damit
zusammenhängend, andererseits die Untersuchung, inwieweit es sich dabei um
Synonyme handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Einordnung
- Interdependenz zwischen Inhalt und Umgebung
- Synonymie
- Ist Glück kurz oder von Dauer?
- bonheur vs. joie
- „jardin privatif“ von joie
- bonheur vs. malheur
- Verwendung von bonheur und joie in Umstandsangabe
- avec
- à
- dans
- Des eigenen Glückes Schmied oder dreht sich das Glücksrad?
- Externe vs. interne Welt
- Koordination und Idiome
- Conclusion
- Beispiel-Liste
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Konzeptualisierung der Wörter „bonheur“ und „joie“ im Französischen mithilfe kognitiv-semantischer Methoden zu analysieren und den Grad ihrer Synonymität zu untersuchen. Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Wittgenstein und Lakoff & Johnson.
- Konzeptualisierung von „bonheur“ und „joie“
- Untersuchung der Synonymität zwischen „bonheur“ und „joie“
- Analyse der semantischen Felder und Kollokationen beider Wörter
- Einfluss von Kontext und Umgebung auf die Bedeutung
- Unterscheidung zwischen statischer und dynamischer Konzeption von Glück
Zusammenfassung der Kapitel
Theoretische Einordnung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es basiert auf Wittgensteins Philosophie des Sprachgebrauchs, die besagt, dass die Bedeutung eines Wortes durch seinen Gebrauch in der Sprache bestimmt wird. Der Fokus liegt auf der Interdependenz von Inhalt und Umgebung eines Wortes, wobei die Analyse der Kollokationen im Korpus Le Monde 2002 eine zentrale Rolle spielt. Weiterhin wird der Aspekt der Synonymität zwischen „bonheur“ und „joie“ eingeführt und die methodische Vorgehensweise zur Untersuchung partieller Synonymität erläutert, die auf der Analyse von Bedeutungsunterschieden und -nuancen basiert.
Ist Glück kurz oder von Dauer?: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Konzeptionen von Glück, indem es zwischen einer kurzzeitigen, flüchtigen Erfahrung („Glück empfinden“ im engeren Sinne) und einem dauerhaften Zustand („im Glück leben“) unterscheidet. Es werden Beispiele für beide Varianten angeführt und die verschiedenen Bedeutungsfacetten von „bonheur“ im Französischen beleuchtet, die diese Unterscheidung widerspiegeln. Die Analyse stützt sich auf Definitionen aus dem „Trésor de la langue française“ und der Wikipedia.
Verwendung von bonheur und joie in Umstandsangabe: Dieses Kapitel analysiert den Gebrauch von „bonheur“ und „joie“ in Verbindung mit verschiedenen Präpositionen (avec, à, dans) um die jeweiligen Bedeutungsnuancen und den Kontextgebrauch zu beleuchten. Die detaillierte Untersuchung dieser Kollokationen trägt zum Verständnis der semantischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Wörter bei und vertieft die Analyse der Synonymität. Die unterschiedliche Verwendung verdeutlicht die Feinheiten in der Bedeutung und den Anwendungsbereichen der beiden Konzepte.
Des eigenen Glückes Schmied oder dreht sich das Glücksrad?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der externen und internen Einflussfaktoren auf Glück. Es untersucht die Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt im Kontext des Glücks. Die Analyse von Kollokationen und Idiomen im Zusammenhang mit „bonheur“ und „joie“ liefert Einblicke in die kognitiven Schemata, die unser Verständnis von Glück prägen. Die Unterscheidung zwischen interner und externer Einflussnahme auf die Erfahrung von Glück wird ausführlich beleuchtet und mit Beispielen untermauert.
Schlüsselwörter
bonheur, joie, Synonymität, kognitive Semantik, Kollokationen, Korpusanalyse, Sprachgebrauch, Wittgenstein, Lakoff & Johnson, Glück, Konzeptualisierung, semantische Felder, Partielle Synonymie, Interdependenz, Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von "bonheur" und "joie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konzeptualisierung der französischen Wörter „bonheur“ und „joie“ (Glück und Freude) mithilfe kognitiv-semantischer Methoden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Grades ihrer Synonymität und der Unterschiede in ihrer Bedeutung und Verwendung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Theorien von Wittgenstein (Philosophie des Sprachgebrauchs, Bedeutung durch Gebrauch) und Lakoff & Johnson (kognitive Semantik). Die Analyse berücksichtigt die Interdependenz von Inhalt und Umgebung eines Wortes und untersucht Kollokationen im Korpus Le Monde 2002.
Welche Aspekte der Bedeutung von "bonheur" und "joie" werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Konzeptualisierung beider Wörter, die Untersuchung ihrer Synonymität (inklusive partieller Synonymität und Bedeutungsunterschieden), die Analyse semantischer Felder und Kollokationen, den Einfluss von Kontext und Umgebung auf die Bedeutung und die Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Konzeptionen von Glück.
Wie wird die Synonymität von "bonheur" und "joie" untersucht?
Die Untersuchung der Synonymität basiert auf der Analyse von Bedeutungsunterschieden und -nuancen. Die Arbeit betrachtet, wie die Wörter in verschiedenen Kontexten verwendet werden und welche Bedeutungsnuancen sich daraus ergeben. Die Analyse der Kollokationen (insbesondere mit Präpositionen wie „avec“, „à“, „dans“) spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielen Kollokationen und Korpusanalyse?
Kollokationen (häufige Wortverbindungen) und die Korpusanalyse (Analyse eines großen Textkorpus) sind zentrale Methoden der Untersuchung. Die Analyse von Kollokationen hilft, die semantischen Felder der Wörter zu verstehen und Unterschiede in ihrer Verwendung aufzuzeigen. Der Korpus Le Monde 2002 dient als Datenbasis für die Analyse.
Wie wird die Unterscheidung zwischen kurzfristigem und langfristigem Glück behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einer kurzzeitigen, flüchtigen Erfahrung von Glück („Glück empfinden“) und einem dauerhaften Zustand („im Glück leben“). Es werden Beispiele für beide Varianten angeführt und die verschiedenen Bedeutungsfacetten von „bonheur“ beleuchtet, die diese Unterscheidung widerspiegeln. Definitionen aus dem „Trésor de la langue française“ und der Wikipedia werden herangezogen.
Welche Rolle spielen externe und interne Faktoren im Bezug auf Glück?
Die Arbeit untersucht die externen und internen Einflussfaktoren auf Glück und die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt in diesem Kontext. Die Analyse von Kollokationen und Idiomen liefert Einblicke in die kognitiven Schemata, die unser Verständnis von Glück prägen. Die Unterscheidung zwischen interner und externer Einflussnahme wird ausführlich beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur theoretischen Einordnung, zur Unterscheidung zwischen kurzfristigem und langfristigem Glück, zur Verwendung von „bonheur“ und „joie“ mit verschiedenen Präpositionen, zur Rolle externer und interner Faktoren beim Glück und eine Schlussfolgerung. Zusätzlich gibt es eine Beispiel-Liste und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: bonheur, joie, Synonymität, kognitive Semantik, Kollokationen, Korpusanalyse, Sprachgebrauch, Wittgenstein, Lakoff & Johnson, Glück, Konzeptualisierung, semantische Felder, Partielle Synonymität, Interdependenz, Kontext.
- Quote paper
- Nadine Hemel (Author), 2006, Konzeptualisierung des Referenten von 'bonheur', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/82611