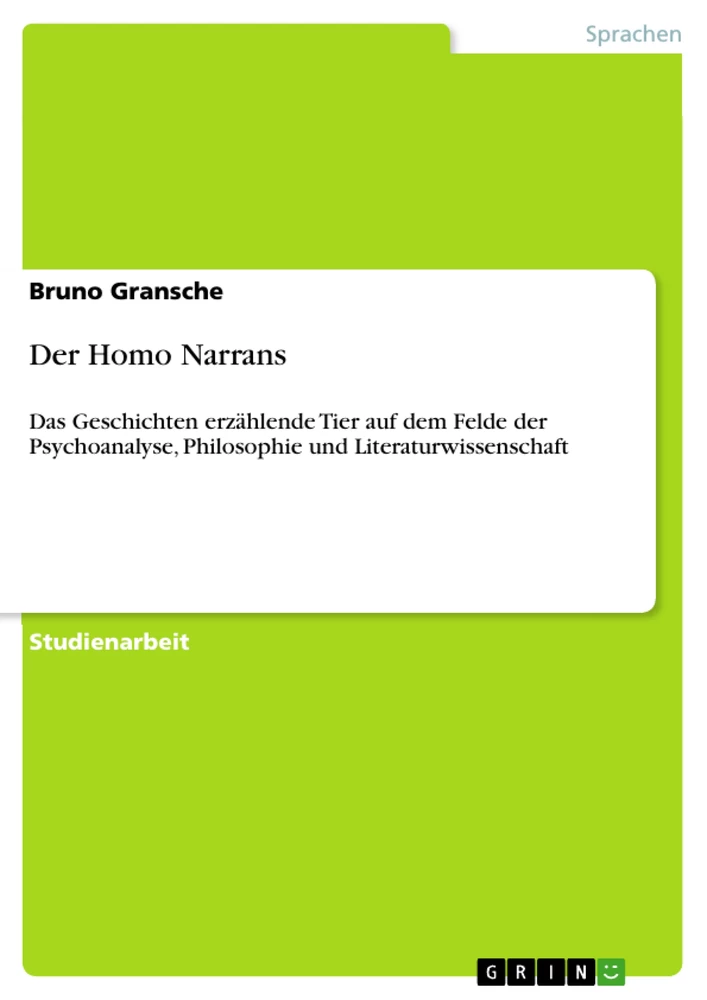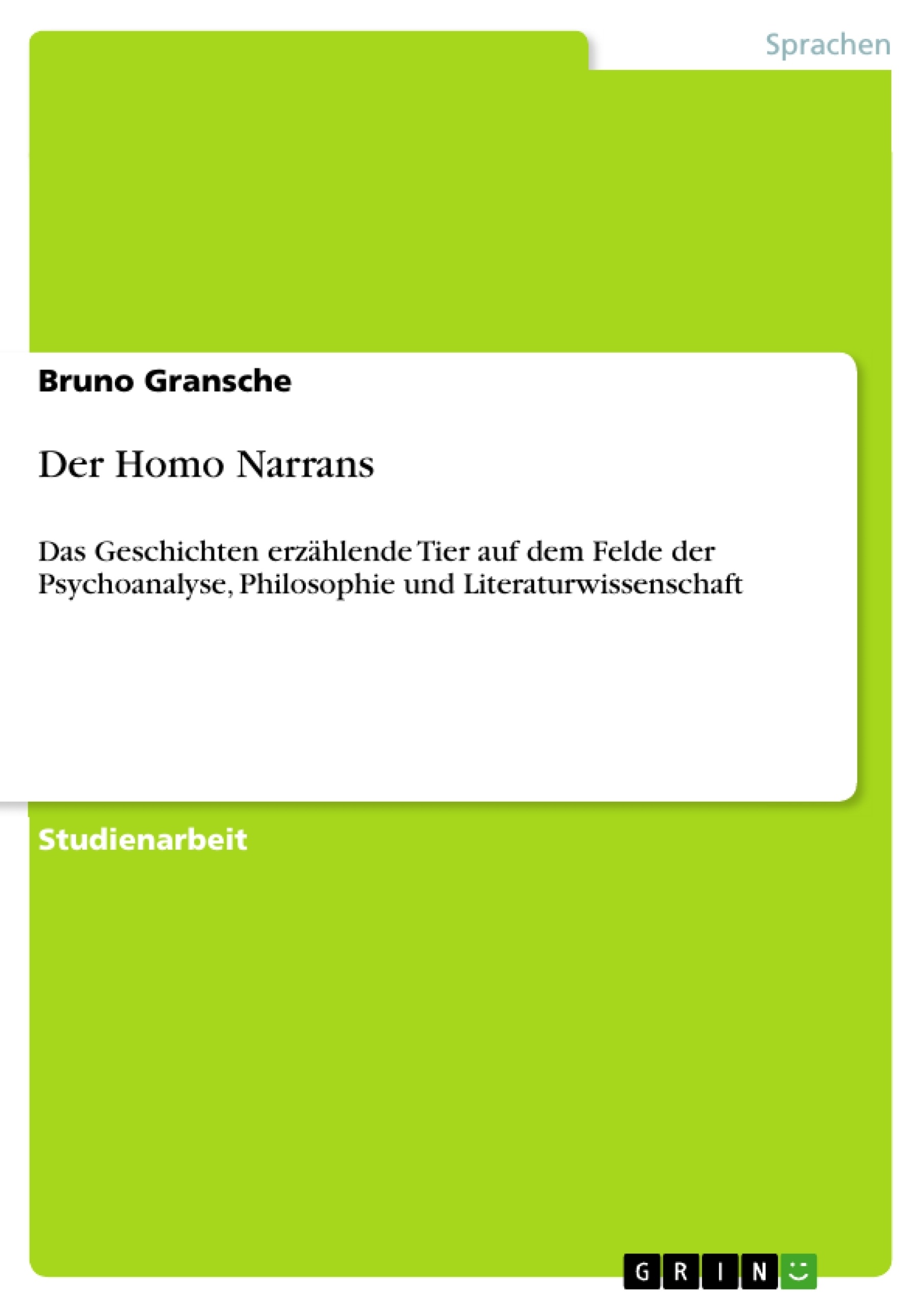Ein vergleichender Blick auf Literaturtheorie und Psychoanalyse lädt dazu ein, Analogien zu ziehen, um somit Erkenntnisse von der einen Wissenschaft auf die anderen übertragen zu können. Besonders über das gemeinsame Medium beider Bereiche, die Sprache, lassen sich interessante Thesen aufstellen.
Erweist sich die These "Literatur ist Symptom und Ursache von Kollektivpsychosen" als tauglich, so lässt sich der Mensch in seinem Wesen als literarisch verfasste Entität verstehen. Dann erwiese sich die Identität des Menschen als in Geschichten verfasst. Das Leben vollzöge sich nach Erzählmustern und folge einer narrativen Ordnung. Gemeinschaften haben so gesehen Teil an Geschichten und jedes Individuum ist nicht nur in seine eigene Geschichte, sondern auch in die Geschichte der anderen verstrickt.
Literatur ist der Ort, wo sich die Kategorien entwickeln, die wiederum das Leben für den Menschen mit Sinn und Einheit versehen. Sowohl für den Psychoanalytiker Jacques Lacan, als auch für den Philosophen Paul Ricœur ist der Mensch existenziell gespalten. Legt man Lacans Theorie des Spiegelstadiums und Ricœurs Ausführungen zur narrativen Identität nebeneinander könnte man formulieren: „Literatur ist der Spiegel, in dem sich der Mensch mit einem Aha Erlebnis jubilatorisch wiedererkennt, sich in ihr entfremdet und schließlich durch die Literatur wieder zur Einheit gelangt.“
Anspruch dieser Arbeit ist es nicht, prototypische Topoi zu analysieren und die latenten Pathologien, die diese indizieren aufzudecken. Vielmehr soll die Möglichkeit einer solchen Untersuchung geprüft werden. Ich frage mich also im Folgenden, ob es überhaupt Sinn hat, die entsprechenden Thesen aufzustellen, ob tatsächlich ein reziproker Zusammenhang zwischen Literatur und Mensch besteht, ob der hier formulierte literarische Subjektivismus dem szientistischen Objektivismus etwas hinzuzufügen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch als homo narrans
- Psychoanalyse als Vergeschichtlichen des Lebens.
- Der Begriff der Geschichte
- Lebenswelt und Geschichten.
- Literarische Produktivität
- Psychoanalytische Sicht auf literarische Produktivität
- Philosophische Sicht auf literarische Produktivität.
- Produktion und Rezeption von Literatur
- Mimesis und Mythos.
- Literatur als Probelaboratorium von Leben und Welt
- Literatur und Kollektivpsychose
- Ausblick
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Literatur und Psychoanalyse und argumentiert, dass Literatur sowohl Symptom als auch Ursache von Kollektivpsychosen sein kann. Sie befasst sich mit dem Konzept des Homo Narrans, dem Geschichten erzählenden Menschen, und analysiert, wie Geschichten die menschliche Identität und das Verständnis der Realität prägen.
- Die Rolle von Geschichten in der menschlichen Existenz
- Der Zusammenhang zwischen Literatur und Kollektivpsychosen
- Die Bedeutung der Sprache in der Psychoanalyse und Literaturtheorie
- Die Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv im Kontext von Geschichten
- Die Einflussfaktoren auf die literarische Produktion und Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Literatur Symptom und Ursache von Kollektivpsychosen ist. Sie erklärt, dass Literatur ein Ort ist, an dem das Erzählrepertoire einer Kulturgemeinschaft gesammelt und verbreitet wird, und dass Kollektivpsychose als Sammelbegriff für psychische Erkrankungen verstanden werden kann, die den Mitgliedern eines Kollektivs gemein sind.
- Der Mensch als homo narrans: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des homo narrans, dem Geschichten erzählenden Menschen. Es erläutert, wie die Psychoanalyse die Geschichte eines Individuums als Indikator für dessen Pathologien betrachtet. Das Kapitel diskutiert auch die Bedeutung der Sprache in der Psychoanalyse und die Beziehung zwischen Lebenswelt und Geschichten.
- Literarische Produktivität: Dieses Kapitel untersucht die psychoanalytische und philosophische Sicht auf literarische Produktivität. Es analysiert, wie Geschichten die menschliche Psyche und das Verständnis der Realität beeinflussen können.
- Produktion und Rezeption von Literatur: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Mimesis und Mythos in der Literatur. Es argumentiert, dass Literatur als ein Probelaboratorium für Leben und Welt betrachtet werden kann, in dem die menschliche Psyche erforscht und dargestellt wird.
- Literatur und Kollektivpsychose: Dieses Kapitel untersucht, wie Literatur Symptome und Ursachen von Kollektivpsychosen sein kann. Es befasst sich mit der Bedeutung der Sprache in der Konstruktion von Identitäten und Realitätsvorstellungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Psychoanalyse, Literaturtheorie, Homo Narrans, Kollektivpsychose, Mimesis, Mythos, Lebenswelt, Sprache, Identität, Realitätsbezug und literarische Produktion und Rezeption.
- Arbeit zitieren
- Bruno Gransche (Autor:in), 2007, Der Homo Narrans, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/82032