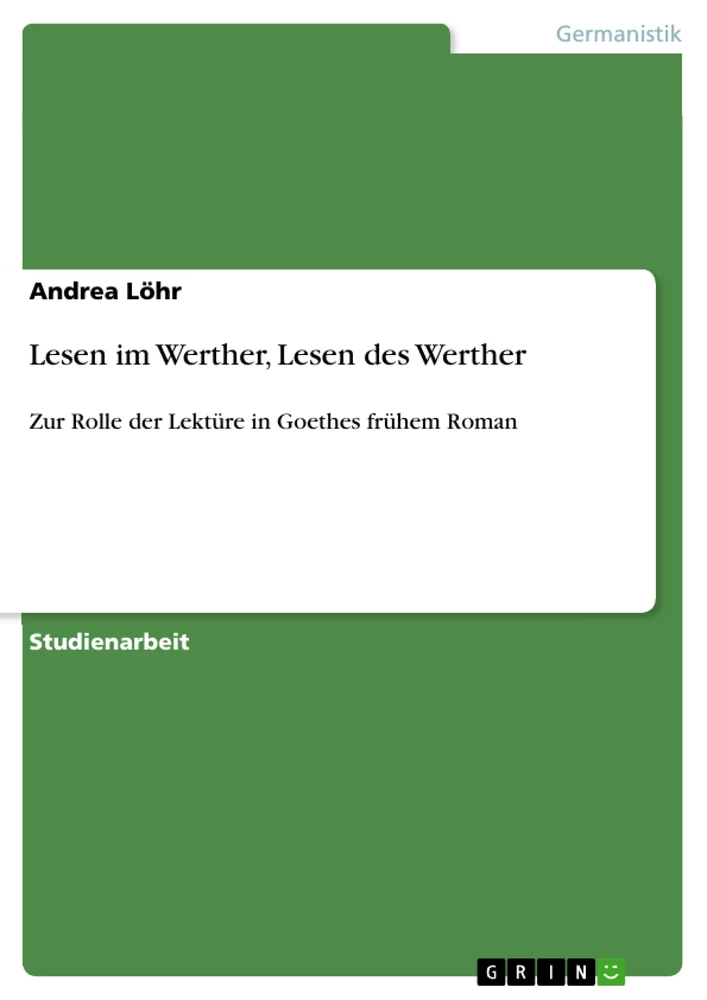Die erste Fassung von Goethes Werther erschien 1774. In dieser Zeit vollzog sich im Bürgertum ein Wandel in der Art des Lesens sowie der Art der Lektüre. Bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde ‚intensiv’ gelesen. Das heisst, es wurden hauptsächlich religiöse Texte wie die Bibel sowie erbauliche Literatur gelesen. Man beschränkte sich auf einen Kanon bestimmter Lektüre und gab diesen Kanon von Generation zu Generation weiter. Man las die Bücher nicht nur einmal, sondern immer wieder, sodass man Passagen daraus rezitieren konnte.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann sich das Leseverhalten zu ändern, es wurde ‚extensiv’ gelesen. Das heißt, der Kanon wurde erweitert, man las nicht mehr ausschließlich Erbauliches sondern auch „bildende und belletristische Aufklärungsliteratur.“ Das Leseverhalten änderte sich dahingehend, dass man nicht mehr wenige Bücher mehrmals las, sondern möglichst viele Bücher und diese nur einmalig, sodass man mehr Zeit hatte für die Neuerscheinungen.
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Leseverhalten, welches die Figuren im Werther auf ihre Lektüre anwenden. Dabei werde ich im Besonderen auf die Klopstockstelle, sowie auf die Bedeutung des Homer und des Ossian für Werther eingehen.
Des Weiteren werde ich erläutern, in wieweit sich das Lektüremodell des Vorwortes sowie der Hauptfiguren Werther, Lotte und Albert unterscheiden und welche unterschiedlichen Funktionen die Literatur für diese Figuren hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung – intensives vs. extensives Lesen im 18. Jahrhundert
- Lektüre im Werther
- Klopstock
- Homer und das Patriarchat
- Ossian
- Lektüremodelle im Werther
- Lektüremodell im Vorwort...
- Lektüremodell des Werther.
- Lottes Lektüremodell
- Alberts Leseverhalten...
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Lektüre im Werther und analysiert, wie das Leseverhalten der Figuren in Goethes Roman ihren Umgang mit Literatur und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Bedeutung von Klopstocks „Frühlingsfeier“ für Werther und Lotte, sowie mit dem Einfluss klassischer Werke wie Homer und Ossian.
- Der Wandel vom intensiven zum extensiven Lesen im 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Lektüre für die Figuren im Werther
- Die unterschiedlichen Lektüremodelle von Werther, Lotte und Albert
- Der Einfluss von Klopstock, Homer und Ossian auf die Figuren
- Die Funktion von Literatur als Ausdruck von Gefühlen und Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung – Intensives vs. extensives Lesen im 18. Jahrhundert
Das Kapitel beschreibt den Wandel des Leseverhaltens im 18. Jahrhundert vom intensiven Lesen religiöser und erbaulicher Texte zum extensiven Lesen einer breiteren Palette von Literatur, darunter belletristische Aufklärungsliteratur. Es zeigt auf, dass sich die Art des Lesens und die Art der Lektüre in dieser Zeit grundlegend veränderten.
Lektüre im Werther
2.1 Klopstock
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung von Klopstocks Oden im Kontext der Beziehung zwischen Werther und Lotte. Die bloße Nennung von Klopstocks Namen durch Lotte während eines Gewitters genügt, um eine tiefe emotionale Verbindung zwischen den beiden Figuren herzustellen.
2.2 Homer und das Patriarchat
[Zusammenfassung des Kapitels über Homers Einfluss auf die Figuren im Werther]
2.3 Ossian
[Zusammenfassung des Kapitels über Ossians Einfluss auf die Figuren im Werther]
Lektüremodelle im Werther
[Zusammenfassungen der Kapitel über die Lektüremodelle von Werther, Lotte und Albert]
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Lektüre, Leseverhalten, Werther, Klopstock, Homer, Ossian, Literatur, Empfindung, Beziehung, Lektüremodell, 18. Jahrhundert, Belletristik, Aufklärungsliteratur.
- Arbeit zitieren
- Andrea Löhr (Autor:in), 2007, Lesen im Werther, Lesen des Werther, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/81961