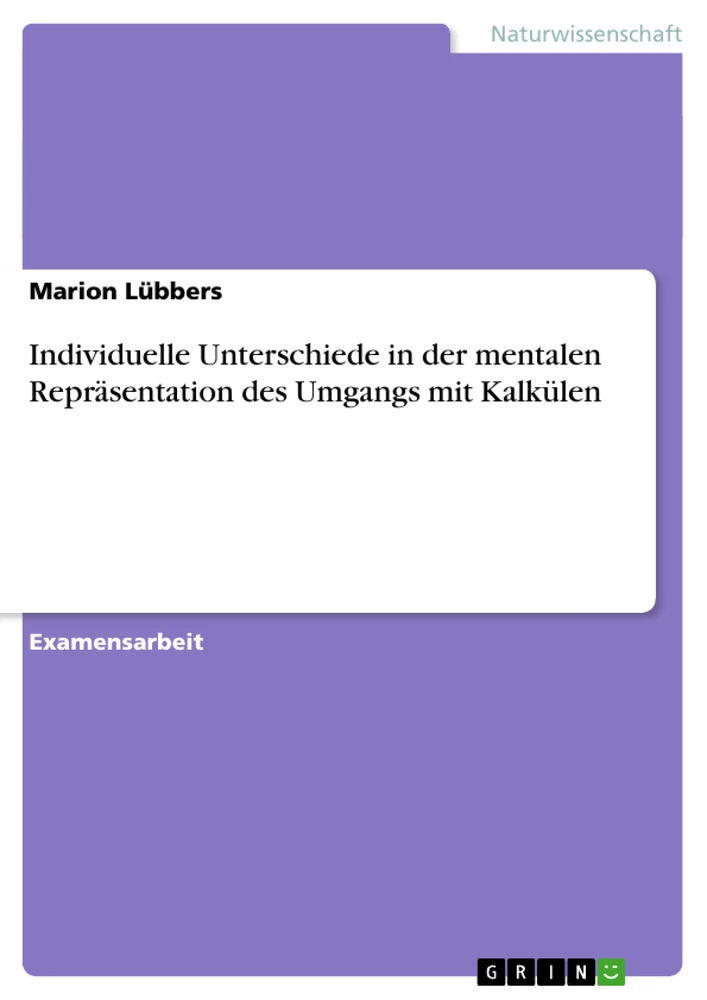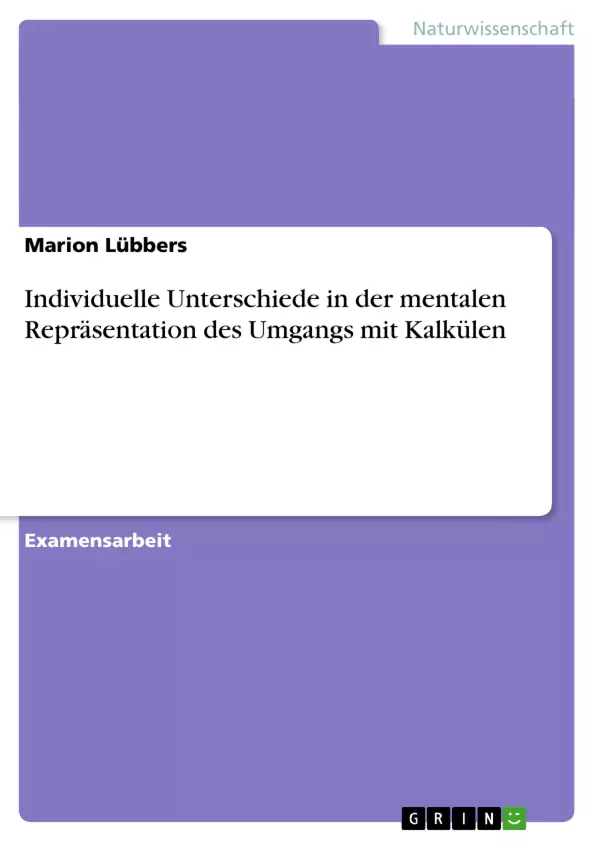Einleitung
In der (Schul-)Algebra ist die zentrale mathematische Technik der Termumformung immer wieder Ursprung zahlreicher Schülerschwierigkeiten und –fehler. In der vorliegenden Arbeit sollen die mentalen Prozesse, die bei Termumformungen ablaufen, untersucht werden. Unter dem Aspekt der mathematischen Grundlagenforschung soll analysiert werden, wie sich Unterschiede in den von Schwank postulierten kognitiven Strukturen in Unterschieden mentaler Repräsentationen (statisch versus prozeßorientiert) von Formelmanipulationen niederschlagen. Die dazu durchgeführte Untersuchung ist eine Pilotstudie im Rahmen des DFG-Projektes „Individuelle Unterschiede in der mentalen Repräsentation von Termumformungen (IRT)“.
Wie bereits erwähnt, wird in dieser Arbeit auf die Theorie von Schwank Bezug genommen, in der zwischen einer prädikativen und funktionalen kognitiven Struktur unterschieden wird; diese Theorie wird im zweiten Kapitel ausführlich erläutert werden. Im Unterabschnitt „Mathematische Grundlagen“ werden die objekt- und metasprachlichen Kalküle, die den Untersuchungsaufgaben zugrunde liegen, vorgestellt und vom mathematischen Standpunkt aus betrachtet werden.
Im dritten Kapitel werde ich die experimentelle Durchführung der Untersuchung beschreiben. Ausgenommen davon ist die Vorstellung des Untersuchungsmaterials, dem im vierten Kapitel „Aufgaben“ gesondert Platz eingeräumt werden wird. Wegen des explorativen Charakters der Untersuchung wurde viel Wert auf die Analyse der Untersuchungsaufgaben gelegt. Die in dieser Studie gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und Wirkung von Untersuchungsaufgaben sollen in weitere Untersuchungen und in die Hauptuntersuchung gewinnbringend eingebracht werden können.
Die Auswertung der Untersuchung wird in einen qualitativen und einen quantitativen Teil unterschieden werden. Im fünften Kapitel sollen qualitativ, anhand der verbalen Äußerungen und der Vorgehensweise der Versuchspersonen bei der Lösungsfindung, die individuellen Unterschiede in der mentalen Repräsentation aufgezeigt werden. Das sechste Kapitel wird sich mit der quantitativen Auswertung der Untersuchung beschäftigen. Dort wird berichtet werden, inwiefern Lösungszeiten einzelner Aufgaben sowie Art und Häufigkeit der benutzten Formeln sich als Indikator für die kognitive Struktur der Versuchsperson eignen.
Im siebten Kapitel soll ein kurzes Fazit der Untersuchung gezogen und zukünftige Entwicklungsrichtungen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Die Theorie in Analogie zur mathematischen Logik
- Prädikative versus funktionale kognitive Struktur
- Resonanzthese: Resonanz zwischen äußerer Repräsentation und mentaler Repräsentation
- Mathematische Grundlagen: Kalküle
- Experimentelle Durchführung
- Ziel der Untersuchung
- Auswahl der Versuchspersonen
- Beschreibung des Versuchsablaufs
- Zur Versuchsanleitung
- Hilfestellungen
- Untersuchungsmaterial
- Das Programm
- Implementierung der Aufgaben
- Bildschirmaufbau und Bedienung des Programms
- Protokollierung
- Das Programm
- Einsatz von Datenbanken
- Aufgaben
- Musterergänzungsaufgaben
- Objektsprachliche Aufgaben
- Aufgabe mit prädikativem und funktionalem Lösungsweg
- Aufgabe mit Vorteilen für einen Denktyp
- „Darstellungs“-Aufgabe
- Beweisaufgabe
- Metasprachliche Aufgaben
- Umgang mit metasprachlichen Regeln
- Verschiedene „Schwierigkeitsstufen“ von metasprachlichen Regeln
- Zur Konstruktion der Termumformungsaufgaben
- Qualitative Auswertung
- Auswertung der Musterergänzungsaufgaben
- Diagnosebeispiel 1
- Diagnosebeispiel 2
- Diagnosebeispiel 3
- Bevorzugte kognitive Strukturen der Versuchspersonen
- Analyse einer objektsprachlichen Aufgabe
- Anlass
- Mögliche Lösungswege
- Idee der Aufgabe
- Ergebnis
- Transkripte von Julia und Lara
- Beschreibung und Analyse der Vorgehensweise
- Beweisaufgabe
- „Darstellungs“-Aufgabe
- Analyse einer metasprachlichen Aufgabe
- Anlass
- Möglicher Lösungsweg
- Schwierigkeit der Aufgabe
- Transkripte von Christina und Gaby
- Beschreibung und Analyse der Vorgehensweise
- Ergebnis
- Vorlieben der Versuchspersonen
- Auswertung der Musterergänzungsaufgaben
- Quantitative Auswertung
- Häufigkeit der Benutzung prädikativer und funktionaler Regeln
- Lösungszeiten der objekt- und metasprachlichen Aufgaben
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Individuelle Unterschiede in der mentalen Repräsentation des Umgangs mit Kalkülen“ befasst sich mit der Untersuchung der mentalen Prozesse, die bei Termumformungen in der (Schul-)Algebra ablaufen. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Unterschiede in der kognitiven Struktur von Versuchspersonen, wie sie von Schwank postuliert werden, und deren Auswirkungen auf die mentale Repräsentation von Formelmanipulationen. Die Arbeit ist als Pilotstudie im Rahmen eines DFG-Projektes zu verstehen und soll Erkenntnisse liefern, die in weitere Untersuchungen eingebracht werden können.
- Die Theorie von Schwank und die Unterscheidung zwischen prädikativer und funktionaler kognitiver Struktur
- Die Rolle der mentalen Repräsentation bei der Termumformung
- Die Analyse von objektsprachlichen und metasprachlichen Kalkülen
- Die qualitative und quantitative Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- Die Identifizierung von individuellen Unterschieden in der mentalen Repräsentation von Termumformungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert das Ziel der Untersuchung: Die Analyse der mentalen Prozesse, die bei Termumformungen ablaufen, unter dem Aspekt der Unterschiede in der kognitiven Struktur von Versuchspersonen. Das zweite Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen, insbesondere die Theorie von Schwank und die Unterscheidung zwischen prädikativer und funktionaler kognitiver Struktur. Es werden außerdem die objekt- und metasprachlichen Kalküle, die den Untersuchungsaufgaben zugrunde liegen, vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die experimentelle Durchführung der Untersuchung beschrieben, einschließlich der Auswahl der Versuchspersonen, des Versuchsablaufs, der Versuchsanleitung und der Hilfestellungen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Vorstellung des Untersuchungsmaterials, den Aufgaben, die in Musterergänzungsaufgaben, objektsprachliche Aufgaben und metasprachliche Aufgaben unterteilt sind.
Die qualitative Auswertung der Untersuchung wird im fünften Kapitel vorgestellt. Hier werden anhand der verbalen Äußerungen und der Vorgehensweise der Versuchspersonen bei der Lösungsfindung die individuellen Unterschiede in der mentalen Repräsentation aufgezeigt. Kapitel sechs beschäftigt sich mit der quantitativen Auswertung, bei der Lösungszeiten einzelner Aufgaben sowie Art und Häufigkeit der benutzten Formeln analysiert werden, um Aussagen über die kognitive Struktur der Versuchspersonen zu treffen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der mentalen Repräsentation, kognitiver Strukturen, Termumformungen, Kalküle, objektsprachliche Aufgaben, metasprachliche Aufgaben, qualitative und quantitative Auswertung, sowie individuellen Unterschieden in der mentalen Repräsentation.
- Quote paper
- Marion Lübbers (Author), 1999, Individuelle Unterschiede in der mentalen Repräsentation des Umgangs mit Kalkülen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80436