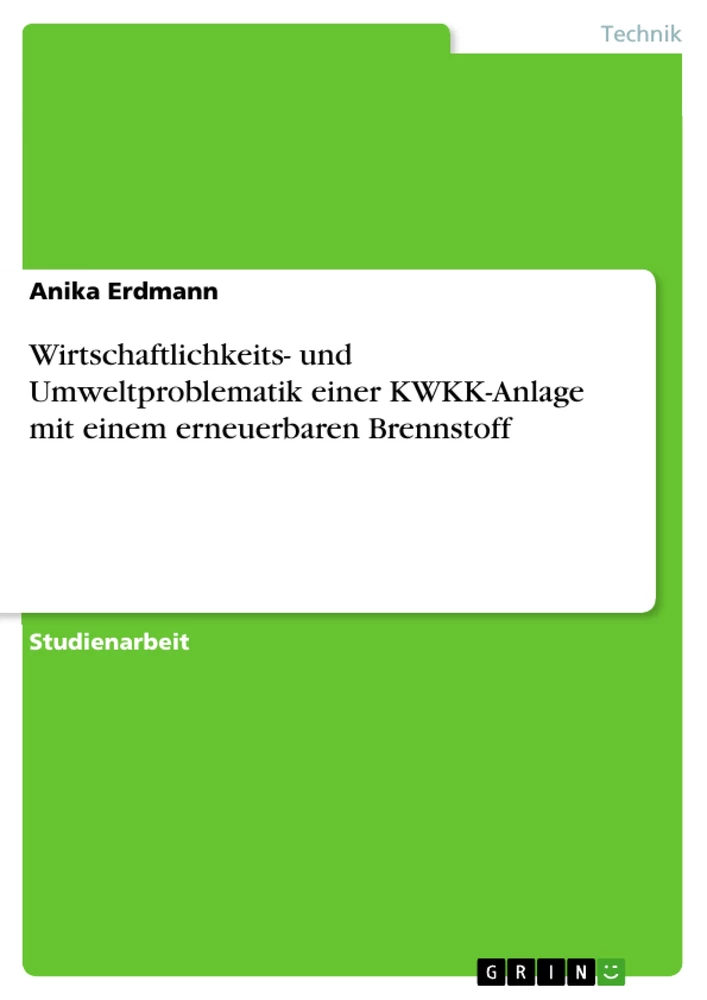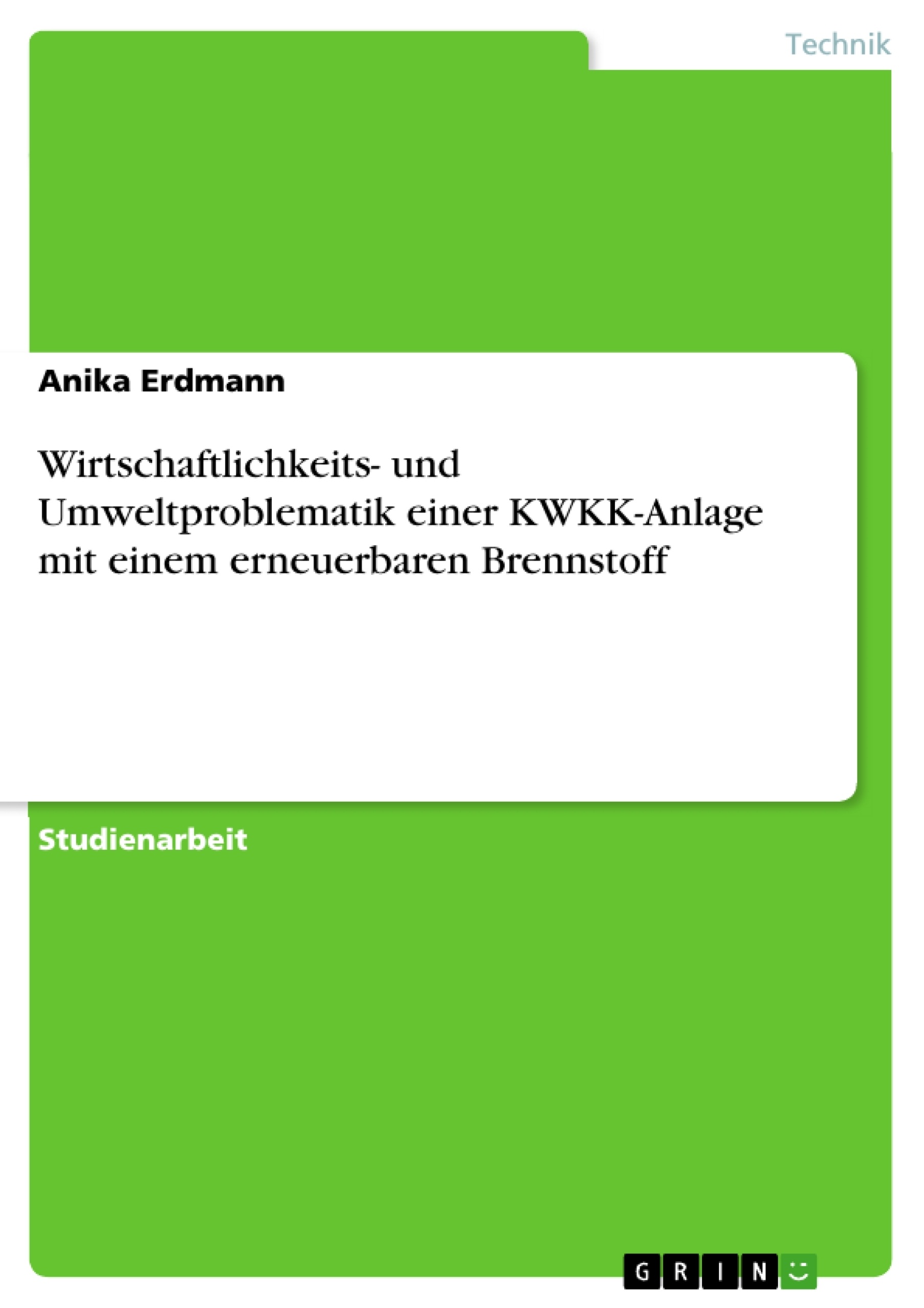Durch das Erzeugen von mechanischer Energie mittels Verbrennung von Energieträgern entsteht in der Regel ein großes Wärmepotenzial, welches bei der Stromerzeugung in heutigen konventionellen Kraftwerken häufig ungenutzt bleibt. Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) zeichnen sich dagegen durch eine besonders rationelle Energieumwandlung aus, was sich in bedeutend höheren Wirkungsgraden widerspiegelt. Die gekoppelte Produktion von Nutzwärme und Elektrizität ermöglichen zudem eine zukünftige Reduktion der Kohlendioxidemissionen, die in Deutschland zurzeit zu einem großen Teil aus dem Betrieb von fossil befeuerten Stromerzeugungsanlagen herrühren. ,
Im Laufe der vergangenen Jahre ist die Bedeutung der KWKK stark gestiegen. Dies ist damit zu begründen, dass Verbrauchsspitzen an elektrischer Energie nicht mehr vorwiegend in der kalten Jahreszeit durch den Heizbedarf auftreten, sondern vermehrt auch im Sommer durch die steigende Zahl an Kälteversorgungsanlagen wie sie beispielsweise in Kühlhäusern, Datenverarbeitungsanlagen, Kaufhäusern und Büroräumen vorhanden sind. Durch das Prinzip der KWKK können also im Sommer sowohl der Bedarf an elektrischer Energie zur Klimatisierung reduziert als auch das Wärmeversorgungsnetz besser ausgelastet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Analyse der aktuellen Situation
- 1.2 Aufgabenformulierung
- 2 Analyse der Rahmenbedingungen
- 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen
- 2.1.1 KWK-G 2002
- 2.1.2 EEG 2004 und der Ausbau erneuerbarer Energien
- 2.1.3 Entwicklung der Energieträgerpreise
- 2.2 Technische Rahmenbedingungen
- 2.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen
- 3 Technologie der KWK
- 3.1 Funktionsweise der KWK
- 3.2 KWK-Anlagen nach dem KWK-G 2002
- 3.3 Brennstoffe nach dem KWK-G 2002
- 3.4 Stromkennzahl
- 4 Technologie der KWKK
- 4.1 Absorptionskältemaschine
- 4.1.1 Anlagentypen
- 4.1.2 Funktion
- 4.1.3 Eigenschaften
- 4.2 Adsorptionskältemaschine
- 4.3 Gegenüberstellung der Kälteanlagen
- 4.4 DEC Prozess
- 4.1 Absorptionskältemaschine
- 5 Wirtschaftlichkeitsproblematik
- 5.1 Förderung durch das KWK-G 2002
- 5.1.1 Anschlusspflicht
- 5.1.2 Kategorien zuschlagsberechtigter KWK-Anlagen
- 5.1.3 Vergütung und Zuschläge
- 5.1.3.1 Vergütung
- 5.1.3.2 Zuschlag
- 5.1.3.3 Grenzen für Zuschlagszahlung
- 5.2 Förderung durch das EEG 2004
- 5.2.1 Vergütung für Strom aus Deponiegas, Klärgas und Grubengas
- 5.2.2 Vergütung für Strom aus Biomasse
- 5.2.3 Vergütung für Strom aus Geothermie
- 5.3 Überschneidungen von KWK-G und EEG
- 5.3.1 Deponie-, Klär- und Grubgengas
- 5.3.2 Biomasse Fall 1
- 5.3.3 Biomasse Fall 2
- 5.4 Förderung durch die KfW
- 5.5 Vergütung der vermiedenen Netznutzungskosten
- 5.6 Ansatz zur Kostenbeurteilung einer KWKK-Anlage
- 5.1 Förderung durch das KWK-G 2002
- 6 Umweltproblematik
- 6.1 Belastung durch konventionelle Kraftwerke und KWK-Anlagen
- 6.2 Belastung durch Kälteanlagen
- 6.2.1 Ammoniak
- 6.2.2 Sonstige Kältemittel
- 6.3 Bio-Brennstoffe
- 6.4 Emissionshandel
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse einer KWKK-Anlage, die mit einem erneuerbaren Brennstoff betrieben wird. Ziel ist es, die energiepolitischen Rahmenbedingungen, die technologischen Möglichkeiten sowie die wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte des Betriebs einer solchen Anlage zu beleuchten. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und berücksichtigt die relevanten Gesetzgebungen wie das KWK-G 2002 und das EEG 2004.
- Energiepolitische Rahmenbedingungen: KWK-G 2002 und EEG 2004
- Technologische Möglichkeiten: Funktionsweise von KWK und KWKK-Anlagen
- Wirtschaftlichkeitsproblematik: Förderungsmöglichkeiten und Kostenbeurteilung
- Umweltproblematik: Belastung durch konventionelle Kraftwerke, Kälteanlagen und Bio-Brennstoffe
- Emissionshandel und seine Bedeutung für KWKK-Anlagen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Arbeit ein und analysiert die aktuelle Situation der Energieversorgung in Deutschland. Dabei werden die Vorteile von KWK- und KWKK-Anlagen im Hinblick auf die Effizienz und den Umweltschutz hervorgehoben. Kapitel 2 behandelt die energiepolitischen Rahmenbedingungen, die den Betrieb von KWKK-Anlagen beeinflussen. Hierbei werden insbesondere das KWK-G 2002 und das EEG 2004 beleuchtet. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Technologie der KWK und geht dabei auf die Funktionsweise, die verschiedenen Anlagentypen und die möglichen Brennstoffe ein. Kapitel 4 erläutert die Funktionsweise der Absorptionskältemaschine und gibt einen Überblick über die verschiedenen Anlagentypen und deren Eigenschaften. Kapitel 5 analysiert die Wirtschaftlichkeitsproblematik von KWKK-Anlagen und untersucht die Fördermöglichkeiten durch das KWK-G 2002 und das EEG 2004. Kapitel 6 befasst sich mit der Umweltproblematik von KWKK-Anlagen, wobei die Belastung durch konventionelle Kraftwerke, Kälteanlagen und Bio-Brennstoffe sowie der Emissionshandel im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK), erneuerbare Brennstoffe, energiepolitische Rahmenbedingungen, KWK-G 2002, EEG 2004, Wirtschaftlichkeit, Umweltproblematik, Emissionshandel, Bio-Brennstoffe, Absorptionskältemaschine.
- Arbeit zitieren
- Anika Erdmann (Autor:in), 2006, Wirtschaftlichkeits- und Umweltproblematik einer KWKK-Anlage mit einem erneuerbaren Brennstoff, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/78044