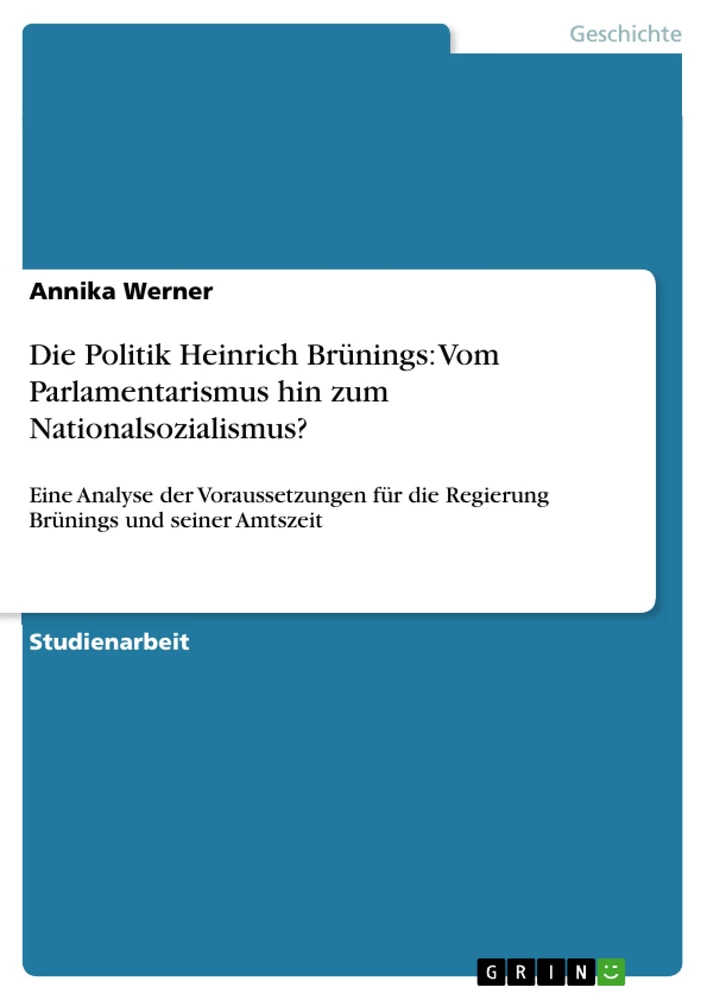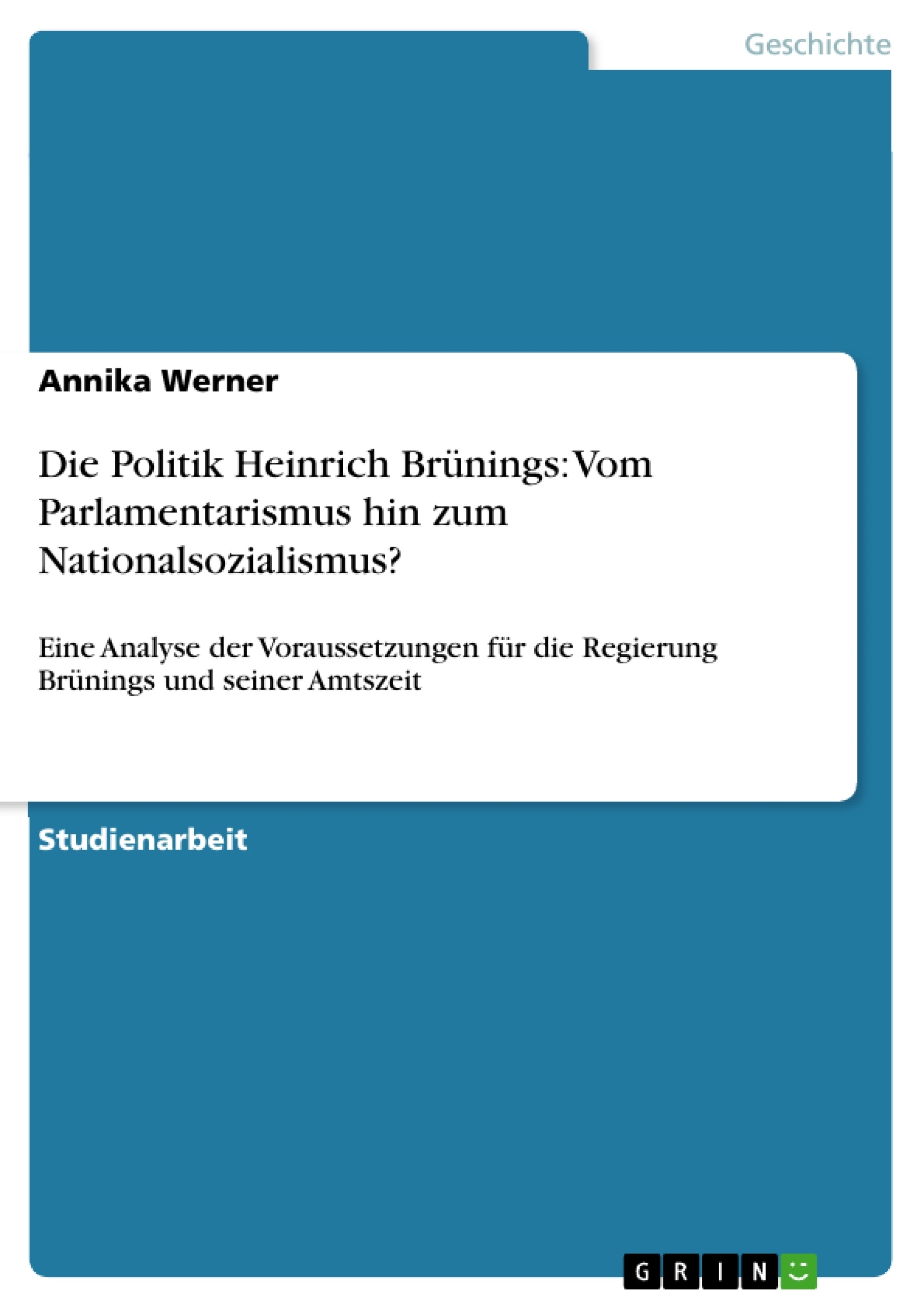Durch die Staatsführung Brünings kam es zu einer Ausarbeitung der Präsidialherrschaft. Es entstand eine Machtveränderung, weg vom Parlamentarismus hin zur Präsidialgewalt. Der Reichstag verlor an Funktion, zum Beispiel aufgrund der Verlagerung der Handlungskompetenzen zu den außerparlamentarischen Machtträgern (Bürokratie und Reichswehr). Außerdem wurde die Gesellschaft durch Brünings Art der Regierung an „diktatorische Maßnahmen und Regelungen“ angepasst.
Durch die Deflationspolitik intensivierte sich die ökonomische Krisensituation. Der Radikalismus wurde durch die stetige Zunahme der Arbeitslosigkeit gefördert. Im Frühjahr 1932 waren es 6. Millionen Arbeitslose. Der Nationalsozialismus verbreitete sich, da die Regierung Brüning nichts gegen sie unternahm. „Brüning verstand die Hitler-Bewegung als parlamentarische Opposition, als berechenbares, als für außenpolitische Zwecke nützliches „nationales“ Potential, dem er positiven Stellenwert in der schicksalhaft empfundenen „Reinigungskrise“ beimaß.“
Als „Triumph“ der Außenpolitik Brünings kann die Aufhebung der Reparationszahlungen, die auf der Konferenz in Lausanne (16. Juni bis 9. Juli 1932) beschlossen wurden, bezeichnet werden. Diese werden aber im Allgemeinen nicht mehr der Regierung Brüning zugesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Wissenschaft und Diskussion über Brünings Ära
- Politische Ausgangssituation und Entwicklung Brünings
- Brünings politische Laufbahn
- Heinrich Brünings politische Entwicklung 1929/1930
- Die politische Intention Brünings
- Das Regierungsprogramm von Heinrich Brüning
- Heinrich Brünings Amtszeit
- Resultate der Politik Brünings
- Schlusswort
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Politik Heinrich Brünings in der Weimarer Republik und untersucht, inwiefern seine Regierungszeit den Weg zum Nationalsozialismus ebnete. Insbesondere soll die Frage beantwortet werden, ob Brünings Politik eine bewusste Abkehr vom Parlamentarismus hin zum Präsidialsystem darstellte und welche Voraussetzungen die Berufung Brünings zum Reichskanzler schufen.
- Die politische und wirtschaftliche Situation Deutschlands in den späten 1920er Jahren
- Die politische Laufbahn und Ideologie Heinrich Brünings
- Die Regierungsprogramme und Politik des Kabinetts Brüning
- Die Folgen von Brünings Politik für das politische System der Weimarer Republik
- Die Rolle des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg in der Regierungszeit Brünings
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das erste Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung zu Heinrich Brünings Regierungszeit und den Kontroversen um seine Rolle im Übergang vom Parlamentarismus zum Nationalsozialismus. Die Arbeit stellt die gegensätzlichen Perspektiven von Werner Conze und Karl Dietrich Bracher dar, die jeweils die Politik Brünings als Versuch einer Rettung der Demokratie bzw. als ersten Schritt im Auflösungsprozess der Weimarer Republik interpretieren. Auch der Wert von Heinrich Brünings Memoiren wird in diesem Kapitel diskutiert.
Politische Ausgangssituation und Entwicklung Brünings
Das zweite Kapitel befasst sich mit der politischen Laufbahn und Entwicklung Heinrich Brünings. Es geht insbesondere auf seine politische Sozialisation, seine Zeit in England und seine Kriegsteilnahme ein. Das Kapitel beleuchtet auch Brünings politische Haltung und sein Verhältnis zu Personen wie Hindenburg, Groener und Schleicher.
- Quote paper
- Annika Werner (Author), 2007, Die Politik Heinrich Brünings: Vom Parlamentarismus hin zum Nationalsozialismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76543