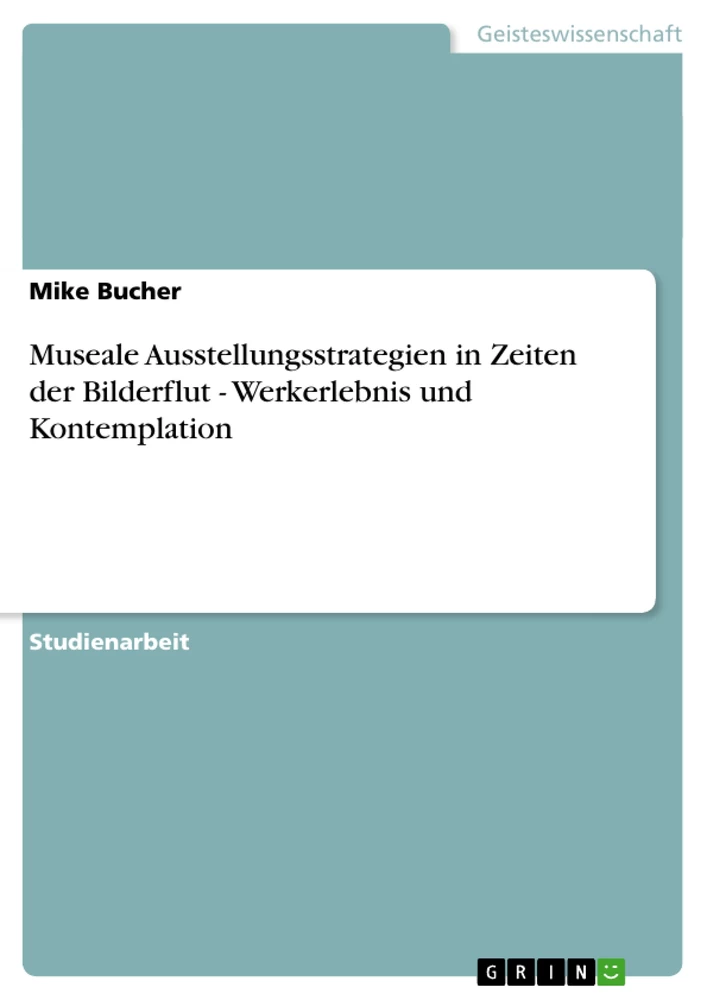Die Menschen gehen heutzutage mit Bildern ganz anders um, als noch vor 100 Jahren. Schlagwörter wie Reizüberflutung oder Reizübersättigung deuten auf eine eigentliche Überforderung des urbanen Menschen angesichts des inszenierten Spektakels hin. In Anbetracht der Tatsache, dass oftmals selbst grausamste Darstellungen – etwa in der Kriegsberichterstattung – bei vielen Rezipienten kaum mehr Emotionen auslösen, ist sogar davon die Rede, dass die Menschen ihre eigentliche Sehfähigkeit verloren haben.
Es stellt sich also die Frage, wie die Museen mit dieser Herausforderung umgehen. In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass die modernen Strategien der Bildpräsentation, deren sich Museen bedienen, als eine Reaktion auf das Phänomen der Bilderflut verstanden werden können. Die aufzuzeigende Tendenz von traditionellen Strategien der Bildvermittlung hin zu einer mehr auf eine direkte Bilderfahrung abzielende Strategie der Werkpräsentation wird dabei als ein Indiz für diese These angesehen. Die Arbeit beginnt deshalb mit einem Blick in die Vergangenheit: Im ersten Kapitel wird die historische Entwicklung der musealen Bildpräsentation skizziert. Bevor im dritten Kapitel dann das Werkerlebnis als aktuellste Form musealer Inszenierung näher vorgestellt wird, soll zuvor die Ausführungen eines Künstlers vorgestellt werden, der sich intensiv mit der Frage der Kunstwahrnehmung und ihrer räumlichen Umgebung auseinander gesetzt hat. Dieser Abschnitt über Rémy Zaugg und sein erträumtes Museum bildet die Überleitung zum Werkerlebnis. Anschliessend wird der Aspekt der Selbstdefinition der Museen ins Spiel gebracht. Hier wird es um ihre Verordnung auf der Achse zwischen den beiden Polen Bildung und Unterhaltung gehen. Im letzten Kapitel werden die verschiedenen Fäden dann wieder zusammengebracht. Anhand eines konkreten Beispiels wird aufgezeigt, wie eine umfassende Strategie im Umgang mit den Herausforderungen des Phänomens der Bilderflut aussehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im historischen Rückblick
- Hängung nach Schulen
- Hängung nach Bewegungen
- Die weisse Zelle
- Rémy Zaugg und der ideale Kunstraum
- Zauggs Ort des Werkes und Menschen
- Das Werkerlebnis
- Museen zwischen Bildung und Unterhaltung
- Ein Beispiel: Die Tate Modern
- Die Ausstellungssituation in der Tate Modern
- Das Museum, das Zaugg sich erträumte?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Veränderung der musealen Bildpräsentation in Reaktion auf das Phänomen der Bilderflut. Der Autor analysiert die historische Entwicklung der Ausstellungsstrategien und beleuchtet die aktuelle Tendenz hin zu einer auf Werkerlebnis fokussierten Bildpräsentation.
- Historische Entwicklung der musealen Bildpräsentation
- Die Rolle des White Cubes in der modernen Kunst
- Die kontemplative Kunstbetrachtung als zentrales Element des Werkerlebnisses
- Der Wandel von Bildung zu Unterhaltung in Museen
- Die Tate Modern als Beispiel einer modernen Ausstellungsstrategie
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die historische Entwicklung der musealen Bildpräsentation skizziert. Es werden verschiedene Hängungsprinzipien, wie die Hängung nach Schulen und die Hängung nach Bewegungen, beleuchtet. Der zweite Teil befasst sich mit dem White Cube als dominierender Ausstellungsraum und zeigt dessen Relevanz für die moderne Kunst auf. Im dritten Kapitel werden die Ideen des Schweizer Künstlers Rémy Zaugg zum idealen Kunstraum präsentiert. Zaugg plädiert für einen Raum, der eine ungestörte und kontemplative Begegnung zwischen Mensch und Werk ermöglicht. Kapitel 4 widmet sich dem Werkerlebnis als aktuellste Form der musealen Inszenierung. Der Autor zeigt auf, dass diese Form der Präsentation darauf abzielt, den Betrachter in eine Situation zu versetzen, die in ihm eine konzentrierte Bilderfahrung bewirkt. Im fünften Kapitel wird die Verortung von Museen zwischen Bildung und Unterhaltung beleuchtet. Der Autor argumentiert, dass die wachsende Bedeutung der Unterhaltung im Museumsbereich eine Folge des gestiegenen Anspruchs der Besucher an den Erlebniswert von Freizeittätigkeiten ist. Im sechsten Kapitel wird die Tate Modern als Beispiel einer umfassenden Ausstellungsstrategie analysiert. Der Autor untersucht die spezifischen architektonischen Merkmale der Tate Modern und stellt die Frage, inwiefern das Museum dem von Zaugg entworfenen Idealbild des Museums gerecht wird.
Schlüsselwörter
Museale Bildpräsentation, Bilderflut, Werkerlebnis, White Cube, Rémy Zaugg, Tate Modern, Bildung, Unterhaltung, Kunstgeschichte, Kontemplation
- Arbeit zitieren
- Mike Bucher (Autor:in), 2007, Museale Ausstellungsstrategien in Zeiten der Bilderflut - Werkerlebnis und Kontemplation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/72491