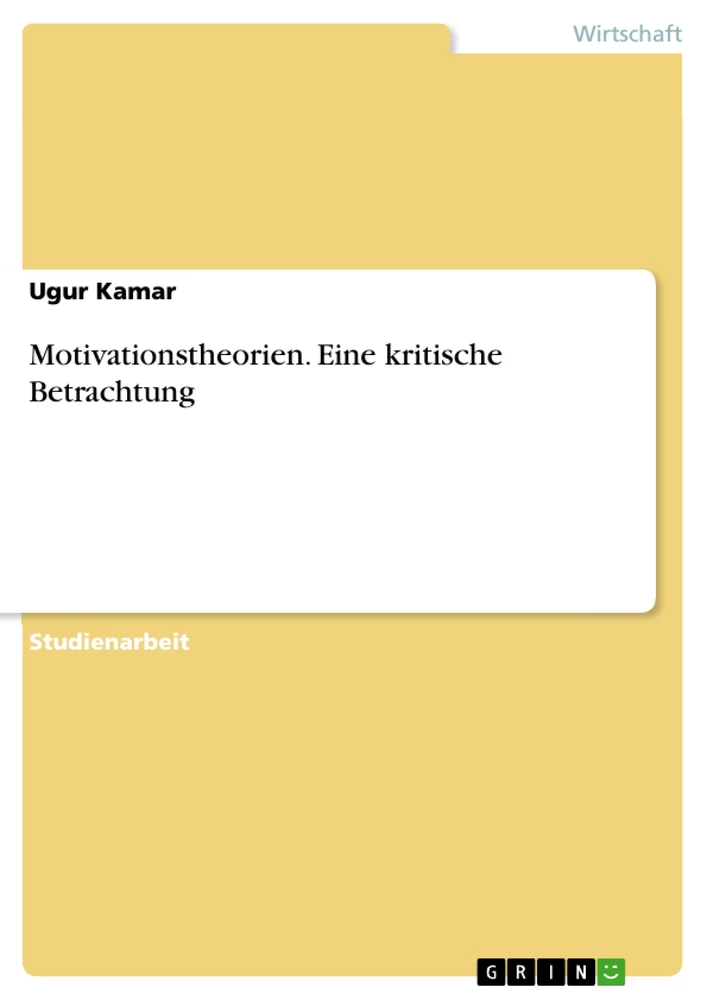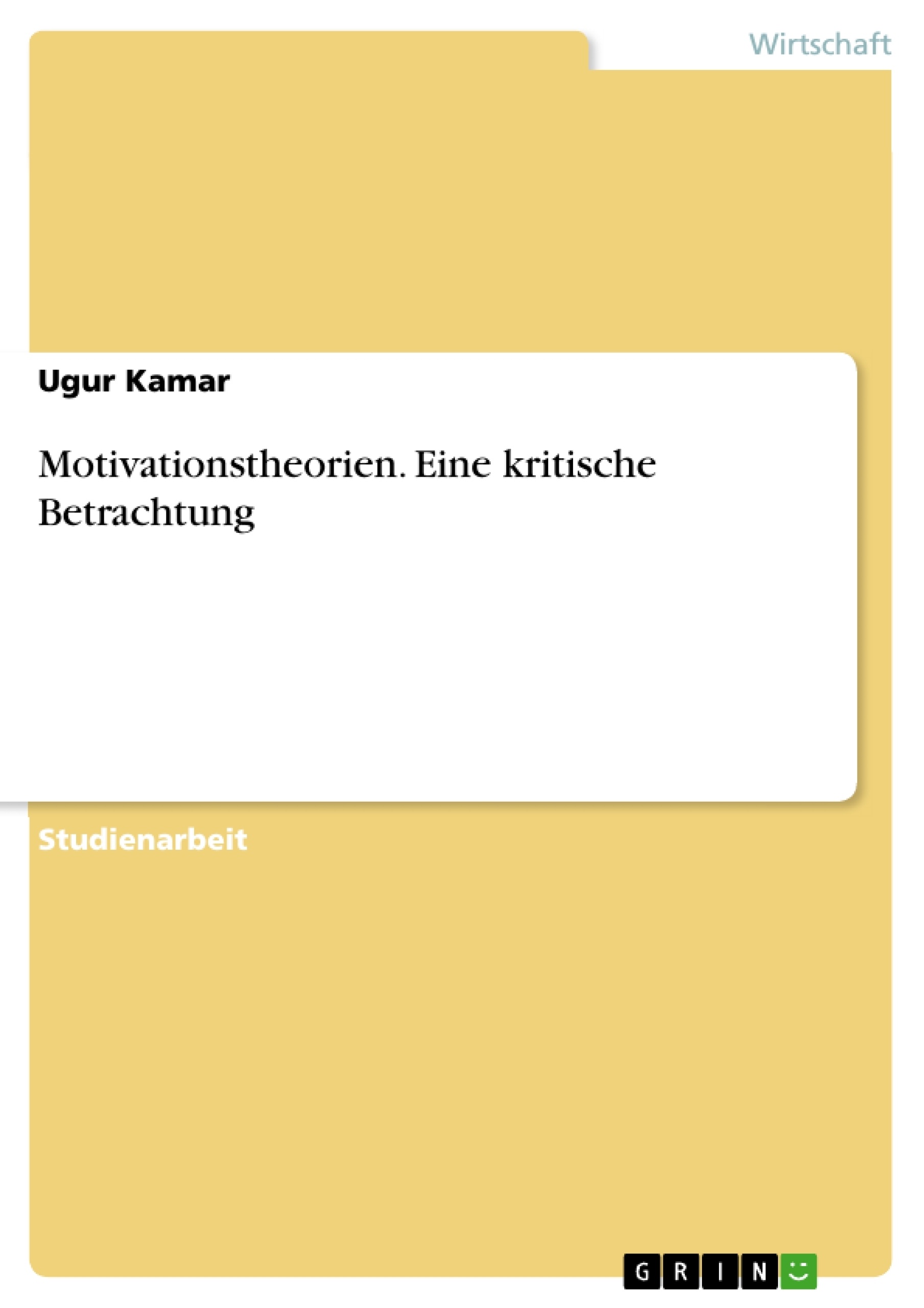Das Geheimnis des Erfolgs eines Unternehmens liegt sowohl im technologischen Fortschritt als in besonderem Maße auch im Engagement der Mitarbeiter. Weil Deutschland ein rohstoffarmes Land ist, steht die Frage, „wie können die Potentiale der Mitarbeiter bestmöglich freisetzen werden?“ seit langem im Fokus der Überlegungen von Motivationstheoretikern. Bereits 1913 stellte der Ökonom Sombart eine entscheidende Frage welche die Organisationen auch heute noch stark beschäftigt: „Wie ist dieses möglich: dass gesunde und meist vortreffliche, überdurchschnittlich begabte Menschen so etwas wie wirtschaftliche Tätlichkeit wollen können, nicht nur als eine Pflicht, nicht nur als notwendiges Übel, sondern weil sie sie lieben, weil Sie sich ihr mit Herz und Geist, mit Körper und Seele ergeben haben?“ Besonders im letzten halben Jahrhundert sind verschiedene zum Teil verbreitete wissenschaftliche Theorien aufgestellt worden, die sich mit Führung und Motivation von Mitarbeitern befassen. Aber wenn, wie Sievers feststellt, Menschen sich nur selbst motivieren können, sind dann alle diese Motivationstheorien unbrauchbar? Jeder Lösungsansatz auf die eingangs gestellte Frage muss demnach darauf abzielen, die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie von sich aus Selbstverantwortung und Selbstkontrolle zu übernehmen. Denn nur ein Mitarbeiter der dies tut, ist langfristig auch hoch motiviert.
Trotz der vielfältigen Motivationstheorien ist noch kein allgemein funktionierendes System gefunden worden, dass die unterstellte chronische Passivität und das Desinteresse der Mitarbeiter überwindet und deren Potentiale für Unternehmen zuverlässig, umfassend nutzbar macht. Diese Arbeit hinterfragt und kritisiert die bekanntesten Motivationstheorien, um dem Leser die Problematik der Mitarbeitermotivation aus einer anderen Perspektive darzustellen. Dabei werden Ursachen für Demotivation von Mitarbeiter anhand der Organisationsstrukturen verdeutlicht. Ziel dieser Arbeit ist es, klassische Gedankengänge in Frage zu stellen und Lösungsansätze zu präsentieren, wie Arbeitnehmer dazu geführt werden können, selbstständig Verantwortung zu übernehmen.
Die Arbeit baut vor allem auf die Ansätze von Sprenger und MCGregor auf. Dabei werden Maßnahmen zu einer erfolgreicheren bedürfnisorientierten Organisationsgestaltung von McGregor mit den Maßnahmen von Sprenger gegenübergestellt und ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung und Ziel
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Motivationstheorien
- Motivation
- Bedürfnis- und Prozesstheorien
- Theorie Y als Weg zur bedürfnisorientierten Organisationsgestaltung
- Der Kontrollgraph
- Motivationstheorien
- Kritische Betrachtung der Motivationstheorien
- Einzelkritiken zu den klassischen Motivationstheorien
- Kritik an der Maslow'schen Bedürfnispyramide
- Kritik an der Zweifaktoren-Theorie von Herzberg
- Kritik an der Erwartungs-Valenz-Theorie (VIE-Theorie)
- Kritik an den Motivationstheorien auf der Metaebene
- Einzelkritiken zu den klassischen Motivationstheorien
- Gegenüberstellung der Theorien von Sprenger und McGregor
- Wege zur Übernahme von Selbstverantwortung
- Gemeinsamkeiten der Theorie X, Y mit dem Prinzip der Selbstverantwortung
- Merkmale einer Theorie X orientierten Organisation
- Merkmale einer Theorie Y orientierten Organisation
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kritischen Betrachtung von Motivationstheorien und zielt darauf ab, die Problematik der Mitarbeitermotivation aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Sie untersucht, warum klassische Gedankengänge zur Motivation von Mitarbeitern nicht immer effektiv funktionieren und präsentiert Lösungsansätze, um Arbeitnehmer dazu zu bewegen, eigenständig Verantwortung zu übernehmen.
- Die Bedeutung von Bedürfnis- und Prozesstheorien für die Motivation von Mitarbeitern
- Kritik an klassischen Motivationstheorien wie der Maslow'schen Bedürfnispyramide, Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie und der Erwartungs-Valenz-Theorie
- Die Rolle von Selbstverantwortung und Selbstkontrolle für die Mitarbeitermotivation
- Die Gegenüberstellung der Theorien von Sprenger und McGregor im Hinblick auf Organisationsgestaltung und Mitarbeitermotivation
- Die Bedeutung von bedürfnisorientierten Organisationsstrukturen für die erfolgreiche Mitarbeitermotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung und führt die Problemstellung sowie das Ziel der Arbeit aus. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen behandelt, wobei der Begriff der Motivation definiert und die Bedeutung von Bedürfnis- und Prozesstheorien erläutert wird. Des Weiteren werden die Theorien von McGregor und Tannenbaum vorgestellt. Das dritte Kapitel präsentiert eine kritische Betrachtung der Motivationstheorien, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit. Dabei werden die Limitationen und Schwächen verschiedener Theorien aufgezeigt. Kapitel vier zeigt mit Hilfe der Ansätze von Sprenger Wege zur Übernahme von Selbstverantwortung und Selbstkontrolle durch Mitarbeiter auf. Abschließend werden die Maßnahmen von McGregor und Sprenger zur erfolgreichen bedürfnisorientierten Organisationsgestaltung gegenübergestellt und ergänzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die kritische Analyse von Motivationstheorien, insbesondere auf die Themen Selbstverantwortung, Selbstkontrolle, bedürfnisorientierte Organisationsgestaltung und die Motivation von Mitarbeitern. Sie untersucht die Theorien von McGregor, Tannenbaum und Sprenger und beleuchtet deren Relevanz im Kontext der modernen Arbeitswelt.
- Quote paper
- Dipl. Ökonom Ugur Kamar (Author), 2007, Motivationstheorien. Eine kritische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71561