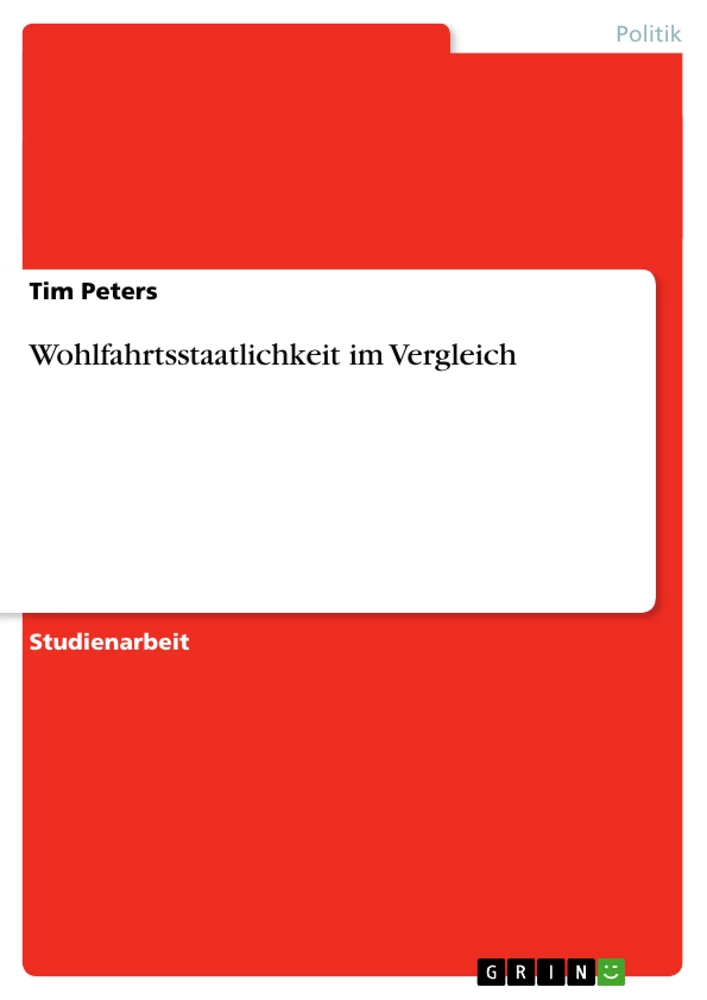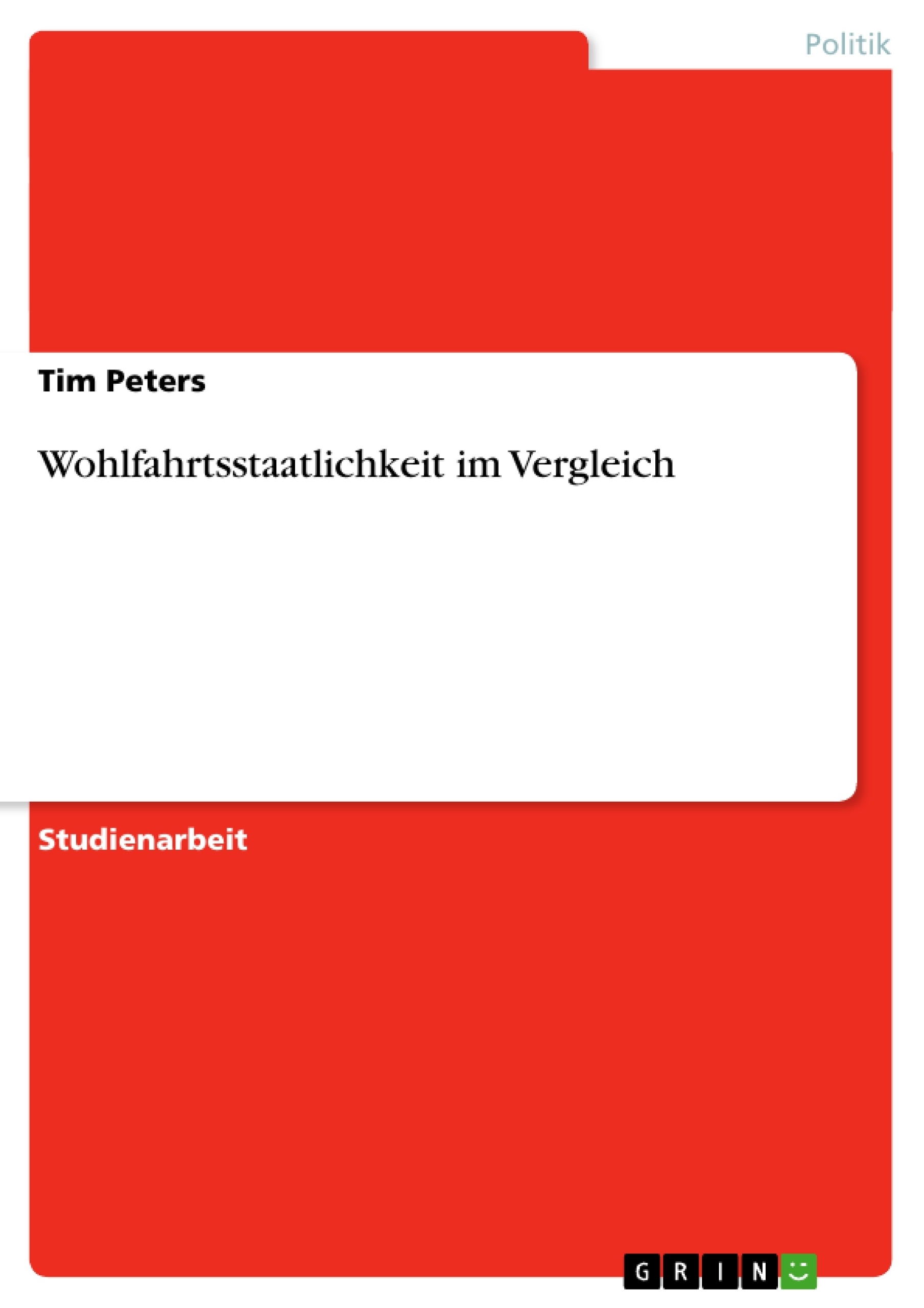Bis zur Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stellte das „Modell Deutschland“ eine viel geschätzte Organisation des Sozialstaates dar. In der aktuellen Diskussion firmiert die Bundesrepublik hingegen allenfalls als „kranker Mann Europas“. Angesichts einer strukturell verfestigten Arbeitslosigkeit von nahezu 10 Prozent der arbeitfähigen Bevölkerung, demographischer Horrorszenarien und einer nicht enden wollenden Alimentierung der neuen Bundesländer stellt sich die Frage, wie Deutschland wieder erfolgreich und gleichzeitig weiter sozial sein kann. Was lässt sich von anderen Sozialstaatsmodellen lernen? Warum sind andere offensichtlich erfolgreicher?
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die Typen des Wohlfahrtsstaates nach Esping-Andersens Typologie erläutert (Teil 2), anschließend wird der Blick auf die jeweiligen Funktionen des Sozialstaats im politischen System Großbritanniens (3.1.), Deutschlands (3.2.) und Schwedens (3.3.) gerichtet. Dabei sollen die Geschichte und die Gründe, die zur Etablierung des jeweiligen Typs führten, ebenfalls erläutert werden. Diese Arbeit schließt mit einem Ausblick, in dem zusammenfassend dargestellt wird, ob eine Chance des Lernens im europäischen Kontext gegeben ist und wie speziell Deutschland von den Erfahrungen der Nachbarstaaten profitieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates
- Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Funktionen im politischen System
- Liberaler Typus: Großbritannien
- Konservativer Typus: Deutschland
- Sozialdemokratischer Typus: Schweden
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle und deren Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Sie untersucht, wie Deutschland im europäischen Kontext erfolgreich und sozial zugleich sein kann, und analysiert die Stärken und Schwächen verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle.
- Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates in Westeuropa, wie Globalisierung, Demographischer Wandel, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsmigration
- Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit nach Esping-Andersens Typologie: liberaler, konservativer und sozialdemokratischer Typus
- Funktionen des Sozialstaates im politischen System Großbritanniens, Deutschlands und Schwedens
- Lernmöglichkeiten für Deutschland aus den Erfahrungen anderer europäischer Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Wohlfahrtsstaatlichkeit im Vergleich“ im Kontext der aktuellen Herausforderungen des deutschen Sozialstaates dar. Kapitel 2 analysiert die vielfältigen Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates in Westeuropa, wie Globalisierung, demographische Entwicklung, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsmigration. Kapitel 3 erläutert die drei Typen der Wohlfahrtsstaatlichkeit nach Esping-Andersens Typologie: den liberalen Typus (Großbritannien), den konservativen Typus (Deutschland) und den sozialdemokratischen Typus (Schweden). Es wird auch auf die historische Entwicklung und die Gründe für die Etablierung der jeweiligen Typen eingegangen.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Vergleichende Regierungslehre, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, liberaler Typus, konservativer Typus, sozialdemokratischer Typus, Globalisierung, Demographischer Wandel, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsmigration, Funktionen des Sozialstaates, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Lernmöglichkeiten.
- Arbeit zitieren
- Tim Peters (Autor:in), 2007, Wohlfahrtsstaatlichkeit im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71451