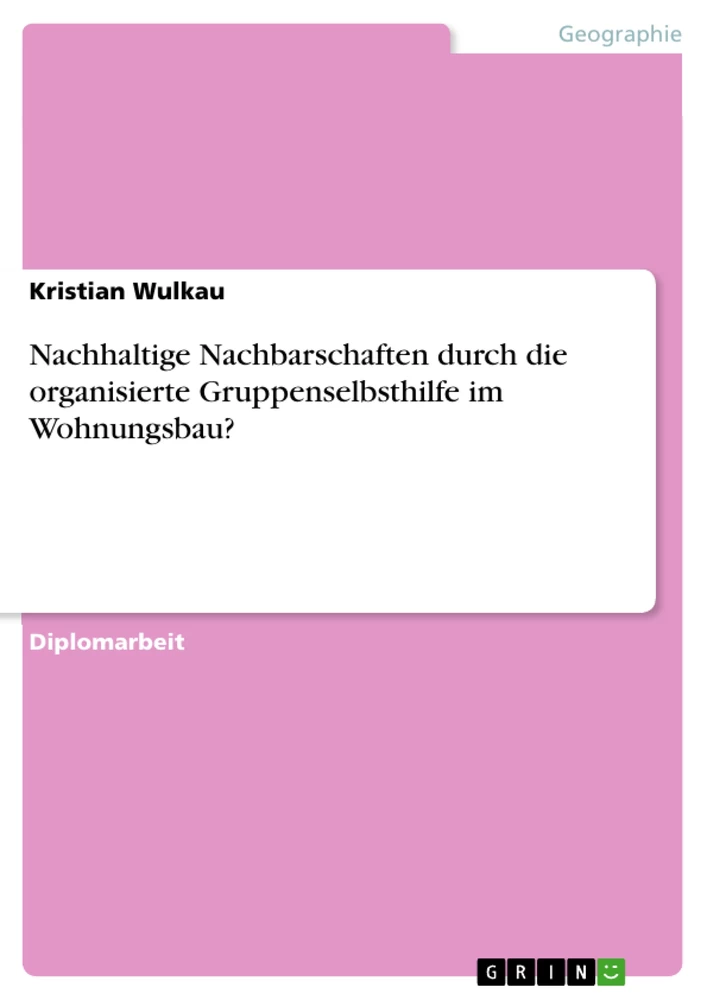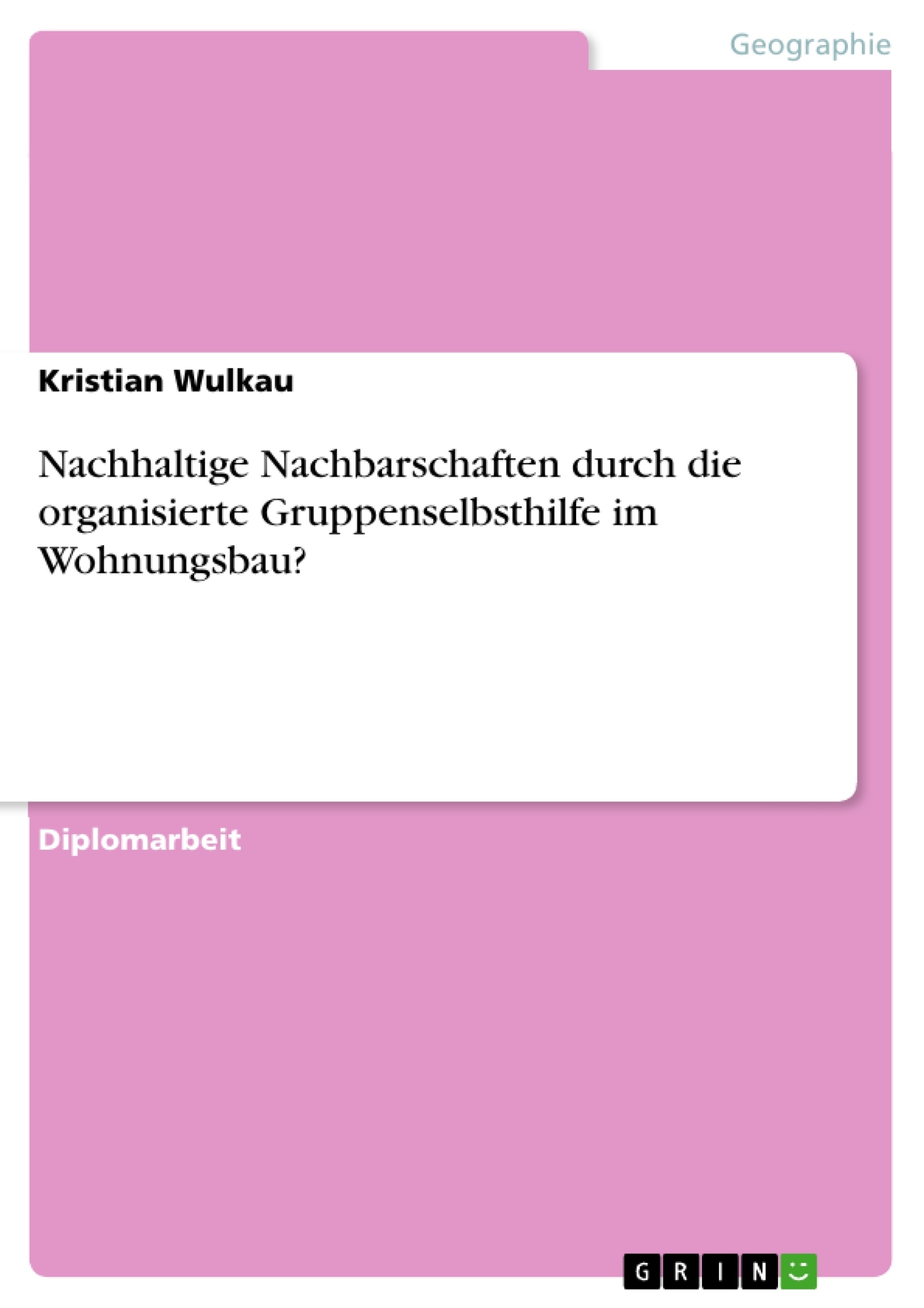1.Herleitung des Themas im Zusammenhang mit dem Diplomrahmenthema:
„Produktionsbedingungen und Katalysatoren der Stadtentwicklung“
Die Herleitung des Themas soll zugleich eine Einführung in die für diese Arbeit relevanten Aspekte darstellen. Nachdem einzelne Aspekte und Hypothesen angesprochen wurden, soll am Ende dieser Herleitung und Einleitung die genaue Gliederung und Vorgehensweise dieser Arbeit erläutert werden. Ziel des ersten Teils dieser Arbeit ist es, im Anschluss eine Zusammenfassung und Auflistung von Hypothesen vornehmen zu können. Die Bekräftigung, Differenzierung oder die Widerlegung der in dieser Einleitung und dem folgenden Text aufgestellten Hypothesen ist Inhalt und Ziel dieser Arbeit. Die in der Einleitung angesprochenen Aspekte und Behauptungen, sollen im nächsten Kapitel näher erläutert werden.
Die Schaffung und Organisation von Wohnraum ist sicherlich eine der elementarsten Aufgaben der geplanten Stadtentwicklung. Ein Großteil des Wohnraums in Deutschland wurde und wird nicht durch seine Bewohner geplant und produziert. Die Arbeit entstand unter der Annahme, dass Aufgrund von fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des sozialen und materiellen Zusammenhangs des eigenen Wohnraums, eine Aneignung des Wohnraums oder die Identifizierung mit demselbigen durch die Bewohner oft gar nicht oder nur sehr bedingt stattfindet, weswegen engere Formen von Nachbarschaften sich häufig nicht entwickeln.
Der Begriff des Wortes Wohnraum ist mehrdeutig, da die Bedeutung des Wortes von Bewohner zu Bewohner individuell unterschiedlich ist. Für den einen beschränkt sich die Bedeutung des Wortes auf die so genannten eigenen vier Wände, andere empfinden im Extremfall die ganze Stadt als ihren Wohnraum. Mit der Verwendung des Wortes Wohnraum kann mehr gemeint sein als nur die in sich abgeschlossene Wohnung. Gerade die Zunahme individuell unterschiedlicher Lebenskonzepte und Vorstellungen von Wohnraum gilt es bei der Planung der Stadtentwicklung zu berücksichtigen. Stadtplanung muss zwischen den Bedürfnissen und Vorstellungen des Einzelnen und den Bedürfnissen der Gesellschaft vermitteln.
Stadtplanung ist durch ihren generalistischen Ansatz ein fremdbestimmter Eingriff in die Lebensund Wohnwelt des Einzelnen. Die Fremdbestimmtheit der Produktion des eigenen Lebensraumes bzw. Wohnraumes im materiell-physischen Sinne steht in einem Spannungsverhältnis zu gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Herleitung des Themas im Zusammenhang mit dem Diplomrahmenthema: „Produktionsbedingungen und Katalysatoren der Stadtentwicklung“
- Kurzbeschreibung der organisierten Gruppenselbsthilfe (OGSH)
- Theoretische Annäherung durch eine kurze Skizzierung des sozialwissenschaftlichen Kontextes
- Individualisierung der Gesellschaft
- Nachbarschaft als eine Form der sozialen Netzwerke
- Definition des Begriffes „Nachhaltige Nachbarschaft“
- Individualisierungsprozesse, Nachbarschaft und OGSH im Zusammenhang
- Verschiedene Formen der OGSH im Lauf der deutschen Geschichte
- Die Genossenschaftsbewegung
- Die Siedlerbewegung
- Instandbesetzung
- Die organisierte Gruppenselbsthilfe im Überblick
- Die zwei Modelle der organisierten Gruppenselbsthilfe
- Das Trägermodell
- Das Initiativmodell
- Die vier Phasen der OGSH
- Vorbereitungsphase
- Planungsphase
- Bauphase
- Die Wohnphase
- Rechtsformen der Baugruppe (s. auch Anhang)
- Prozessbeteiligte und Aufgabenfelder bei der OGSH
- Die Baugruppe
- Der Architekt
- Die technische Baubetreuung
- Wirtschaftliche Betreuung
- Gruppenselbsthilfe-Betreuungsunternehmen
- Die Gemeinde
- Kostenaspekte der Gruppenselbsthilfe beim Bauprozess
- Kostensparen durch Gruppenselbsthilfe
- Kosten- und flächensparendes Bauen
- Aufgabenfelder des Kostensparens
- Der Kosten- und Finanzierungsplan
- Grobstruktur des Untersuchungsvorhabens
- Ziel
- Weg
- Hypothesenaufstellung und Forschungsfragen
- Hypothese 1
- Hypothese 2
- Hypothese 3
- Hypothese 4
- Hypothese 5
- Hypothese 6
- Hypothese 7
- Hypothese 8
- Hypothese 9
- Weg zur Erstellung narrativer Projektbeschreibungen
- Wahlbegründungen des qualitativen Interviews
- Die einzelnen Arbeitsschritte
- Der Interviewleitfaden:
- Die Interviewdurchführung
- Transkription
- Erstellung narrativer Projektbeschreibungen
- Narrative Projektbeschreibungen
- Projektbeispiel A
- Projektbeispiel B
- Projektbeispiel C
- Projektbeispiel D
- Projektbeispiel E
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob die organisierte Gruppenselbsthilfe (OGSH) im Wohnungsbau zur Entwicklung nachhaltiger Nachbarschaften beitragen kann. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Modelle und Phasen der OGSH, analysiert die beteiligten Akteure und deren Aufgabenfelder sowie die Kostenaspekte im Bauprozess. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen der OGSH auf die Gestaltung des Wohnraums und die Entstehung von Nachbarschaftsstrukturen.
- Die Rolle der OGSH bei der Gestaltung von Wohnraum und der Förderung von Nachbarschaft
- Die verschiedenen Modelle und Phasen der OGSH im Kontext der Stadtentwicklung
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung und Mitbestimmung bei der Planung und Realisierung von Wohnprojekten
- Die sozialen und ökonomischen Aspekte der OGSH im Vergleich zu herkömmlichen Wohnungsbauformen
- Die Relevanz von nachhaltigen Nachbarschaften für die Lebensqualität und die soziale Integration von Bewohnern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Relevanz des Themas im Kontext der Stadtentwicklung verdeutlicht. Es werden dabei die gesellschaftlichen Trends der Individualisierung und die Bedeutung des Wohnraums als Rückzugsort und Identifikationsraum beleuchtet.
Kapitel 2 gibt eine Kurzbeschreibung der organisierten Gruppenselbsthilfe (OGSH) und erläutert die zwei Modelle der OGSH (Trägermodell und Initiativmodell) sowie die vier Phasen der OGSH (Vorbereitungsphase, Planungsphase, Bauphase und Wohnphase).
Kapitel 3 widmet sich der theoretischen Annäherung an das Thema und beleuchtet die Individualisierung der Gesellschaft, Nachbarschaft als eine Form von sozialen Netzwerken und die Definition von „Nachhaltiger Nachbarschaft“. Zudem wird der Zusammenhang zwischen Individualisierungsprozessen, Nachbarschaft und OGSH aufgezeigt.
Kapitel 4 präsentiert verschiedene Formen der OGSH in der deutschen Geschichte, darunter die Genossenschaftsbewegung, die Siedlerbewegung und die Instandbesetzung. In Kapitel 5 werden die Prozessbeteiligten und deren Aufgabenfelder bei der OGSH, sowie die Kostenaspekte der Gruppenselbsthilfe beim Bauprozess beleuchtet.
Kapitel 6 skizziert die Grobstruktur des Untersuchungsvorhabens und erläutert Ziel und Weg der Diplomarbeit. Es werden Hypothesen aufgestellt und Forschungsfragen formuliert.
Kapitel 7 beschreibt den Weg zur Erstellung narrativer Projektbeschreibungen, wobei die Wahlbegründungen des qualitativen Interviews und die einzelnen Arbeitsschritte im Detail dargelegt werden.
Kapitel 8 präsentiert narrative Projektbeschreibungen von verschiedenen Wohnprojekten, die im Rahmen der Diplomarbeit untersucht wurden.
Schlüsselwörter
Organisierte Gruppenselbsthilfe, Wohnungsbau, nachhaltige Nachbarschaften, Stadtentwicklung, Individualisierung, soziale Netzwerke, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Wohnraumgestaltung, Lebensqualität, soziale Integration, Kostenaspekte.
- Die zwei Modelle der organisierten Gruppenselbsthilfe
- Quote paper
- Kristian Wulkau (Author), 2007, Nachhaltige Nachbarschaften durch die organisierte Gruppenselbsthilfe im Wohnungsbau?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71355