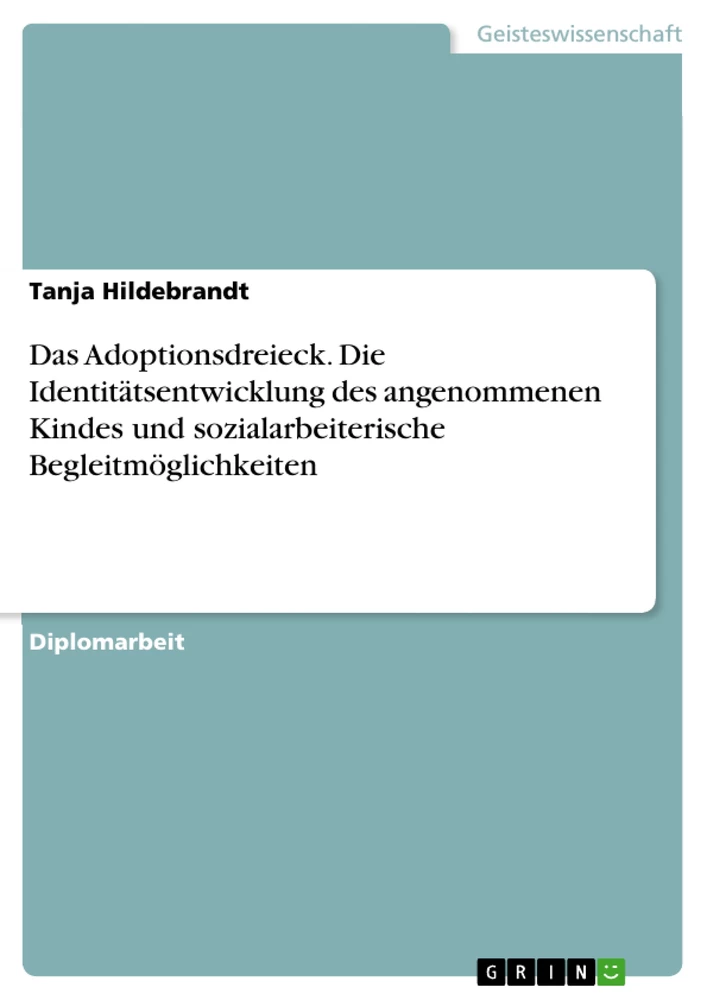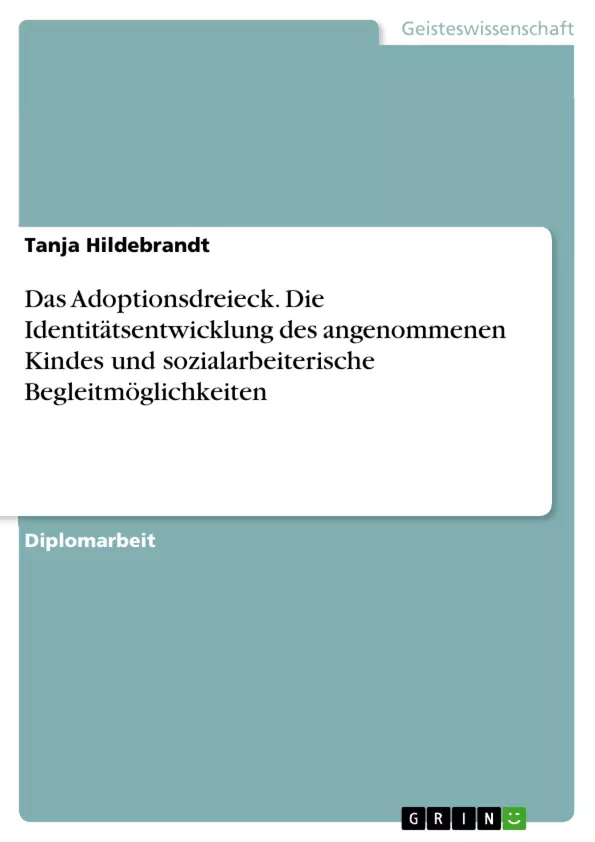Wer bin ich?
Diese Frage stellt sich jeder – mal mehr, mal weniger bewusst. Die persönliche Identität, das Gefühl von Gleichheit und Beständigkeit, das Wissen wer man ist, wo man hingehört, ist eine zentrale Angelegenheit im Leben. Die Eckpunkte der persönlichen Identität lassen sich einfach ausmachen, so sind uns unser Name, Geburtstag, Geburtsort, Eltern, Großeltern, Geschwister selbstverständlich bekannt. Viele andere Dinge, die unsere persönliche Identität ausmachen, uns unverwechselbar machen, kommen im Laufe des Lebens dazu. Am Ende der Pubertät sollte laut Erik H. Erikson jeder das Gefühl einer stabilen Identität erreichen. Dies drückt er mit dem folgenden Satz, der für die Adoleszenz charakteristisch ist, aus: „Ich bin ich selbst. Das heißt: Ich bin die Person, die ich in meinen eigenen Augen bin, und ich bin die Person, für die mich die anderen halten.“ (Erikson 1980, S. 136)
Für Menschen, die adoptiert wurden, ist die Beantwortung dieser Frage nicht so einfach. Sie wissen meist nicht viel über ihre leiblichen Eltern, manchmal nicht einmal, dass sie nicht leibliches Kind ihrer sozialen Eltern sind. Die meisten fühlen sich emotional stark mit ihren Adoptiveltern verbunden und sehen diese als ihre „richtigen“ Eltern an und doch fehlt ihnen das Wissen um den Anfang ihres Lebens. Sollte man nicht einfach dem Adoptierten verschweigen, dass er adoptiert ist und ihm so viel Leid ersparen? Dies ist schon aus rechtlichen Gründen undenkbar, denn jeder hat einen gesetzlichen Anspruch (vgl. Artikel 1 und 2 Grundgesetz) darauf zu wissen, wer seine Vorfahren sind. Außerdem stände immer etwas zwischen Eltern und Kind. Informationen können zwar zurückgehalten werden, aber die Gefühle und die Atmosphäre, die damit verbunden sind, lassen sich nicht verstecken. Das Familienverhältnis kann damit empfindlich gestört werden.
Viele Adoptierte haben damit zu kämpfen, dass sie von ihren leiblichen Eltern weggegeben wurden, fühlen sich nicht liebenswert und wissen nicht, zu wem sie gehören. Ein Adoptierter drückt seine Gefühle in Sorosky u. a. (1978, S.117) folgendermaßen aus:
„Adoptiert zu sein und nichts von seiner eigenen Herkunft zu wissen ist, als ob man blind durch den Nebel fliegt.“
Eine stabile Identität ist es, die uns stark macht und uns Herausforderungen annehmen lässt. Ein schwaches Identitätsgefühl kann uns behindern, die Fähigkeit einschränken, neuen Anforderungen entgegen zu treten und mit anderen in Kontakt zu kommen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Adoption
- 2.1. Historischer Abriss
- 2.2. Rechtliche Grundlagen
- 2.3. Ablauf des Adoptionsverfahrens
- 2.4. Adoptionsformen
- 2.5. Rolle des Sozialarbeiters im Adoptionsprozess
- 3. Das Adoptionsdreieck
- 3.1. Die abgebenden Eltern
- 3.1.1. Sozialdaten
- 3.1.2. Gründe für die Freigabe des Kindes
- 3.1.3. Einstellung gegenüber den Adoptiveltern
- 3.1.4. Gefühle nach der Freigabe
- 3.1.5. Hilfen für abgebende Eltern
- 3.2. Die annehmenden Eltern
- 3.2.1. Sozialdaten
- 3.2.2. Gründe für die Annahme eines Kindes
- 3.2.3. Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit
- 3.2.4. Einstellung gegenüber den leiblichen Eltern
- 3.2.5. Anforderungen und Schwierigkeiten der Adoptiveltern
- 3.2.6. Hilfen für annehmende Eltern
- 3.3. Das Adoptivkind
- 3.3.1. Sozialdaten
- 3.3.2. Zeitpunkt der Adoption
- 3.3.3. Aufklärung des Kindes über seinen Adoptivstatus
- 3.3.4. Die Bedeutung des Adoptiert-Seins für den Adoptierten
- 3.4. Das Adoptionsdreieck – Ein Spannungsfeld
- 3.1. Die abgebenden Eltern
- 4. Lebensphasen des Adoptierten
- 4.1. Adoptierte in der Kindheit
- 4.2. Adoptierte in der Adoleszenz
- 4.3. Adoptierte als Erwachsene
- 5. Identitätsentwicklung des Adoptierten
- 5.1. Problemaufriss
- 5.2. Identitätstheorie nach E. H. Erikson
- 5.2.1. Beschreibung der Theorie
- 5.2.2. Kritische Auseinandersetzung mit Eriksons Ansatz in Bezug auf die Identitätsentwicklung von Adoptierten
- 5.3. Adoption als Identitätsproblem?
- 5.4. Theorie der kognitiven Dissonanz nach L. Festinger
- 5.4.1. Beschreibung der Theorie Festingers
- 5.4.2. Kritische Auseinandersetzung mit Festingers Ansatz in Bezug auf die Identitätsentwicklung von Adoptierten
- 5.5. Resümee
- 6. Zusammenfassende Betrachtung
- 7. Sozialarbeiterische Begleitmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Herausforderungen der Identitätsentwicklung bei adoptierten Kindern und die Rolle von Sozialarbeitern im Adoptionsprozess. Ziel ist es, die komplexen Beziehungen innerhalb des "Adoptionsdreiecks" (abgebende Eltern, annehmende Eltern, Adoptivkind) zu beleuchten und Möglichkeiten sozialarbeiterischer Begleitung aufzuzeigen.
- Die rechtlichen und historischen Grundlagen der Adoption
- Die Perspektiven der beteiligten Personen im Adoptionsdreieck
- Die Identitätsentwicklung des Adoptivkindes in verschiedenen Lebensphasen
- Die Anwendung von Identitätstheorien (Erikson, Festinger) auf die Situation adoptierter Kinder
- Die Bedeutung sozialarbeiterischer Interventionen und Begleitung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsfindung bei adoptierten Kindern ein und hebt die zentrale Bedeutung der Frage "Wer bin ich?" hervor. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, die sich für Adoptierte aus dem Mangel an Wissen über ihre biologischen Wurzeln ergeben und stellt die Rolle des Sozialarbeiters im Prozess der Adoptionsvermittlung in den Mittelpunkt.
2. Die Adoption: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Adoption, beginnend mit einem historischen Abriss und der Darstellung der rechtlichen Grundlagen im deutschen Recht (BGB, AdVermiG). Es beschreibt den Ablauf eines Adoptionsverfahrens, verschiedene Adoptionsformen (z.B. Inkognito- und offene Adoption) und detailliert die wichtige Rolle des Sozialarbeiters in der Vermittlung und Begleitung.
3. Das Adoptionsdreieck: Das Herzstück der Arbeit beleuchtet die Perspektiven aller Beteiligten: die abgebenden Eltern (ihre Gründe für die Abgabe, ihre Gefühle und die ihnen angebotenen Hilfen), die annehmenden Eltern (ihre Motive, Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten) und das Adoptivkind (seine Entwicklung, den Zeitpunkt der Aufklärung über seinen Status und die Bedeutung des Wissens um seine Herkunft). Der Abschnitt analysiert die Spannungsfelder und Interaktionen innerhalb dieses Dreiecks.
4. Lebensphasen des Adoptierten: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen der Identitätsentwicklung in verschiedenen Lebensphasen des adoptierten Kindes: Kindheit, Adoleszenz und Erwachsenenalter. Es analysiert die spezifischen Probleme und Bedürfnisse in jeder Phase und zeigt auf, wie die Erfahrung des Adoptiertseins die Entwicklung beeinflusst.
5. Identitätsentwicklung des Adoptierten: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Identitätsentwicklung von Adoptierten. Es analysiert die Theorien von Erikson und Festinger und diskutiert deren Anwendbarkeit auf die besondere Situation adoptierter Personen. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit die Adoption an sich ein Identitätsproblem darstellt und wie dieser Prozess gestaltet werden kann.
6. Zusammenfassende Betrachtung: (Zusammenfassung nicht möglich, da diese Kapitel nach den Vorgaben ausgeschlossen sind.)
7. Sozialarbeiterische Begleitmöglichkeiten: (Zusammenfassung nicht möglich, da dieses Kapitel nach den Vorgaben ausgeschlossen ist.)
Schlüsselwörter
Adoption, Identitätsentwicklung, Adoptionsdreieck, abgebende Eltern, annehmende Eltern, Adoptivkind, Sozialarbeit, rechtliche Grundlagen, Erikson, Festinger, kognitive Dissonanz, Lebensphasen, Begleitung, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Identitätsentwicklung bei Adoptierten
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Herausforderungen der Identitätsentwicklung bei adoptierten Kindern und die Rolle von Sozialarbeitern im Adoptionsprozess. Sie beleuchtet die komplexen Beziehungen innerhalb des "Adoptionsdreiecks" (abgebende Eltern, annehmende Eltern, Adoptivkind) und zeigt Möglichkeiten sozialarbeiterischer Begleitung auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen und historischen Grundlagen der Adoption, die Perspektiven der beteiligten Personen im Adoptionsdreieck, die Identitätsentwicklung des Adoptivkindes in verschiedenen Lebensphasen, die Anwendung von Identitätstheorien (Erikson, Festinger) auf die Situation adoptierter Kinder und die Bedeutung sozialarbeiterischer Interventionen und Begleitung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Adoption, Das Adoptionsdreieck, Lebensphasen des Adoptierten, Identitätsentwicklung des Adoptierten, Zusammenfassende Betrachtung und Sozialarbeiterische Begleitmöglichkeiten. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Was wird im Kapitel "Die Adoption" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Adoption, einschließlich historischem Abriss, rechtlichen Grundlagen (BGB, AdVermiG), Ablauf des Verfahrens, verschiedenen Adoptionsformen (z.B. Inkognito- und offene Adoption) und der Rolle des Sozialarbeiters.
Was ist das "Adoptionsdreieck"?
Das "Adoptionsdreieck" beschreibt die komplexen Beziehungen zwischen den abgebenden Eltern, den annehmenden Eltern und dem Adoptivkind. Die Arbeit analysiert die Perspektiven und Interaktionen innerhalb dieses Dreiecks und die daraus resultierenden Spannungsfelder.
Wie werden die Lebensphasen des Adoptierten betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Identitätsentwicklung in der Kindheit, Adoleszenz und im Erwachsenenalter adoptierter Kinder. Sie analysiert spezifische Probleme und Bedürfnisse in jeder Phase und den Einfluss des Adoptiertseins auf die Entwicklung.
Welche Identitätstheorien werden angewendet?
Die Arbeit analysiert die Theorien von Erik Erikson und Leon Festinger (kognitive Dissonanz) und diskutiert deren Anwendbarkeit auf die Identitätsentwicklung von Adoptierten. Es wird kritisch hinterfragt, inwieweit die Adoption selbst ein Identitätsproblem darstellt.
Welche Rolle spielen Sozialarbeiter?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle von Sozialarbeitern in der Vermittlung und Begleitung von Adoptionen. Sie zeigt Möglichkeiten sozialarbeiterischer Interventionen und Begleitung in verschiedenen Phasen des Adoptionsprozesses auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adoption, Identitätsentwicklung, Adoptionsdreieck, abgebende Eltern, annehmende Eltern, Adoptivkind, Sozialarbeit, rechtliche Grundlagen, Erikson, Festinger, kognitive Dissonanz, Lebensphasen, Begleitung, Herausforderungen.
- Arbeit zitieren
- Tanja Hildebrandt (Autor:in), 2007, Das Adoptionsdreieck. Die Identitätsentwicklung des angenommenen Kindes und sozialarbeiterische Begleitmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71188