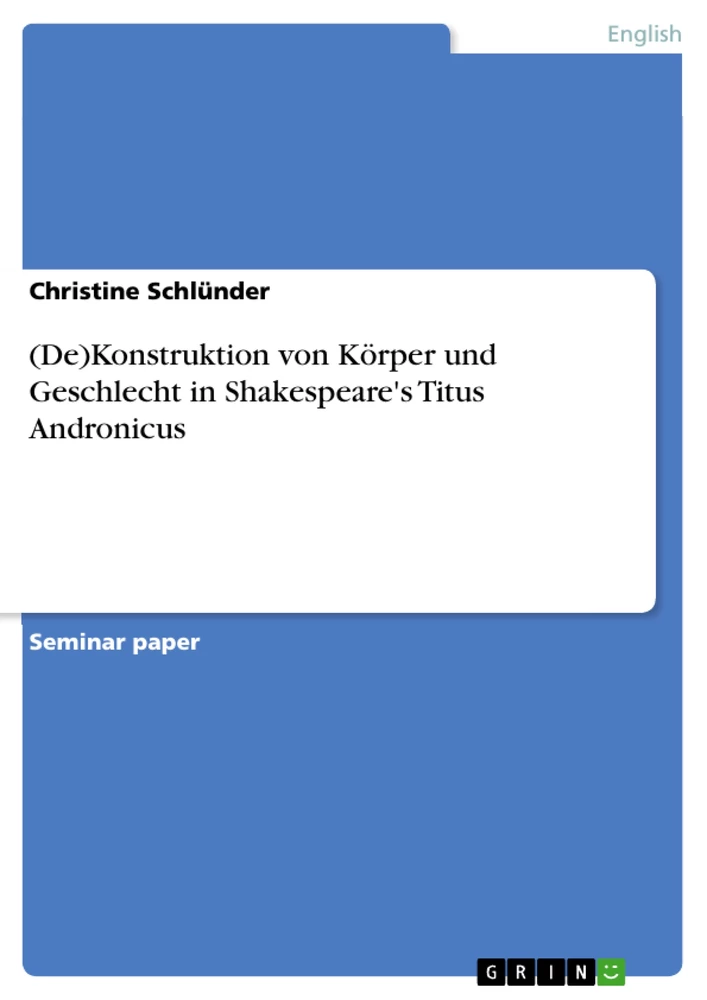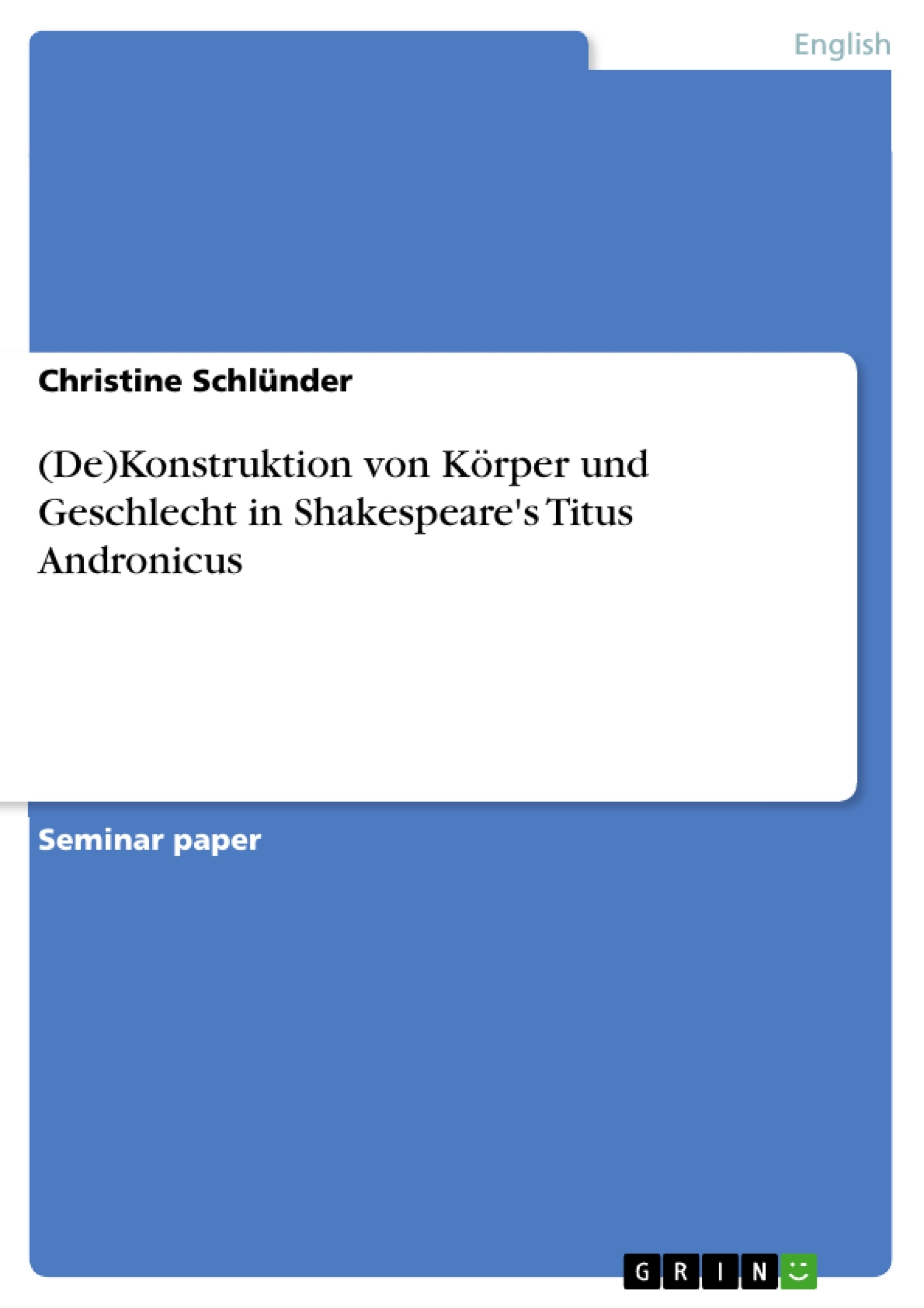Im poststrukturalistischen Sinne ist die Wirklichkeit ein Konstrukt, das sich über einen dynamischen Prozess fortwährend neu konstituiert. Sie ist immer abhängig von dem jeweiligen Bedeutungskontext und der Bedeutung, die ihr zugewiesen wird. Diese Sichtweise der konstruierten Wirklichkeit erstreckt sich auch auf die Felder Geschlecht und Körper. Folglich sind auch diese Komponenten nicht Träger einer festen Bedeutung. Insbesondere Judith Butler hat diese Wahrnehmung von der konstruierten Geschlechteridentität etabliert. Sie betont den Konstruktcharakter der Geschlechtsidentität und ihre Abhängigkeit von den Diskursen der jeweiligen Kultur und Gesellschaft. Demnach ist Gender ein diskursives Produkt und muss immer im soziokulturellen Kontext gesehen werden. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass auch in Shakespeares Dramen, hier am Beispiel der Tragödie Titus Andronicus 1 , der diskursive Charakter von Geschlechtsidentität zum Ausdruck kommt. Hierzu soll zunächst einmal der Ansatz Judith Butlers in Kapitel 2 zum besseren Verständnis näher erläutert werden. Daraufhin folgt in Kapitel 3 die Darstellung der Geschlechterdiskurse der Renaissance, die vor allem geprägt sind durch das so genannte Ein-Geschlecht-Modell. Kapitel 3.1 soll die Körperpolitik im Stück selbst aufzeigen, die spezifiziert wird in Kapitel 3.1.1 durch die Darlegung von der Korrelation zwischen weiblicher Sexualität und Macht. Dies soll an den beiden Frauenfiguren des Stücks festgemacht werden. Zum einen an Lavinia in Kapitel 3.1.1.1 und zum anderen an Tamora in Kapitel 3.1.1.2. Im Falle Lavinias ist deutlich zu erkennen, dass Identität über den Körper konstruiert wird und zwar in Abhängigkeit von der Unversehrtheit desselben. Es soll gezeigt werden, wie sich die Sicht auf Lavinia und ihre gesellschaftliche Position im Verlauf des Stücks wandelt und welche Rolle ihr Körper in diesem Kontext spielt. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Judith Butler: Diskursive Geschlechtsidentität
- Geschlechterdiskurse der Renaissance
- Körperpolitik in Shakespeares Titus Andronicus
- Weibliche Sexualität und Macht
- ...am Beispiel von Lavinia
- ...am Beispiel von Tamora
- "Racial Otherness" - Aaron, der Mohr
- Weibliche Sexualität und Macht
- Körperpolitik in Shakespeares Titus Andronicus
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
This essay explores the concept of constructed gender identity in Shakespeare's play Titus Andronicus. It aims to demonstrate how gender identity is a product of discursive processes, influenced by cultural norms and societal expectations. The essay examines Judith Butler's theory of performativity and its application to the play, highlighting how the characters' identities are shaped by the prevailing gender discourses of the Renaissance.
- Discursive Construction of Gender Identity
- Renaissance Gender Discourses
- Body Politics and Sexual Power
- The Impact of "Racial Otherness"
- Identity and Societal Norms
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
The introduction establishes the theoretical framework for the essay, outlining the concept of constructed reality and its relevance to gender and body. Chapter 2 introduces Judith Butler's theory of performativity, emphasizing the discursive nature of gender identity and its independence from biological disposition. Chapter 3 delves into Renaissance gender discourses, particularly the "one-gender" model, which influences the depiction of gender in Titus Andronicus. Chapter 3.1 analyzes the play's body politics, focusing on the correlation between female sexuality and power, specifically through the characters of Lavinia and Tamora. Chapter 3.2 investigates the portrayal of Aaron, the Moor, highlighting how racial discourse influences his identity.
Schlüsselwörter (Keywords)
The main keywords and focus topics include gender identity, performativity, Renaissance gender discourses, body politics, female sexuality, power, "Racial Otherness", and Titus Andronicus. The essay examines the construction of gender identity within a specific historical and cultural context, analyzing the interplay between individual identity and societal norms.
How does Judith Butler's theory apply to "Titus Andronicus"?
The essay uses Butler's concept of performativity to show that gender identity in the play is not fixed but constructed through cultural discourse and societal norms.
What is the "one-gender model" of the Renaissance?
It was a historical discourse that viewed gender as a hierarchy rather than a binary, influencing how Shakespeare depicted power and sexuality.
How is Lavinia's identity constructed through her body?
Lavinia's social position and identity are depicted as being entirely dependent on the integrity of her body; her mutilation changes her role in society significantly.
What does Tamora represent in terms of female power?
Tamora illustrates the correlation between female sexuality and political power, acting as a counterpart to the traditional gender roles of the time.
How does "Racial Otherness" affect Aaron the Moor's identity?
The essay analyzes how racial discourse in the Renaissance shapes Aaron's identity as an outsider and influences his actions within the tragedy.