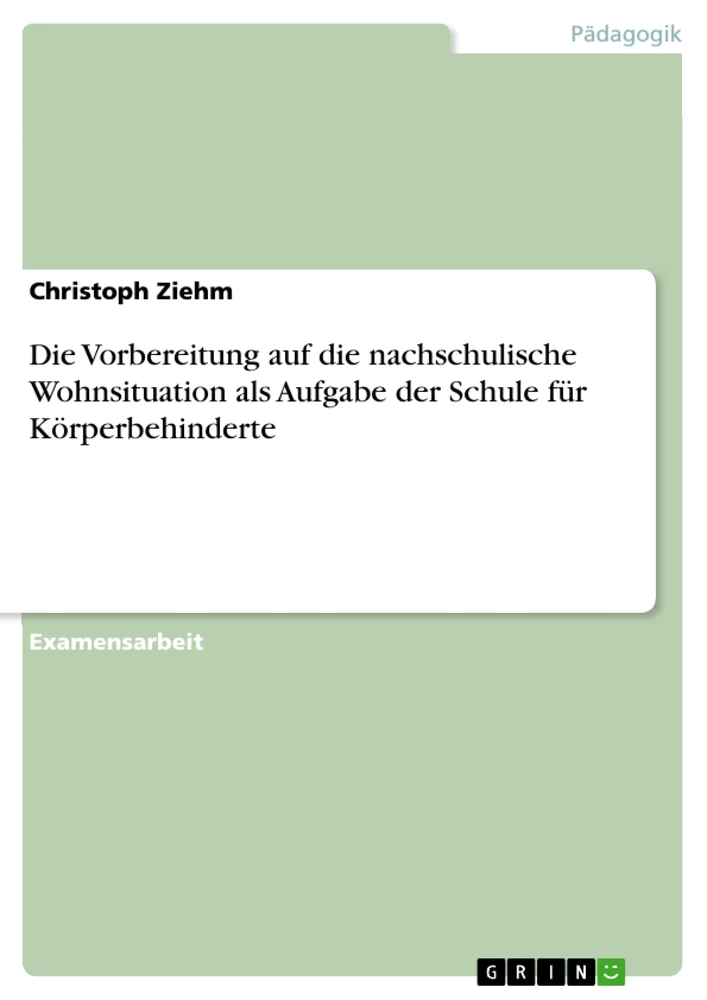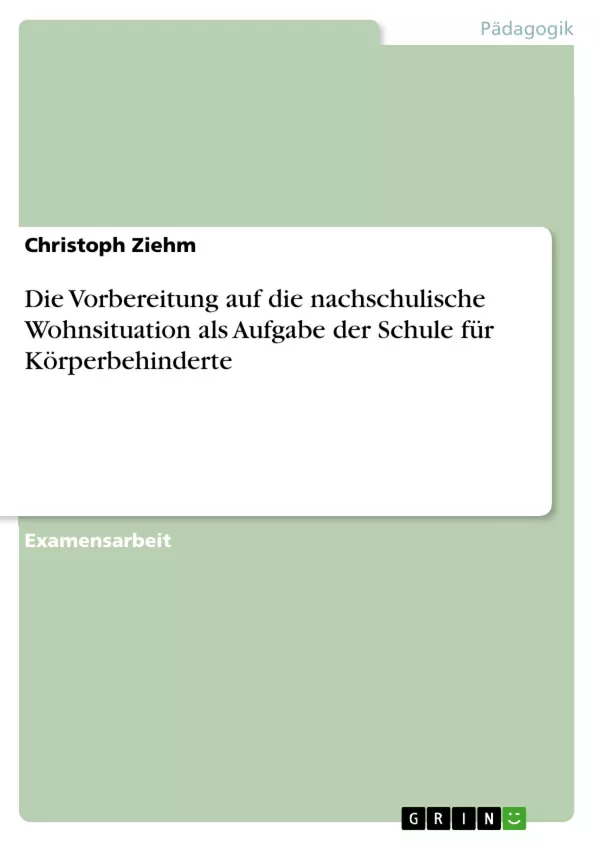Einleitung
Die Entscheidung, die elterliche Wohnung zu verlassen und in eine eigene Wohnung zu ziehen bedeutet für jeden Jugendlichen einen wichtigen, häufig jedoch schwierigen Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft als Erwachsener. Eine Behinderung erschwert diesen Ablösungsprozess durch verschiedene Faktoren, wie die Sicherung der Pflege und die erhöhte Schwierigkeit, eine geeignete Wohnung zu finden. Eine umfassende Vorbereitung ist daher gerade für Jugendliche mit einer Behinderung von besonderer Bedeutung, bietet die neue Wohnung doch auch große Chancen. So ist es eine gute
Voraussetzung für einen gelungenen Start in ein selbstständiges, von den Eltern unabhängigeres Leben, wenn die gewählte Wohnung den Bedürfnissen des Jugendlichen entspricht.
Aufgabe der vorliegenden Staatsexamensarbeit soll es sein, Möglichkeiten der Schule für Körperbehinderte darzustellen, den Schülern benötigte Kompetenzen zur selbstbestimmten Wahl der individuell bevorzugten Wohnform zu vermitteln. Die Arbeit soll
hingegen nicht das Für und Wider der unterschiedlichen Wohnformen thematisieren. Ich gehe davon aus, dass jede Wohnform für jeweils unterschiedliche Bewohner optimal geeignet sein kann.
Motivation für diese Arbeit ist die langjährige Freundschaft zu einer derzeit 16 jährigen Schülerin der Schule für Körperbehinderte Hirtenweg (Hamburg), bei der sich die Problematik der Ablösung vom Elternhaus momentan stellt. Da der empirische Teil dieser Arbeit an jener Schule durchgeführt wurde, beziehen sich die zitierten Richtlinien und Lehrpläne auf das Bundesland Hamburg. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind jedoch auch für alle anderen deutschen Bundesländer gültig.
Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der Schule für Körperbehinderte und ihrer Schülerschaft. Anfangs soll die neue Klassifikation ICIDH-2 der Weltgesundheitsorganisation vorgestellt werden, um den Begriff der Behinderung näher zu bestimmen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird die Institution
‚Schule für Körperbehinderte‘ sowie ihre Aufgaben und Ziele dargestellt. Des Weiteren wird die Schülerschaft der Schule für Körperbehinderte vorgestellt. Hier soll untersucht werden, auf welche Besonderheiten körperbehinderter Schüler im weiteren Verlauf der Arbeit, insbesondere bei der Durchführung der Unterrichtseinheit, zu achten ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. DIE SCHULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE UND IHRE SCHÜLERSCHAFT
- 1.1 ICIDH-2: INTERNATIONALE KLASSIFIKATION DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND BEHINDERUNG
- 1.2 DIE INSTITUTION UND IHRE AUFGABEN
- 1.3 DIE SCHÜLERSCHAFT DER SCHULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE
- 1.4 ZUSAMMENFASSUNG
- 2. DIE BEDEUTUNG DES WOHNENS FÜR DEN MENSCHEN MIT UND OHNE BEHINDERUNG
- 2.1 DIE BEDEUTUNG DES WOHNENS AUS DER SICHT DER TRANSAKTIONALEN WOHNTHEORIE
- 2.2 BEDÜRFNISSE DES MENSCHEN BEZÜGLICH SEINER WOHNUNG
- 2.3 BESONDERE BEDÜRFNISSE UND ERSCHWERNISSE VON MENSCHEN MIT KÖRPERBEHINDERUNG
- 2.4 ZUSAMMENFASSUNG
- 3. DAS UNTERRICHTSTHEMA WOHNEN IM SPIEGEL VON EMPFEHLUNGEN, RICHTLINIEN UND LEHRPLÄNEN
- 3.1 EMPFEHLUNGEN ZUM FÖRDERSCHWERPUNKT KÖRPERLICHE UND MOTORISCHE ENTWICKLUNG
- 3.2 LEHRPLÄNE UND RICHTLINIEN FÜR SONDERSCHULEN IN HAMBURG
- 3.3 DARSTELLUNG DER SCHULISCHEN VORBEREITUNG AUF DAS WOHNEN IN FACHBÜCHERN DER KÖRPERBEHINDERTENPÄDAGOGIK
- 3.4 ZUSAMMENFASSUNG
- 4. DER LERNBEREICH WOHNEN IN DER UNTERRICHTSPRAXIS
- 4.1 KONZEPTIONEN ZUR UMSETZUNG DES LERNBEREICHS IM UNTERRICHT
- 4.1.1 Maßnahmen zur Verselbständigung nach Stadler
- 4.1.2 Überlegungen für die pädagogisch-psychologische Arbeit nach Weinwurm-Krause
- 4.1.3 Trainingswohnen
- 4.2 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG IN DER UNTERRICHTSPRAXIS
- 4.3 ZUSAMMENFASSUNG
- 5. PLANUNG, DARSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DER UNTERSUCHUNG
- 5.1 PLANUNG DES UNTERSUCHUNGSVORHABENS
- 5.2 AUSWAHL GEEIGNETER ERHEBUNGSMETHODEN
- 5.2.1 Das problemzentrierte Interview
- 5.2.2 Die teilnehmende Beobachtung
- 5.3 DARSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DES UNTERSUCHUNGSDESIGNS
- 5.3.1 Darstellung des forschungsmethodischen Vorgehens
- 5.3.2 Festlegung des Beobachtungsziels
- 5.3.3 Darstellung und Begründung des Beobachtungsleitfadens
- 6. PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER UNTERRICHTSEINHEIT
- 6.1 BEDINGUNGSFELD DER KLASSE
- 6.2 BESCHREIBUNG DER SCHÜLER
- 6.3 LERNZIELE UND FÖRDERSCHWERPUNKTE
- 6.4 ANALYSE DES UNTERRICHTSTHEMAS
- 6.5 FESTLEGUNG DER UNTERRICHTSMETHODE
- 6.6 ÜBERLEGUNGEN ZUM MEDIENEINSATZ
- 6.7 VERLAUFSPLANUNG DER UNTERRICHTSEINHEIT
- 6.8 REFLEXION DER UNTERRICHTSEINHEIT
- 6.9 DURCHFÜHRUNG DER TEILNEHMENDEN BEOBACHTUNG
- 7. AUSWERTUNG DER UNTERSUCHUNG
- 7.1 AUSWAHL GEEIGNETER AUSWERTUNGSVERFAHREN
- 7.1.1 Die gegenstandsbezogene Theoriebildung nach Strauss
- 7.1.2 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 7.2 BEGRÜNDUNG DES GEWÄHLTEN AUSWERTUNGSVERFAHRENS
- 7.3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER BEOBACHTUNGSBERICHTE
- 7.4 DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
- 8. RESUMÉ / AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Schule für Körperbehinderte ihre Schüler bei der Vorbereitung auf die nachschulische Wohnsituation unterstützen kann. Das Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Schule Schülern die notwendigen Kompetenzen für eine selbstbestimmte Wahl ihrer Wohnform vermitteln kann. Die Arbeit konzentriert sich dabei nicht auf die Vor- und Nachteile verschiedener Wohnformen, sondern geht davon aus, dass jede Form für unterschiedliche Bewohner optimal sein kann.
- Die Bedeutung des Wohnens für Menschen mit und ohne Behinderung
- Bedürfnisse und Erschwernisse von Menschen mit Körperbehinderung im Zusammenhang mit dem Wohnen
- Die Rolle der Schule bei der Vorbereitung auf das nachschulische Wohnen
- Konzepte für die Umsetzung des Lernbereichs „Wohnen“ im Unterricht
- Empirische Untersuchung zu einem Unterrichtsprojekt zur Wahl der Wohnform
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Schule für Körperbehinderte und ihre Schülerschaft, wobei der neue ICIDH-2-Begriff der Behinderung vorgestellt wird. Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Wohnens aus der Sicht der transaktionalen Wohntheorie und geht auf besondere Bedürfnisse und Erschwernisse von Menschen mit Körperbehinderung ein. Im dritten Kapitel wird untersucht, ob die Vorbereitung auf das nachschulische Wohnen eine Aufgabe der Schule für Körperbehinderte ist, anhand von Empfehlungen, Richtlinien und Lehrplänen sowie Fachliteratur der Körperbehindertenpädagogik.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene Konzepte zur Umsetzung des Lernbereichs „Wohnen“ im Unterricht vor und entwickelt Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vorbereitung der Schüler. Das fünfte Kapitel beschreibt die Planung und Durchführung der empirischen Untersuchung, die Lücken in bestehenden Konzepten schließen und konkrete Empfehlungen für die Unterrichtspraxis liefern soll. Schließlich beleuchtet das sechste Kapitel die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zur Vorbereitung auf die Wahl der Wohnform, die im siebten Kapitel ausgewertet wird.
Schlüsselwörter
Körperbehinderung, ICIDH-2, Schule für Körperbehinderte, Wohnen, Wohnpsychologie, transaktionale Wohntheorie, Bedürfnisse, Erschwernisse, Vorbereitung auf das Wohnen, Unterrichtskonzepte, Verselbständigung, Trainingswohnen, empirische Untersuchung, Unterrichtsprojekt, Wahl der Wohnform.
- Quote paper
- Christoph Ziehm (Author), 2001, Die Vorbereitung auf die nachschulische Wohnsituation als Aufgabe der Schule für Körperbehinderte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/695