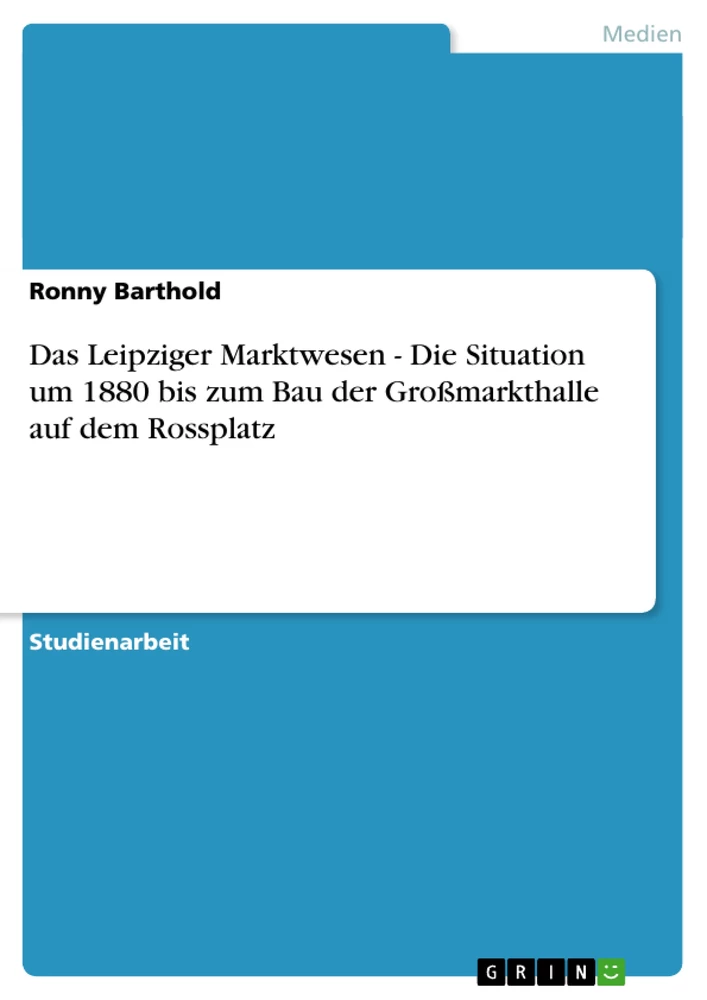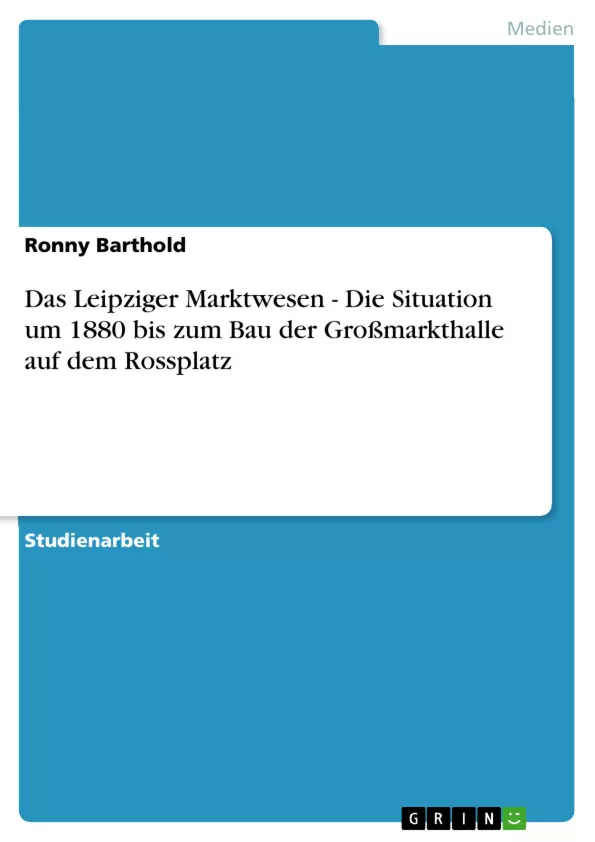Mit der Stadt Leipzig verbindet man wohl zu allererst die seit dem 16. Jahrhundert abgehaltene bedeutende Warenmesse. Aber neben dem jährlich mehrmals stattfindendem Messehandel „versorgte“ sich die Bevölkerung hauptsächlich durch wöchentlich abgehaltene so genannte „offene Wochenmärkte“.
Titel und Thema dieser Arbeit ist ein kurzer Überblick über das Wesen des Marktes in Leipzig vor dem Bau der Großmarkthalle auf dem Rossplatz. Weiterhin wird versucht, die Frage zu klären, warum es nötig erschien, dem Markthandel zum ausgehenden 19. Jahrhundert einen festen Baukörper zur Verfügung zu stellen. Hauptaugenmerk hierbei soll auf der historisch gewachsenen Gestalt des Leipziger Markthandels im letzten Jahrzehnt vor der Unterbringung des Marktes in einem speziellen Gebäude liegen.
Vor allem Händler, Warenangebot, sowie Verkaufsflächen und der eigentliche "Markt" werden auf ihr typisches Erscheinungsbild speziell für die Leipziger Märkte - in Hinsicht auf die bevorstehende Ausstellung zum vorläufigen Thema „Die Großmarkthalle auf dem Rossplatz“ - hin betrachtet.
Der Autor:
Ronny Barthold (Jahrgang 1978) studierte an der Universität Leipzig Kunstgeschichte, Linguistik sowie Ur- und Frühgeschichte. Er ist als u.a. freier Journalist für den Hörfunk tätig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Querschnitt
- 2.1. Abriss I: Zur Stadtentwicklung Leipzigs unter dem Blickwinkel des Handels
- 2.2. Abriss II: Zur Stadtentwicklung Leipzigs im letzten Drittel des ausgehenden 19. Jahrhunderts
- 2.3. Die Situation der offenen Wochenmärkte vor dem Bau der städtischen Markthalle
- 3. Der Leipziger Wochenmarkt: Versuch einer Definition
- 4. Ein Markttag: Verlauf und Einteilung
- 4.1. Produkte und Waren
- 4.2. Konkurrenten unter sich: Groß- und Kleinhändler, Ladenbesitzer und Markttreibende
- 4.3. Marktvolk, -Vergnügen und Hausierer
- 4.4. Budenstadt und Buden satt: Die Verkaufsflächen
- 5. Probleme und Unzulänglichkeiten
- 6. Der Markthallen-Gedanke
- 6.1. Proklamation der Errichtung einer Markthalle in Leipzig
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen kurzen Überblick über das Leipziger Marktwesen vor dem Bau der Großmarkthalle auf dem Rossplatz. Sie untersucht die Funktionsweise der offenen Wochenmärkte im ausgehenden 19. Jahrhundert und analysiert die Gründe für die Errichtung eines festen Markthallengebäudes. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung des Leipziger Markthandels im letzten Jahrzehnt vor der Verlagerung in die Großmarkthalle.
- Die Organisation und Struktur der offenen Wochenmärkte in Leipzig.
- Das Warenangebot und die beteiligten Händlergruppen.
- Die Probleme und Unzulänglichkeiten der offenen Märkte.
- Die Entstehung des Gedankens einer Markthalle in Leipzig.
- Die politischen und wirtschaftlichen Gründe für den Bau der Großmarkthalle.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit: einen Überblick über das Leipziger Marktwesen vor dem Bau der Großmarkthalle und die Notwendigkeit eines festen Gebäudes für den Markthandel im ausgehenden 19. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der historischen Gestalt des Leipziger Markthandels im letzten Jahrzehnt vor der Verlagerung.
2. Querschnitt: Dieser Abschnitt bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Handels in Leipzig, beginnend mit den frühesten Märkten bis hin zum ausgehenden 19. Jahrhundert. Er beleuchtet die Stadtentwicklung im Kontext des Handels und beschreibt die Situation der offenen Wochenmärkte vor dem Bau der Großmarkthalle, die bis dahin die primäre Versorgungsform der Bevölkerung darstellte. Die Beschreibung der verschiedenen Marktstandorte und -strukturen verdeutlicht die Komplexität des Leipziger Marktwesens dieser Zeit.
3. Der Leipziger Wochenmarkt: Versuch einer Definition: Dieses Kapitel definiert den Leipziger Wochenmarkt im Kontext anderer Märkte, wie Jahrmärkten und Spezialmärkten. Es beschreibt die Organisation und die Bestimmungen, die für die verschiedenen Märkte galten, einschließlich der Gebühren und Vorschriften für Händler.
4. Ein Markttag: Verlauf und Einteilung: Der Abschnitt beschreibt detailliert den Ablauf eines typischen Markttages, von der Vorbereitung der Händler bis zur Schließung des Marktes. Er beleuchtet die Rolle der Marktinspektoren und die Organisation der Marktzeiten, einschließlich der Mittagspause. Es werden die Unterschiede zwischen Sommer- und Wintermarktbetrieb sowie die Herausforderungen für Händler aus den Vororten durch die Transportbedingungen erörtert.
5. Probleme und Unzulänglichkeiten: Dieses Kapitel beschreibt die Probleme der offenen Wochenmärkte, wie die Witterungsabhängigkeit, die hygienischen Mängel und die verkehrspolitischen Schwierigkeiten. Es benennt die Unzulänglichkeiten hinsichtlich Warensicherheit, Hygiene und städtischer Ästhetik, die letztendlich zur Diskussion um den Bau einer Markthalle führten.
6. Der Markthallen-Gedanke: Dieser Abschnitt behandelt die Entstehung des Gedankens, eine Markthalle in Leipzig zu errichten. Die Überlegungen des Stadtrates und die Kontaktaufnahme mit anderen Städten, die bereits Markthallen betrieben, werden dargestellt. Die Argumentation für den Bau einer Markthalle umfasst Aspekte der Hygiene, des Verkehrs, der Ästhetik und der wirtschaftlichen Vorteile.
Schlüsselwörter
Leipziger Marktwesen, offene Wochenmärkte, Großmarkthalle, Stadtentwicklung Leipzig, Handel, Groß- und Kleinhändler, Markthallenbau, 19. Jahrhundert, Marktordnung, Verkehrsprobleme, Hygiene.
Häufig gestellte Fragen zum Leipziger Marktwesen im ausgehenden 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Leipziger Marktwesen vor dem Bau der Großmarkthalle auf dem Rossplatz im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie untersucht die Funktionsweise der offenen Wochenmärkte und analysiert die Gründe für die Errichtung eines festen Markthallengebäudes. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung des Leipziger Markthandels im letzten Jahrzehnt vor der Verlagerung in die Großmarkthalle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Organisation und Struktur der offenen Wochenmärkte, das Warenangebot und die beteiligten Händlergruppen (Groß- und Kleinhändler, Ladenbesitzer, Markttreibende), die Probleme und Unzulänglichkeiten der offenen Märkte (Witterungsabhängigkeit, Hygiene, Verkehr), die Entstehung des Gedankens einer Markthalle und die politischen und wirtschaftlichen Gründe für deren Bau.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Querschnitt (mit Unterkapiteln zur Stadtentwicklung Leipzigs und der Situation der Wochenmärkte), Definition des Leipziger Wochenmarktes, Beschreibung eines Markttages (mit Unterkapiteln zu Produkten, Händlern, Marktvolk und Verkaufsflächen), Probleme und Unzulänglichkeiten der offenen Märkte, der Markthallen-Gedanke (inkl. der Proklamation des Baus) und abschließende Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was sind die wichtigsten Probleme der offenen Wochenmärkte gewesen?
Die offenen Wochenmärkte litten unter Witterungsabhängigkeit, hygienischen Mängeln, verkehrspolitischen Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten hinsichtlich Warensicherheit und städtischer Ästhetik. Diese Probleme führten letztendlich zur Diskussion um den Bau einer Markthalle.
Welche Gründe gab es für den Bau der Großmarkthalle?
Der Bau der Großmarkthalle wurde durch verschiedene Faktoren motiviert: die Verbesserung der Hygiene, die Lösung von Verkehrsproblemen, die Steigerung der städtischen Ästhetik und die Schaffung wirtschaftlicher Vorteile. Die Überlegungen des Stadtrates und der Vergleich mit anderen Städten, die bereits Markthallen betrieben, spielten dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Akteure waren am Leipziger Marktwesen beteiligt?
Am Leipziger Marktwesen waren diverse Akteure beteiligt, darunter Groß- und Kleinhändler, Ladenbesitzer, Markttreibende, Marktinspektoren und das Marktvolk (einschließlich Hausierer).
Welche Art von Waren wurde auf den Märkten angeboten?
Die Arbeit beschreibt das Warenangebot detailliert im Kapitel "Ein Markttag: Verlauf und Einteilung", wobei die genaue Auflistung der angebotenen Produkte aus dem Text hervorgeht.
Wann spielt die beschriebene Zeit der Leipziger Marktgeschichte?
Die Arbeit konzentriert sich auf das ausgehende 19. Jahrhundert, insbesondere auf das letzte Jahrzehnt vor dem Bau der Großmarkthalle.
- Quote paper
- Ronny Barthold (Author), 2005, Das Leipziger Marktwesen - Die Situation um 1880 bis zum Bau der Großmarkthalle auf dem Rossplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/69102