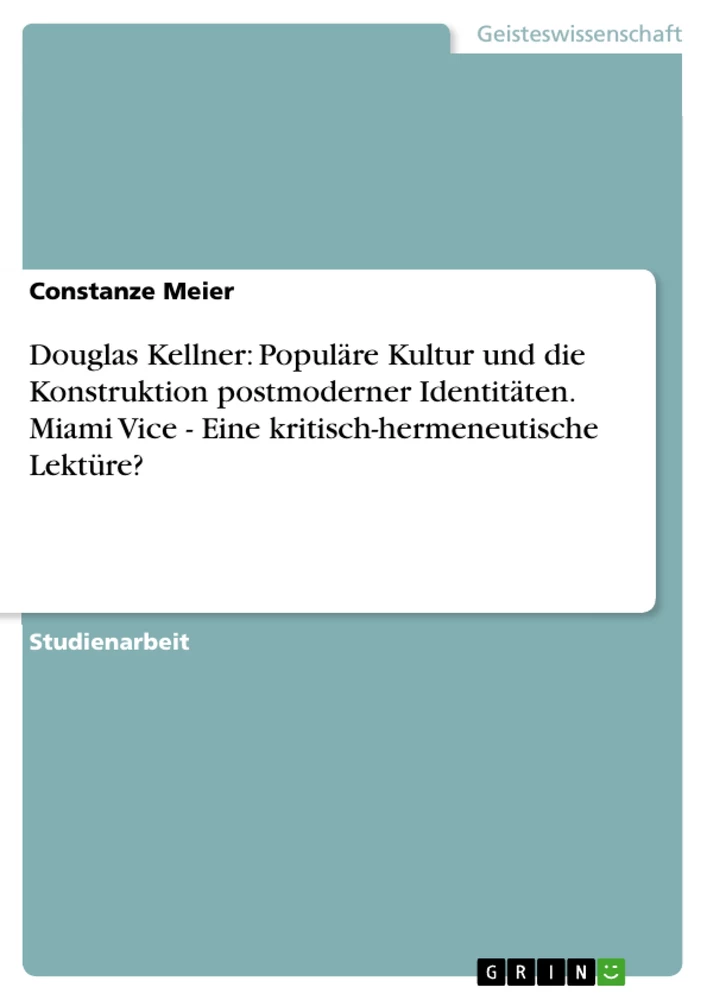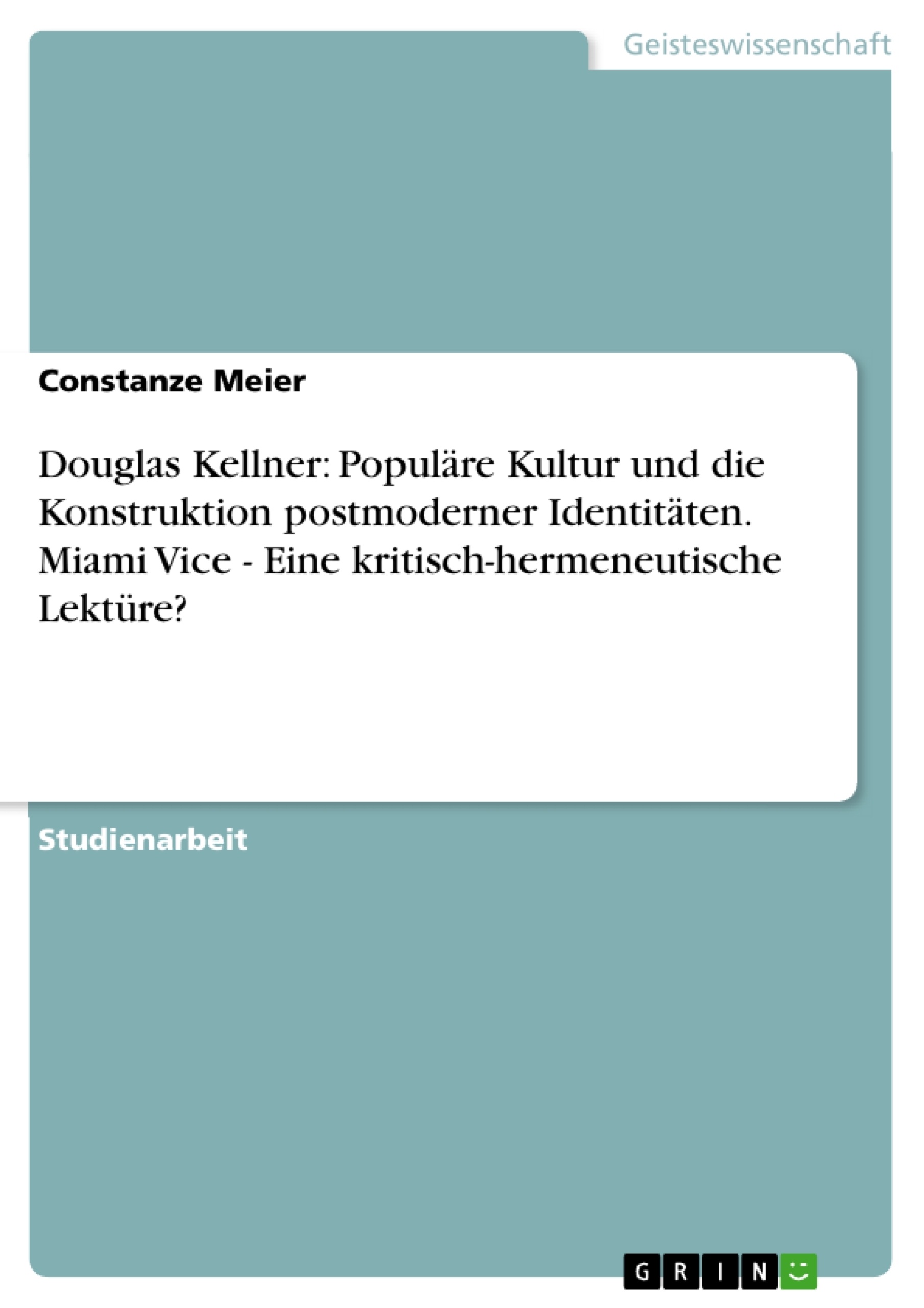Anfang der 80er Jahre wurde die Serie Miami Vice nicht nur in den USA und in Deutschland
als die beliebteste Fernsehserie gefeiert. Vor allem die atmosphärischen Bilder der Serie
sorgten für eine Stimmung, die sich an der damals neuen, populären Videoclipästhetik
orientierte. Auch die beiden Protagonisten Crockett (Don Johnson) und Tubbs (Philip Michael
Thomas), die durch ihr unkonventionelles Aussehen und Verhalten auffielen, setzten für die
nächsten Jahre Trends. Die Handlungen selbst thematisierten Drogenhandel, Prostitution und
den Lebensstil des „kriminellen Milieus“, sowie Geldwäsche und die Rolle, die dabei die
Banken einnehmen. Keine Stadt eignete sich dafür als Schauplatz besser als Miami, durch den
Bezug zur lateinamerikanischen Kultur als Zwischenstation für den internationalen
Drogenhandel geltend.
Vor den Kulissen des ‚Art Deco Districts’, der modernen Architektur der 30er und 40er Jahre
und den kräftigen Farben Südfloridas spielt sich das Leben der ‘High-TechÜberflussgesellschaft’
ab, das der kriminellen Banden und Verbrechersyndikate, der Reichen
und Schönen. Rennboote und schnelle Autos sind längst schon fest integrierte Bestandteile
eines konsum- und freizeitorientierten Lebens, das sowohl in der Stadt als auch an den
weissen Palmenstränden pulsiert.
Im Mittelpunkt dieser Szenerie steht der Vietnam-Veteran Detective Crockett, der mit einem
Alligator, dem ehemaligen Maskottchen eines Footballteams auf einem Segelboot lebt,
schnelle Autos mag und unter seinem Armani-Blazer T-Shirts trägt und in Lederschuhen ohne
Socken läuft. Sein Partner Tubbs, Afro-Amerikaner, kam ursprünglich von New York nach
Miami, um den Mörder seines Bruders zu finden. Jetzt schwärmt er für alte Autos, hört Musik
der 60er Jahre und stellt in dem Zweierteam im Gegensatz zum intuitiven Crockett den
Strategen dar. Beide sind mit der Verbrechens- und Drogenszene vertraut. Als verdeckte
Ermittler werden sie von ihrem Boss Castillo auf besonders prekäre Fälle angesetzt, wobei
immer ein Einblick in die verschiedenen Milieus Miamis gewährleistet ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. POPULÄRE KULTUR UND DIE KONSTRUKTION POSTMODERNER IDENTITÄTEN
- III. MIAMI VICE
- 1. Moral
- 2. Identitäten
- 3. Das Spiel mit Identitäten
- IV. DAS LOKALE TRIFFT DAS GLOBALE
- 1. Fernsehaneignung
- 2. Das,,encoding-decoding“-Modell von Stuart Hall
- V. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die zentralen Thesen und Argumentationsreihen des Textes „Populäre Kultur und die Konstruktion postmoderner Identitäten“ von Douglas Kellner zu untersuchen und diese anhand von Folgen der Fernsehserie „Miami Vice“ zu überprüfen und gegebenenfalls zu entkräften. Im Fokus steht die Frage, wie die Serie als „sozialer Text“ die Fragmentierung und Zerbrechlichkeit postmoderner Identitäten in einer medial geprägten Welt reflektiert.
- Die Konstruktion postmoderner Identitäten in der Medienlandschaft
- Die Bedeutung von populärer Kultur für die Gestaltung von Identitäten
- Die kritisch-hermeneutische Analyse der Serie „Miami Vice“ als sozialer Text
- Die Rolle von Massenmedien in der postmodernen Gesellschaft
- Die Fragmentierung und Zerbrechlichkeit von Identitäten in der Postmoderne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Relevanz der Fernsehserie „Miami Vice“ für postmoderne Überlegungen. Der Autor stellt die beiden Protagonisten Crockett und Tubbs vor und beleuchtet die Thematik der Serienhandlung, die sich mit Drogenhandel, Prostitution und dem Lebensstil des „kriminellen Milieus“ auseinandersetzt. Des Weiteren wird die Bedeutung von Miami als Schauplatz für die Handlung der Serie hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Diskurse der Identitätsentwicklung nach Kellner beleuchtet. Er stellt den Unterschied zwischen Identitätsbegriffen in traditionellen und modernen Gesellschaften heraus. Während in vormodernen Zeiten Identität als etwas Starres und Unwandelbares betrachtet wurde, entwickelt sich der Identitätsbegriff in der Moderne zu einem veränderlichen Konstrukt, das in Bezug auf die Wahrnehmung durch den „Anderen“ definiert wird.
Kapitel drei beleuchtet die Serie „Miami Vice“ als zentralen Bestandteil der Arbeit. Der Autor thematisiert die moralischen Aspekte der Serie, untersucht die Darstellung von Identitäten und analysiert das Spiel mit Identitäten, das in der Serie zum Ausdruck kommt.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Zusammenspiel von lokalem und globalem in der Serie „Miami Vice“. Es analysiert die Fernsehaneignung und beleuchtet das „encoding-decoding“-Modell von Stuart Hall.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Populäre Kultur, Postmoderne, Identität, Medienlandschaft, „Miami Vice“, Douglas Kellner, Kritisch-hermeneutische Lektüre, Sozialer Text, Fragmentierung, Zerbrechlichkeit, „encoding-decoding“-Modell, Stuart Hall.
- Arbeit zitieren
- Constanze Meier (Autor:in), 2001, Douglas Kellner: Populäre Kultur und die Konstruktion postmoderner Identitäten. Miami Vice - Eine kritisch-hermeneutische Lektüre?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/6799