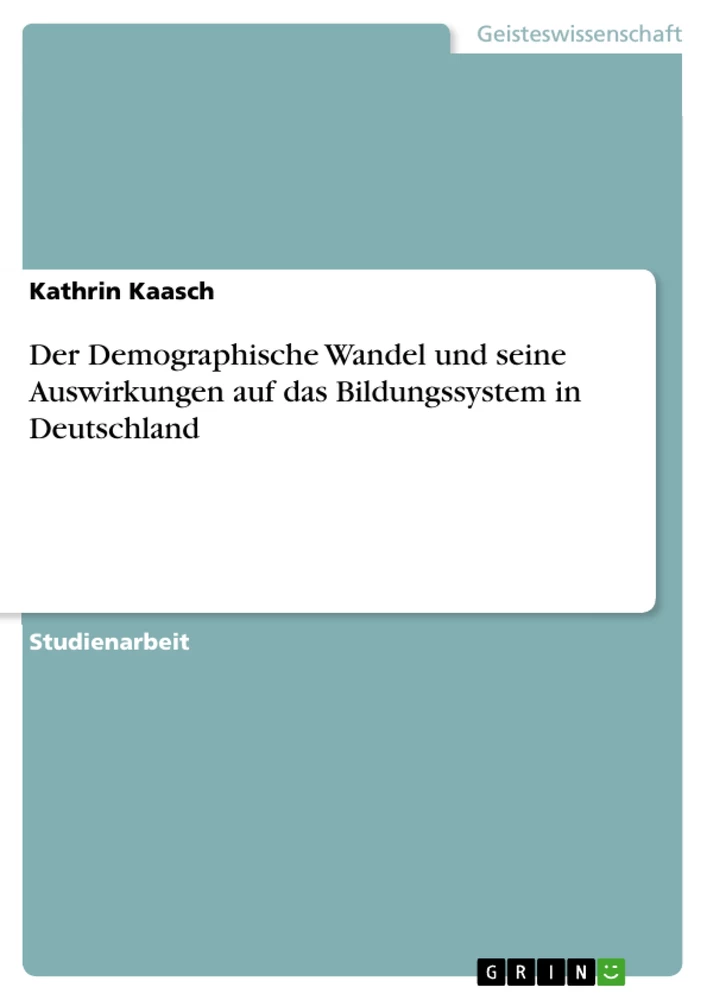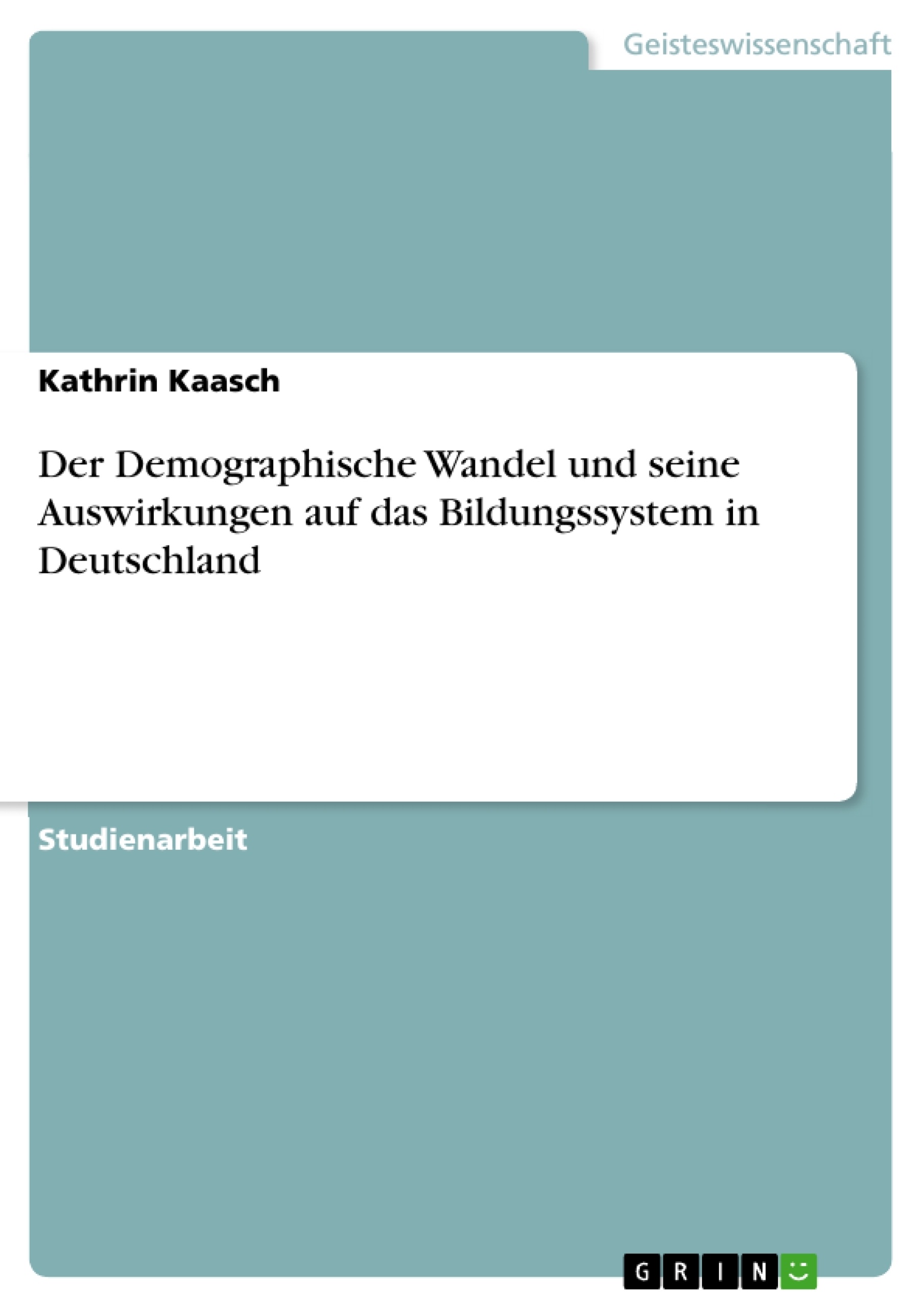In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die deutsche Politik mit den großen Problemen des Nachkriegsdeutschland beschäftigt. Die Spaltung der Welt in West und Ost, in die politischen und wirtschaftlichen Systeme Kapitalismus und „Sozialismus“ stellte gerade für die BRD als unmittelbares Grenzland eine Gefahr dar. Die innerdeutsche Spaltung, die in der Anerkennung der DDR als souveräner deutschen Staat gipfelte und die durch den Mauerbau greifbar war, stand im Mittelpunkt der Politik. Gleichzeitig galt es, die BRD Schritt für Schritt wieder als gleichberechtigten Partner in die Weltpolitik einzuführen und die volle Souveränität zurückzuerlangen. Dies gelang unter Adenauer durch die Aufnahme in die NATO 1955, durch die Mitbegründung der Europäischen Gemeinschaft in den Römischen Verträgen 1957 und durch die Einberufung erster Wehrpflichtiger im gleichen Jahr. Durch diese Anstrengungen der Politik war viel erreicht, dennoch beherrschten große außen- und innenpolitische Spannungen die politischen Geschäfte. Im Jahr 1961 begann die DDR mit dem Mauerbau und von nun an fielen wieder Schüsse im geteilten Deutschland. Schließlich rückten die Studentenunruhen 1968 die lange verdrängten Verbrechen der älteren Generation ins Rampenlicht, verlangten nach Aufarbeitung und Aufklärung. Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten lediglich die Wiederbewaffnung und die atomare Bewaffnung der Bundeswehr auf Protest gestoßen war, wurde nun der politische Umschwung weg vom Konservativismus eingeleitet. Das folgende Jahrzehnt wurde vom Terror der RAF überschattet.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 kehrte Ruhe in die Politik ein. Erst mit dem Regierungswechsel 1998 kam das lange verdrängte, aber lange schon bekannte Problem des demographischen Wandels auf die Tagesordnung der Politik. Durch ihn sind die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme gefährdet. Auch die Bildung und das Bildungssystem rückte nun, ausgelöst durch internationale Studien, wie Pisa oder Iglu, wieder in den Fokus der Politik und somit der Bevölkerung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung: Sozialstruktur, Demographischer Wandel
- Aspekte des demographischen Wandels in der BRD
- Alterung
- Wanderungen
- Folgen für die künftige Bevölkerungsstruktur der BRD
- Niedrige Geburtenraten
- Alterung
- Bevölkerungsrückgang
- Zuwanderung und Wachstum des multiethnischen Segments
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf das deutsche Bildungs- und Schulsystem
- Wachsender Anteil nicht-deutscher Schüler
- Lebenslange Weiterbildung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den demographischen Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die Bildung auf den Wandel und dessen Folgen reagieren kann, um zu verhindern, dass die Gesellschaft von ihrem Umbruch unvorbereitet getroffen wird.
- Analyse der demographischen Fakten und Prognosen in Deutschland
- Bedeutung des demographischen Wandels für die Sozialstruktur Deutschlands
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf das deutsche Bildungssystem
- Möglichkeiten und Herausforderungen für die Bildung, um auf den demographischen Wandel zu reagieren
- Bewertung der Bedeutung von lebenslanger Weiterbildung im Kontext des demographischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den demographischen Wandel als ein zentrales Problem der heutigen Gesellschaft dar und skizziert den historischen Kontext. Sie betont die Bedeutung des Themas für die Politik und die Bildung, insbesondere in Bezug auf die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme und internationale Bildungsstudien wie PISA und Iglu.
- Begriffserklärung: Dieses Kapitel erläutert die Begriffe "Sozialstruktur" und "Demographischer Wandel" im Detail. Es verdeutlicht den Unterschied zwischen demographischen und sozialstrukturellen Analysen und beschreibt die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs "Sozialstruktur" in der Literatur.
- Aspekte des demographischen Wandels in der BRD: Dieses Kapitel beleuchtet die demographischen Veränderungen in Deutschland, insbesondere die Alterung der Gesellschaft. Es analysiert die Rolle von Säuglingssterblichkeit, Lebenserwartung, Geburtenrate und Wanderungen bei der Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung.
- Folgen für die künftige Bevölkerungsstruktur der BRD: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die zukünftige Bevölkerungsstruktur Deutschlands. Es analysiert die Folgen von niedrigen Geburtenraten, Alterung, Bevölkerungsrückgang und Zuwanderung.
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf das deutsche Bildungs- und Schulsystem: Dieses Kapitel behandelt die Folgen des demographischen Wandels für das deutsche Bildungssystem. Es beleuchtet den wachsenden Anteil nicht-deutscher Schüler und die zunehmende Bedeutung der lebenslangen Weiterbildung.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, Sozialstruktur, Alterung, Geburtenrate, Wanderung, Bildungssystem, Lebenslange Weiterbildung, Multiethnische Gesellschaft, Bildungsreformen.
- Quote paper
- Kathrin Kaasch (Author), 2004, Der Demographische Wandel und seine Auswirkungen auf das Bildungssystem in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/67091