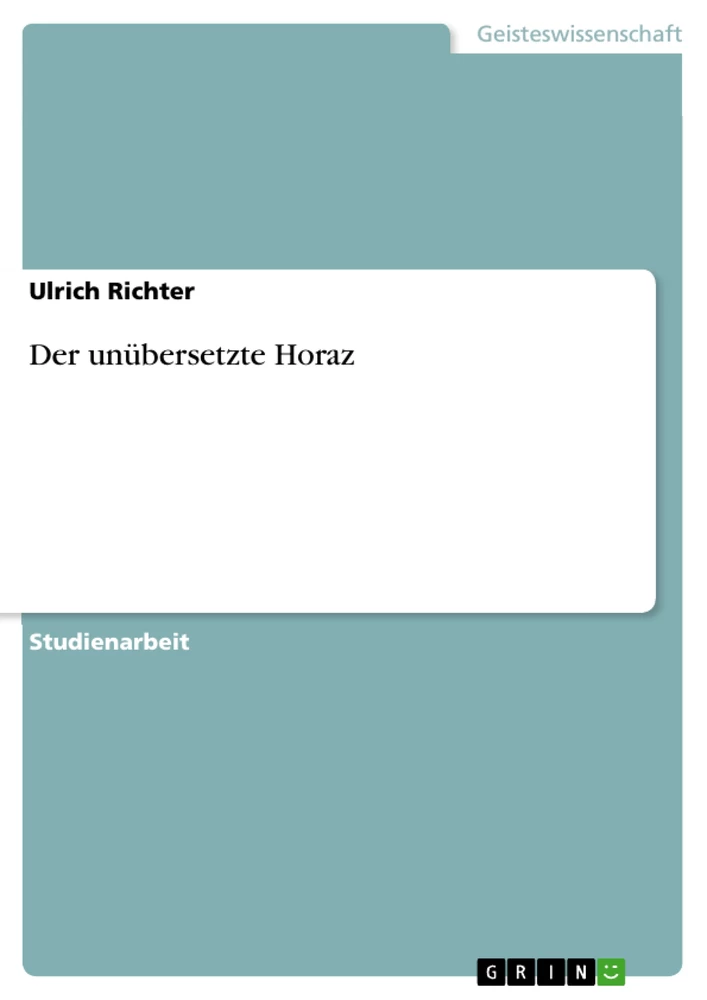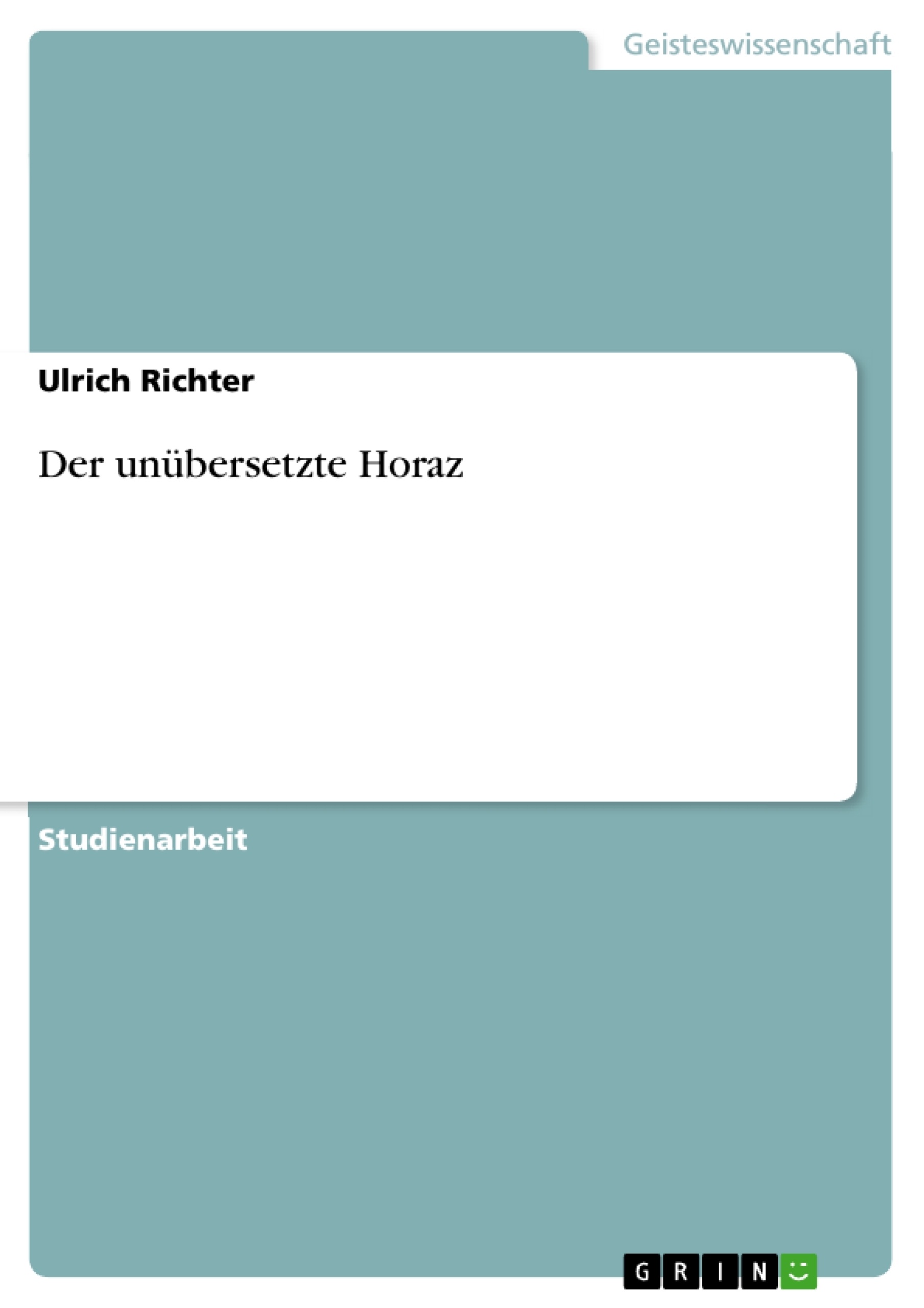„Übersetzen tu ich nicht, und wenn du mich auf den Rost legst.“ Schon Mörike sträubte sich vor dem Übersetzen (als Broterwerb), und doch sollte er sich zehn Jahre nach diesem Ausspruch an die Übersetzung des Horaz machen. Am Anfang des Übersetzens steht also der Widerstand gegen das Übersetzen. Der Anfang des Übersetzens kann ganz schnell das Ende des Übersetzens bedeuten.
So hat man Horaz nicht nur übersetzt, man hat ihn auch nicht übersetzt. Was banal klingt, hat einen tieferen Sinn. Aus den unterschiedlichsten Motiven weigern sich Übersetzer, das Original sinngemäß oder möglichst treu zu übersetzen. Nahe liegende Motive wie Vermeidung von Obszönität oder Vulgarität spielen zwar eine Rolle, sind aber für das Nicht-Übersetzen nicht allein ausschlaggebend.
Unser Augenmerk richtet sich vor allem auf das 18. Jahrhundert. Die Auseinandersetzung mit der deutschen, englischen und französischen Horaz-Rezeption – vertreten durch Wieland, Pope und La Beaumelle – soll die Übersetzungsarbeit der damaligen Zeit illustrieren. Dabei sollen die unterschiedlichen Beweggründe der jeweiligen Übersetzer für das Nicht-Übersetzen aufgezeigt werden.
Horaz ist nicht nur kommentiert, er ist auch nicht kommentiert worden. Was für das Übersetzen des Horaz gilt, gilt genauso für die Kommentierung des Horaz. Zwei Kommentare des Horaz aus dem 20. bzw. 21. Jahrhundert sollen dahingehend untersucht werden, wann und wieso ein Kommentar sich eines Kommentars enthält. Dabei wird sich zeigen, daß auch das moderne Zeitalter Grenzen der Scham kennt, die die sexuelle Revolution der 60er Jahre aufzuheben versucht hatte.
Der unübersetzte, unkommentierte und ungeliebte Horaz: Vielleicht kann uns dieser Horaz mehr über uns selbst sagen als der übersetzte, kommentierte und geliebte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vom Anfang des Übersetzens.
- II. Der unübersetzte Horaz - Horaz im 18. Jahrhundert
- 1. La Beaumelle
- 1.1. Die Tradition der „,belles infidèles\".
- 1.2. Le bon goût ........
- 2. Pope......
- 2.1. Die Form der Imitation .\n
- 2.2. Imitations of Horace
- 3. Wieland
- 3.1. Wielands Übersetzungsmaximen ....
- 3.2. Wielands Nicht-Übersetzen..\n
- III. Der ungeliebte Horaz – Lessing versus Müller
- IV. Der unkommentierte Horaz - Fraenkel und Maurach........
- 1. Der textimmanente Zugang
- 2. Deutungskategorien
- 3. Geschmack.
- V. Vom Ende des Übersetzens ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen der Übersetzung und Nicht-Übersetzung des Werkes von Horaz. Der Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Motiven, die Übersetzer im Laufe der Geschichte zum Nicht-Übersetzen oder zur selektiven Übertragung von Horaz' Werk bewogen haben.
- Die Entwicklung der Horaz-Rezeption im 18. Jahrhundert mit Fokus auf die Übersetzungsarbeit von Wieland, Pope und La Beaumelle
- Der Einfluss des „expurgation” und „bowdlerization” auf die Übersetzung von Horaz
- Die Debatte um die Interpretation von Horaz, dargestellt am Beispiel von Müller und Lessing
- Die Rolle der Kommentierung bei der Rezeption von Horaz und die Entstehung von „unkommentierten” Werken
- Die Frage der Übersetzung und Kommentierung von Horaz in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Vom Anfang des Übersetzens: Der Text beleuchtet die unterschiedlichen Motive, die Übersetzer im Laufe der Geschichte zum Nicht-Übersetzen von Horaz geführt haben. Es werden dabei die Begriffe „Expurgation“ und „Bowdlerization“ eingeführt und mit konkreten Beispielen erläutert.
- II. Der unübersetzte Horaz - Horaz im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rezeption des Horaz im 18. Jahrhundert. Es werden die Übersetzungsansätze von Wieland, Pope und La Beaumelle im Kontext der jeweiligen Zeit und mit Bezug auf ihre persönlichen Motivationen untersucht.
- III. Der ungeliebte Horaz – Lessing versus Müller: Der Text analysiert die gegensätzlichen Positionen von Lessing und Müller in Bezug auf die Interpretation des Horaz. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit sich die Interpretation von Horaz an der Moral des jeweiligen Zeitalters orientiert.
- IV. Der unkommentierte Horaz - Fraenkel und Maurach: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kommentierung von Horaz und analysiert zwei Kommentare aus dem 20. bzw. 21. Jahrhundert. Es werden die Gründe für das Weglassen von bestimmten Aspekten des Werkes im Rahmen der Kommentierung untersucht.
Schlüsselwörter
Der Text konzentriert sich auf die zentralen Themen der Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte von Horaz. Hierbei stehen die Begriffe "Expurgation" und "Bowdlerization", die verschiedene Formen der Bearbeitung von Texten beschreiben, im Vordergrund. Weitere wichtige Konzepte sind die "Imitation" als literarische Gattung, die Frage nach der Moralität von Texten und deren Relevanz für die Übersetzung sowie die Rolle der Kommentierung bei der Interpretation von Horaz.
- Arbeit zitieren
- Ulrich Richter (Autor:in), 2006, Der unübersetzte Horaz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66459