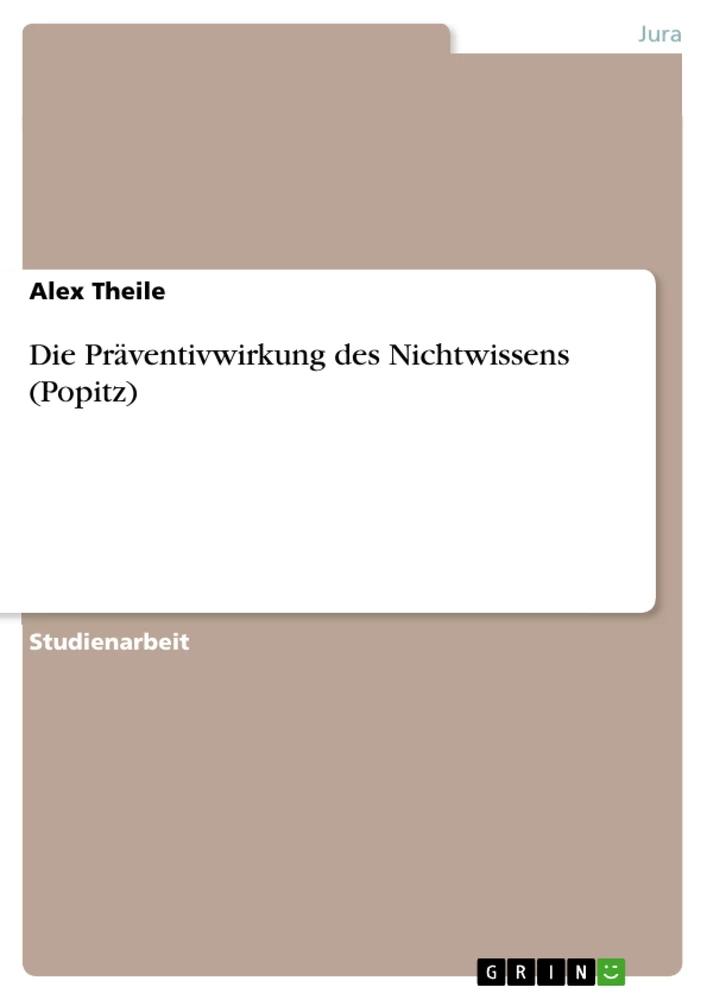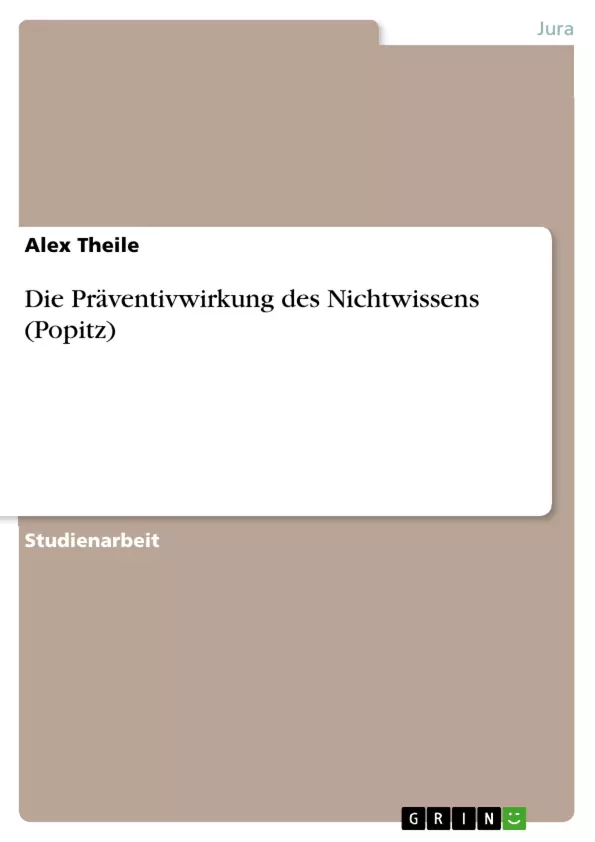Anlässlich einer Vortragsreihe mit dem Titel „Zur Einheit der Rechts- und Staatswissenschaften“ hielt Heinrich Popitz am 23.01.1967 an der Universität Freiburg einen Vortrag unter dem Titel: „Über die Präventivwirkung des Nichtwissens“.
Dieser Vortrag sollte unter anderem als Vorlage für sein 1980 erschienenes Buch „Die Normative Konstruktion von Gesellschaft“1 dienen, welches heute zu den Klassikern der soziologischen Literatur zählt.
Heinrich Popitz wurde 1925 geboren. Er studierte unter anderem Philosophie, Geschichte und Ökonomie. Im Jahr 1957 habilitierte er im Fach Soziologie und wurde 1959 zur Professur nach Basel gerufen. Sein weiterer Weg führte ihn 1964 nach Freiburg, dort wurde er Gründungsdirektor des Institutes für Soziologie. Die Zeit an der Universität Freiburg wurde 1971 durch eine Berufung an die New School for Social Research in New York unterbrochen. Später kehrte er nach Freiburg zurück und dozierte bis ins Jahr 2002, in dem er verstarb, weiter an „seinem“ Institut.
Popitz wurde unter anderem durch Geiger geprägt, in dessen Theorien er Kritik aber auch Würdigungswertes fand. In dem Vortrag, auf den sich die nächsten Seiten beziehen werden, ist dieser Einfluss klar zu erkennen. Zudem sieht man in seinem Vortrag eine eindeutige Ablehnung des funktionalistischen „Strafrechtsansatzes“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritik an der Soziologie
- Theoretische Gründe gegen eine Gesellschaft permanenter Sanktionierung
- „Ist“ vs. „Muss“
- Privat vs. Öffentlich
- Muss vs. Grenzen
- Erstes Zwischenergebnis
- Empirische Gründe gegen eine Gesellschaft permanenter Sanktionierung
- Das entlastete Normsystem
- Verhaltensgeltung
- Dunkelziffer
- Zweites Zwischenergebnis
- Der Alltag
- Die Wissenschaft
- Das entlastete Sanktionssystem
- Das entlastete Normsystem
- Zusammenfassung
- Schlussbemerkung
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Vortrag von Heinrich Popitz „Über die Präventivwirkung des Nichtwissens“ kritisiert die Funktionalismus-Theorien in der Soziologie und beleuchtet, warum eine Gesellschaft permanenter Sanktionierung unrealistisch ist. Der Vortrag analysiert theoretische und empirische Gründe, warum eine Gesellschaft nicht dauerhaft auf Normbrüche mit Strafen reagieren kann.
- Kritik an der Soziologie als Wissenschaft der Überbegriffe
- Widerlegung des funktionalistischen Strafrechtsansatzes
- Analyse der Bedingungen für eine Gesellschaft permanenter Sanktionierung
- Diskussion der Grenzen der Informationsbeschaffung und -speicherung
- Bedeutung der Informationslücke für das Funktionieren von Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Vortrag „Über die Präventivwirkung des Nichtwissens“ von Heinrich Popitz im Kontext seiner wissenschaftlichen Arbeit vor. Popitz kritisiert die Soziologie für ihre Verwendung von allgemeinen Begriffen und die daraus resultierende Unfähigkeit, sich mit konkreten Themen zu befassen. Im zweiten Kapitel analysiert Popitz verschiedene Ansätze der Soziologie zum Thema Strafe und kritisiert deren funktionalistische Perspektive, die die Bedeutung negativer Sanktionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt überbewertet.
Im dritten Kapitel beleuchtet Popitz die theoretischen Gründe, die gegen eine Gesellschaft permanenter Sanktionierung sprechen. Er argumentiert, dass eine solche Gesellschaft nur in einer perfekten „verhaltensinformierten Gesellschaft“ möglich wäre, in der alle Informationen über das Verhalten jedes Einzelnen verfügbar sind. Popitz stellt fest, dass die Realität diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Der „Istzustand“ der Gesellschaft sei geprägt durch Charakterbilder und Einschätzungen, die die fehlenden Informationen über andere kompensieren.
Popitz zeigt zudem auf, dass eine klare Trennung zwischen privatem und öffentlichem Verhalten in der realen Gesellschaft besteht, was eine vollständige Informationsbeschaffung und -speicherung über alle Individuen unmöglich macht. Er erläutert auch, dass es objektive Grenzen gibt, die eine vollständige Informationsbeschaffung verhindern, wie z.B. technische und organisatorische Einschränkungen, sowie subjektive Grenzen wie das psychische Unbehagen der Betroffenen und Widerstand gegen Verhaltenskontrolle.
Schlüsselwörter
Präventivwirkung des Nichtwissens, Funktionalismus, Soziologie, Strafrecht, Normbruch, Sanktionierung, Informationsbeschaffung, Verhaltenskontrolle, Informationslücke, Gesellschaft, Charakterbild, Privatsphäre, Öffentlichkeit, Solidarität, technische Grenzen, organisatorische Grenzen, subjektive Grenzen
- Quote paper
- Alex Theile (Author), 2004, Die Präventivwirkung des Nichtwissens (Popitz), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/65715