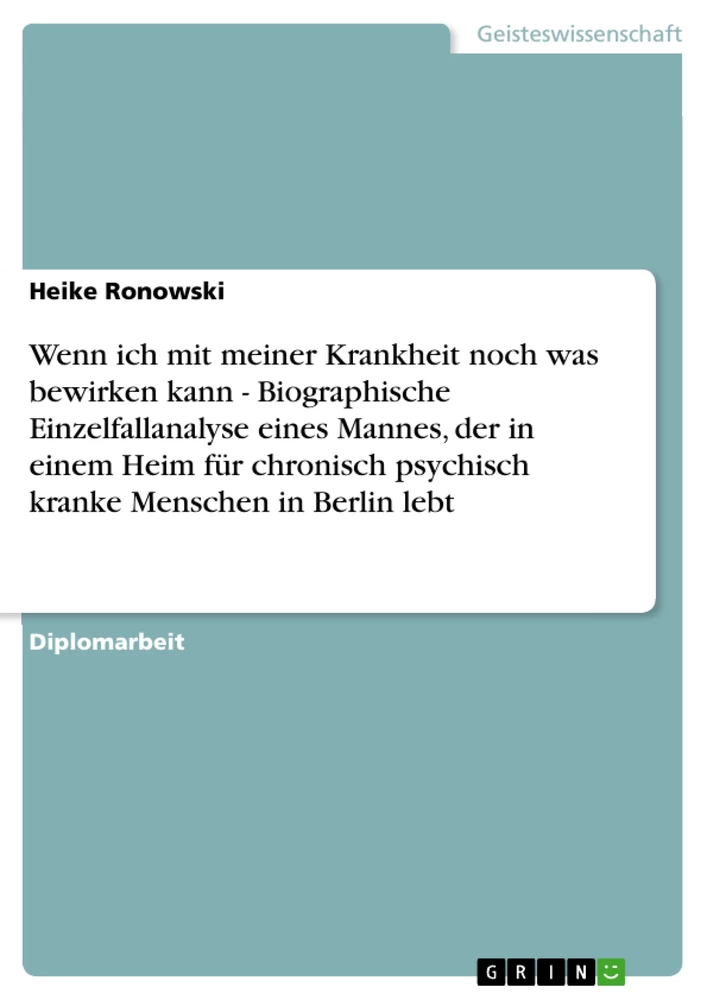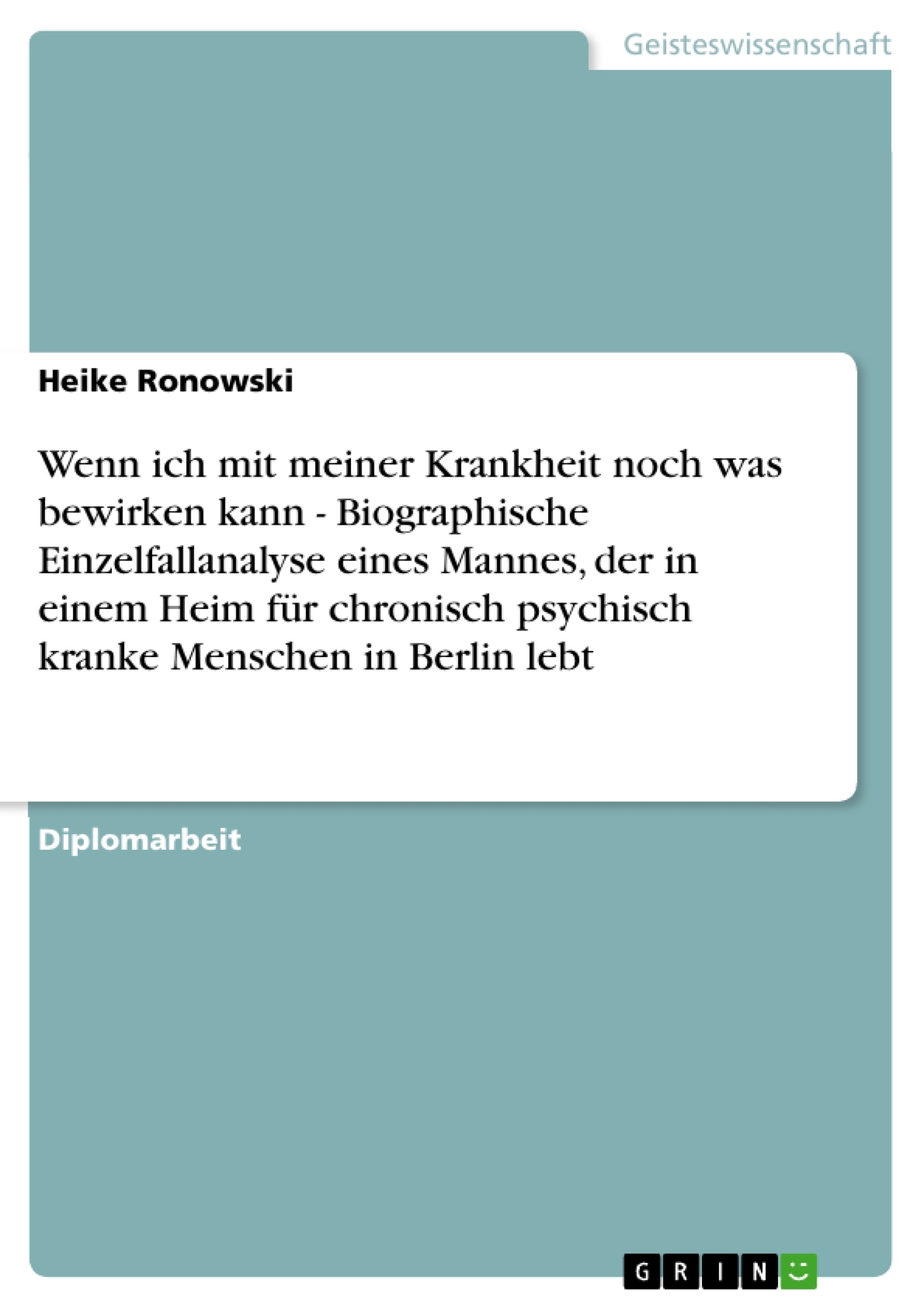1 Einleitung
Die vorliegende Diplomarbeit wird im Rahmen des Forschungsprojektes Bestandsauf-nahme der Steuerung der Unterbringung und Betreuungsqualität chronisch psychisch kranker Menschen aus Berlin in Heimen der Freien Universität Berlin (Prof. Dr. Manfred Zaumseil) und der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (Prof. Dr. Ralf-Bruno Zimmermann) durchgeführt. Die Verfasserin der Arbeit ist als Studentin des Fachbereiches Erziehungswissenschaft und Psychologie im Diplom-studiengang Psychologie der Freien Universität Berlin an diesem Projekt beteiligt.
In Folge der Psychiatrie-Enquête (1975) wurden die meisten psychiatrischen Langzeit-kliniken aufgelöst und die Betten auf den psychiatrischen Stationen weitestgehend abgebaut. Das Ziel einer gemeindenahen Versorgung wurde damit jedoch nicht für alle psychisch erkrankten Menschen erreicht. In Berlin gab es eine große Anzahl psychia-trischer Krankenhausbetten, die in Pflegeheimbetten umgewandelt wurden (Hoffmann, 2003).
Nach wie vor lebt ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Heimen, davon ca. 140.000 Menschen in Heimen der Behindertenhilfe und etwa 660.000 in Alten- und Pflegeheimen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 1998). Auch in Über-gangswohnheimen sind Menschen mit einer chronisch psychischen Erkrankung auf Dauer untergebracht.
Aufgrund dieses Sachverhaltes wird u.a. vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene e.V. (Laupichler, 2002) und der Forschungsgemeinschaft „Menschen in Heimen“ (Dörner; Röttger-Liepmann; Hopfmüller, 2001) eine Enquête der Heime gefordert, um das bisherige Heimsystem einer Überprüfung zu unterziehen.
Da ich mich im Rahmen meines Studiums bereits im Weddinger Psychoseseminar für das Erleben von Psychosen und deren Auswirkungen auf die Biographie eines Menschen interessiert habe, verfolge ich im Rahmen des o.g. Projektes das Ziel, eine biographische Einzelfallanalyse eines Mannes, der in einem Heim für chronisch psychisch kranke Menschen in Berlin lebt, vorzunehmen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Entwicklung der Fragestellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Forschung zur Unterbringung von chronisch psychisch kranken Menschen
- 2.1 Exkurs: Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten für chronisch psychisch kranke Menschen
- 2.2 Chronizität
- 2.3 Enthospitalisierung
- 2.4 Alternative Ansätze im Umgang mit chronisch psychisch kranken Menschen
- 2.4.1 Alternative Wohnformen
- 2.4.2 Alternative Behandlungsansätze
- 2.5 Heimforschung
- 2.5.1 Heimkritik
- 2.5.2 Soziale Exklusion psychisch kranker Menschen
- 2.5.3 Spezialfall Übergangswohnheim
- 2.5.4 Studien zur Lebensqualität
- 2.6 Detlef Petry: Die Wanderung. Eine trialogische Biographie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren.
- 3 Methodisches Vorgehen
- 3.1 Wahl des Forschungsansatzes
- 3.1.1 Qualitative Forschung
- 3.2 Feldzugang
- 3.2.1 Kontaktaufnahme zu den Bewohnern des Übergangswohnheimes
- 3.3 Entscheidungsfindung
- 3.3.1 Das Übergangswohnheim
- 3.3.2 R.K.
- 3.4 Unterschiedliche Perspektiven
- 3.4.1 Kontaktaufnahme zum Vater
- 3.4.2 Kontaktaufnahme zu den Geschwistern
- 3.4.3 Betreuerperspektive
- 3.4.4 Verlaufsakte
- 3.4.5 Krankenakte
- 3.4.6 Forscherin
- 3.5 Angewandte Methoden der Erhebung und Auswertung
- 3.5.1 Feldforschung und teilnehmende Beobachtung
- 3.5.2 Gespräche
- 3.5.3 Interview mit R.K.
- 3.5.4 Interview mit der Pflegedienstleitung
- 3.5.5 Auswertung der Daten
- 3.5.6 Rekonstruktion von subjektiver Wirklichkeit
- 3.5.7 Die Validierung kommunikativ gewonnener Daten
- 3.6 Subjektivität der Forscherin
- 3.6.1 „going native“
- 3.6.2 Reaktivität im Feld
- 3.7 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 3.8 Leseanleitung / Darstellungsentscheidung
- 3.1 Wahl des Forschungsansatzes
- 4 Darstellung der Ergebnisse
- 4.1 Lebenskontext Übergangswohnheim
- 4.1.1 Beschreibung und Konzeptanalyse des untersuchten Übergangswohnheimes
- 4.1.2 Die Menschen, die im Übergangswohnheim leben
- 4.2 Biographischer Überblick von R.K.
- 4.3 Leben im Übergangswohnheim
- 4.3.1 Tagesablauf
- 4.3.2 Küchendienst
- 4.3.3 Essgewohnheiten
- 4.3.4 Beschäftigungs-/Arbeitstherapiemaßnahmen
- 4.3.5 Zimmerpflege
- 4.3.6 Medikation
- 4.3.7 Andere Termine
- 4.4 Einordnung als ein „Bewohner“ des ÜWHs
- 4.4.1 Verpflichtungen
- 4.4.2 Kommunikation
- 4.4.3 Teilnahme am Essen
- 4.4.4 Medikamenteneinnahme
- 4.4.5 Süchte / Drogen
- 4.4.6 Aggressivität / Gewalt
- 4.4.7 Manieren
- 4.4.8 Fachjargon
- 4.4.9 Grenzen
- 4.4.10 Krankheit als Daseinsberechtigung
- 4.4.11 Dauer des Aufenthaltes
- 4.4.12 Familienanbindung
- 4.5 „Ich bin sehr extrem geartet“
- 4.5.1 Selbstbeschreibung als „krank“
- 4.5.2 Drogen/Medikamente
- 4.5.3 Von „Adam Cartwright“ zu „Old Shatterhand“
- 4.6 Exkurs: Krankenakte
- 4.7 Jenseits von Krankheit
- 4.7.1 Radio hören
- 4.7.2 Lesen
- 4.7.3 Wissen um Daten und Fakten
- 4.7.4 Sammelinteresse
- 4.7.5 Zukunftsideen
- 4.7.6 Reflexionsfähigkeit
- 4.8 Beziehungen
- 4.8.1 zu Profis
- 4.8.2 zu Frauen
- 4.8.3 zu anderen Menschen
- 4.8.3.1 Freundschaften
- 4.8.3.2 „Kumpelbeziehung[en]“
- 4.8.3.3 „Mitpatienten“
- 4.8.3.4 ehemalige[...] Bewohner“
- 4.8.3.5 Mitbewohner
- 4.8.3.6 „Gruppen“
- 4.8.3.7 „Buchladen“
- 4.8.3.8 „Verkäuferin[nen]“
- 4.8.3.9 Apotheke
- 4.8.3.10 „Tante-Emma-Laden“
- 4.8.4 zur Familie
- 4.8.4.1 Vater
- 4.8.4.2 Mutter
- 4.8.4.3 Geschwister
- 4.8.5 zur Forscherin
- 4.1 Lebenskontext Übergangswohnheim
- 5 Zusammenfassung und Diskussion
- 5.1 Rekonstruktion der subjektiven Wirklichkeit
- 5.2 Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit
- 5.3 Passung zwischen Bedürfnissen und Betreuungsangebot
- 5.4 Einordnung des Werdegangs von R.K. in die Theorie
- 5.5 Methodenkritische Anmerkungen
- 5.6 Andere Wege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Lebenswelt eines chronisch psychisch kranken Mannes in einem Berliner Übergangswohnheim. Ziel ist die biographische Einzelfallanalyse, um die subjektive Wirklichkeit des Probanden zu rekonstruieren und die Passung zwischen seinen Bedürfnissen und dem Betreuungsangebot zu analysieren.
- Subjektive Lebenserfahrung eines chronisch psychisch kranken Menschen
- Interaktion und Beziehungen im Kontext des Übergangswohnheimes
- Analyse der Betreuungsqualität und der Passung zwischen Bedürfnissen und Angebot
- Methodische Reflexion der qualitativen Forschung
- Einordnung der Ergebnisse in den Kontext der bestehenden Forschung zu chronisch psychisch kranken Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Entstehung der Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Diplomarbeit. Es legt den Fokus auf die biographische Einzelfallanalyse eines Mannes in einem Heim für chronisch psychisch Kranke und die damit verbundene Fragestellung nach der Passung zwischen den Bedürfnissen des Bewohners und dem Betreuungsangebot.
2 Forschung zur Unterbringung von chronisch psychisch kranken Menschen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Forschung zum Thema Unterbringung und Betreuung chronisch psychisch kranker Menschen. Es beleuchtet verschiedene Begrifflichkeiten, die mit der Chronizität psychischer Erkrankungen einhergehen, und diskutiert den Prozess der Enthospitalisierung. Ausführlich wird auf alternative Wohn- und Behandlungsansätze eingegangen, sowie die kritische Auseinandersetzung mit Heimforschung, sozialer Exklusion und Studien zur Lebensqualität im Kontext von Heimen. Der Abschnitt über Detlef Petrys Biographie dient als Bezugspunkt für die biographische Herangehensweise der Arbeit.
3 Methodisches Vorgehen: Das Kapitel beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise der qualitativen Studie. Es erläutert die Wahl des Forschungsansatzes, den Feldzugang und die Entscheidungsfindung bezüglich des Probanden und der Forschungsstätte. Es werden die verschiedenen Perspektiven (Proband, Familie, Betreuer, Akten) und die angewandten Methoden der Datenerhebung (teilnehmende Beobachtung, Interviews) und -auswertung detailliert beschrieben, inklusive der Auseinandersetzung mit der Subjektivität der Forscherin und den Gütekriterien qualitativer Forschung.
4 Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es beschreibt den Lebenskontext des Übergangswohnheims, den biographischen Überblick des Probanden (R.K.) und sein Leben im Heim, detailliert seinen Alltag, seine Beziehungen zu Mitbewohnern, Personal und seiner Familie. Es analysiert seine Selbstwahrnehmung, seine Beziehungen und sein Leben jenseits der Krankheit. Die Analyse seiner Krankenakte bietet zusätzliche Einblicke.
Schlüsselwörter
Chronisch psychisch kranke Menschen, Übergangswohnheim, qualitative Forschung, biographische Einzelfallanalyse, Lebensqualität, soziale Exklusion, Betreuungsqualität, Rekonstruktion subjektiver Wirklichkeit, Heimforschung, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Lebenswelt eines chronisch psychisch kranken Mannes in einem Berliner Übergangswohnheim
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Lebenswelt eines chronisch psychisch kranken Mannes in einem Berliner Übergangswohnheim. Im Mittelpunkt steht eine biographische Einzelfallanalyse, um die subjektive Wirklichkeit des Probanden zu rekonstruieren und die Passung zwischen seinen Bedürfnissen und dem Betreuungsangebot zu analysieren.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die subjektive Lebenserfahrung des Probanden, seine Interaktionen und Beziehungen im Übergangswohnheim, die Betreuungsqualität und die Passung zwischen Bedürfnissen und Angebot, sowie methodische Aspekte der qualitativen Forschung und die Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden Forschungsstand.
Welche Methoden wurden angewendet?
Es wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Die Datenerhebung erfolgte durch teilnehmende Beobachtung, Interviews mit dem Probanden, seiner Familie, Betreuern und durch die Auswertung von Akten (Krankenakte, Verlaufsakte). Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, um die subjektive Wirklichkeit zu rekonstruieren.
Wer ist der Proband?
Der Proband ist ein chronisch psychisch kranker Mann, der in einem Berliner Übergangswohnheim lebt. Seine Identität wird mit den Initialen R.K. geschützt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit beschreibt den Lebenskontext des Übergangswohnheimes, den biographischen Werdegang von R.K., seinen Alltag im Heim, seine Beziehungen zu Mitbewohnern, Personal und Familie, seine Selbstwahrnehmung und sein Leben jenseits seiner Erkrankung. Die Analyse seiner Krankenakte liefert zusätzliche Einblicke. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Passung zwischen den Bedürfnissen des Probanden und dem Betreuungsangebot analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chronisch psychisch kranke Menschen, Übergangswohnheim, qualitative Forschung, biographische Einzelfallanalyse, Lebensqualität, soziale Exklusion, Betreuungsqualität, Rekonstruktion subjektiver Wirklichkeit, Heimforschung, Integration.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Forschung zur Unterbringung chronisch psychisch kranker Menschen, Methodisches Vorgehen, Darstellung der Ergebnisse und Zusammenfassung und Diskussion. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel gegliedert, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die bestehende Forschung zur Unterbringung und Betreuung chronisch psychisch kranker Menschen, zur qualitativen Forschung und zur biographischen Einzelfallanalyse. Die Arbeit bezieht sich auch auf die Heimforschung und die Diskussion um soziale Exklusion.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit rekonstruiert die subjektive und soziale Wirklichkeit des Probanden und analysiert die Passung zwischen seinen Bedürfnissen und dem Betreuungsangebot des Übergangswohnheims. Methodische Reflexionen und methodisch-kritische Anmerkungen ermöglichen eine differenzierte Bewertung der Ergebnisse und geben Anregungen für zukünftige Forschung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit der Lebenswelt chronisch psychisch kranker Menschen, qualitativer Forschung und der Betreuung psychisch kranker Menschen in Übergangswohnheimen befassen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die subjektive Erfahrung und die soziale Situation dieser Personengruppe.
- Quote paper
- Diplom-Psychologin Heike Ronowski (Author), 2005, Wenn ich mit meiner Krankheit noch was bewirken kann - Biographische Einzelfallanalyse eines Mannes, der in einem Heim für chronisch psychisch kranke Menschen in Berlin lebt, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/64821