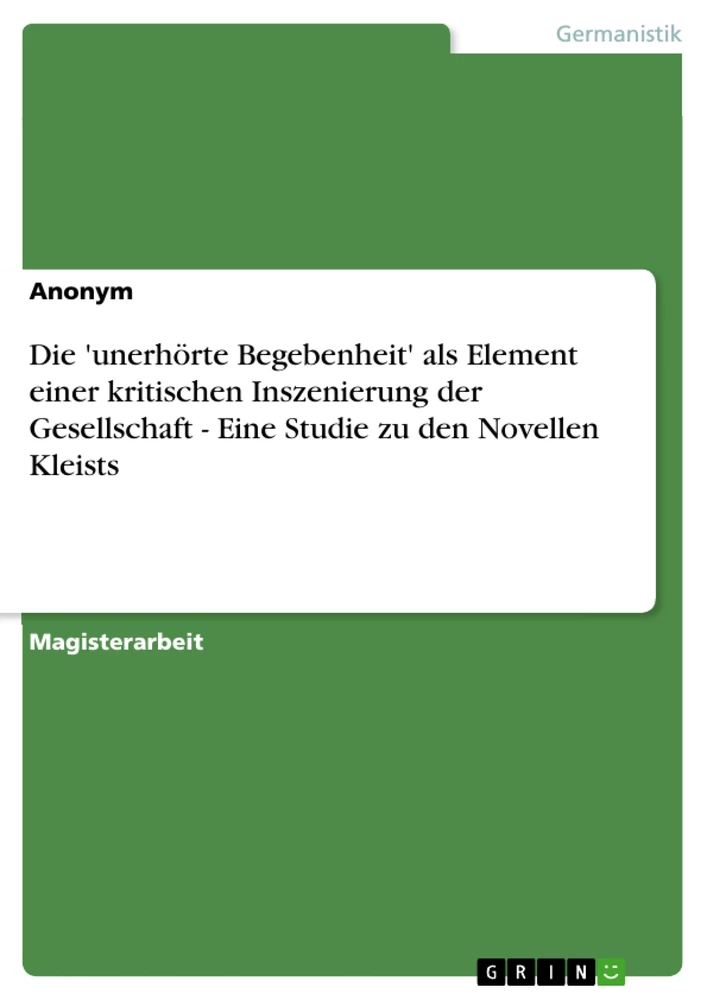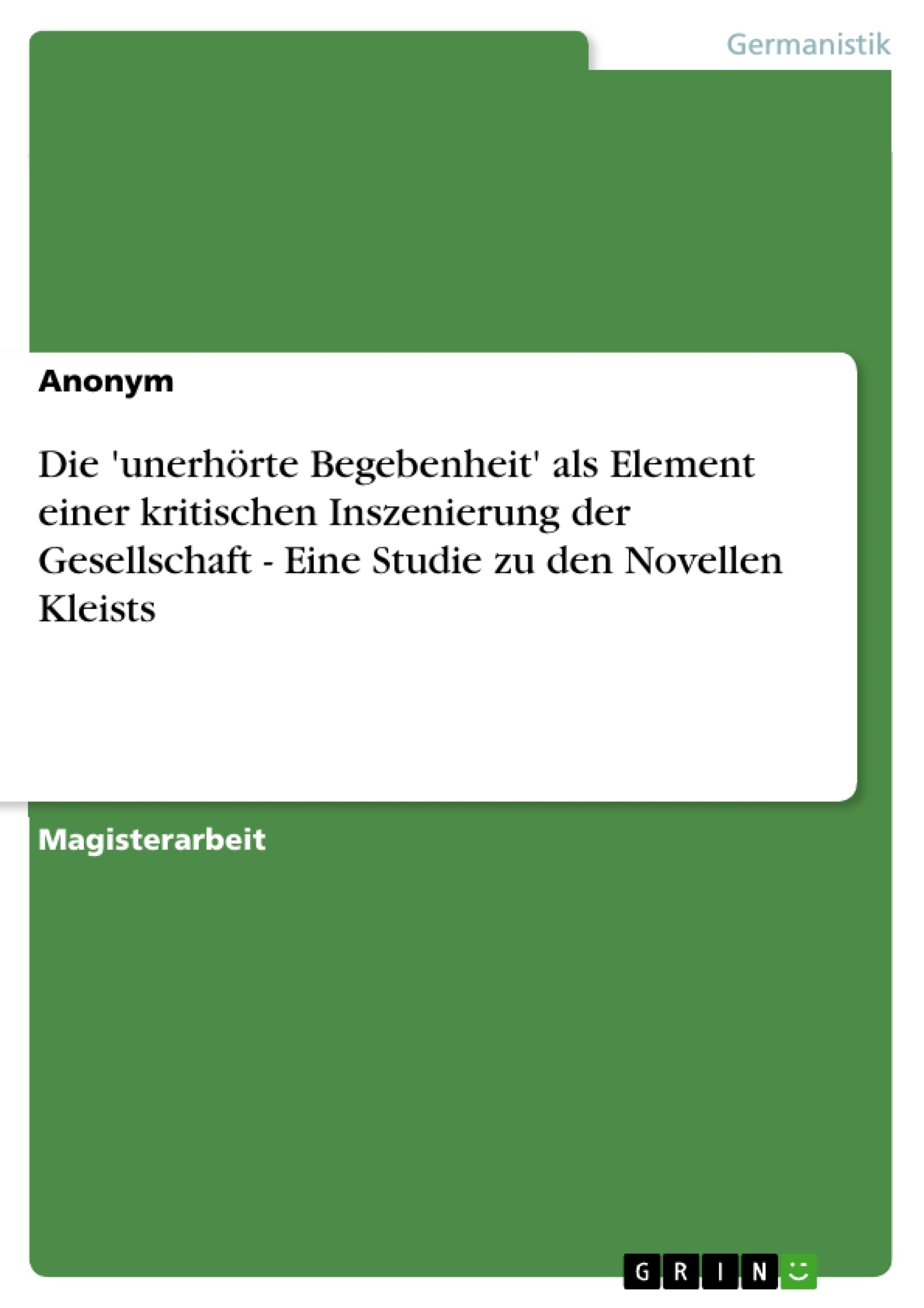Die Novellen von Kleist sind in der Literaturwissenschaft ein vielfach bearbeitetes Objekt der Forschung. Häufig steht im Mittelpunkt des Interesses seine Darstellung gesellschaftlicher Phänomene wie Liebe, Vertrauen und familiäre Konflikte, Fragen nach Recht und Gerechtigkeit oder der Religion. Jeder dieser Bereiche wurde schon mehrfach untersucht und anhand variierender Fragestellungen durch neue Aspekte bereichert. Auch diese Arbeit schließt die Darstellung der Gesellschaft in den Novellen Kleists nicht aus. Ausgangspunkt ist jedoch hier ein zentraler Begriff aus der Novellentheorie: Es soll untersucht werden, in welcher Beziehung die unerhörte Begebenheit zur Darstellung der Gesellschaftskritik in den Novellen steht.
In den Bemühungen um eine einheitliche Definition der Gattung „Novelle“ findet auch heute noch der Begriff der „unerhörten Begebenheit“ Verwendung. Doch obwohl er seit Goethe als wichtiges Element der Novelle verstanden wird, ist seine Begrifflichkeit bislang nicht klar eingegrenzt. Ein Teil der Arbeit ist deshalb der Darstellung besonderer Eigenschaften der unerhörten Begebenheit im Allgemeinen und bei Kleist im Besonderen gewidmet. Die allgemeine Definitionsproblematik des Begriffs „Novelle“ kann dabei weitgehend unberücksichtigt bleiben. Sie kommt nur dort zur Sprache, wo sie für die „unerhörte Begebenheit“ von Bedeutung ist. Das Gleiche gilt für die Differenzierung zwischen den Begriffen „Novelle“ und „Erzählung“, die in der Forschung noch immer diskutiert wird.
Es ist für diese Arbeit wenig relevant, welche Kriterien zum heutigen Stand der Forschung allgemein für eine Novelle festgelegt sind, sofern sie nicht die Begebenheit unmittelbar betreffen und ob und inwiefern Kleists Erzählungen in dieses Gefüge passen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, die novellentheoretischen Ansätze - angefangen bei Zeitgenossen Kleists bis hin zur modernen Forschung - lediglich auf den Bereich der unerhörten Begebenheit hin zu untersuchen. So soll dann eine für diese Arbeit gültige Definition der unerhörten Begebenheit entstehen, die es ermöglicht, den Zusammenhang zwischen der Begebenheit und der kritischen Inszenierung der Gesellschaft zu untersuchen. Die allgemeine Entwicklung des Begriffs „Novelle“ kann hier als bekannt vorausgesetzt werden, ebenso die Geschichte der Novelle als Erzählform. Die Entwicklung der unerhörten Begebenheit hingegen soll genauer untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Aspekte der unerhörten Begebenheit
- Literarhistorischer Kontext und Forschungslage
- Charakteristika der Begebenheit bei Kleist
- Wahrscheinlichkeit und Wahrheit
- Der Zufall als konstitutives Element der Begebenheit
- Schein und Sein – der Konflikt in der Begebenheit
- Begebenheit ohne Grenzen?
- Die Inszenierung der Gesellschaftskritik
- Die dramatischen Elemente der Novelle
- Moral oder Gesellschaftskritik – der „soziale Sinn“ in Kleists Novellen
- Zwischenbilanz
- Justiz: unerreichbare Gerechtigkeit?
- Individuum und Rechtsstaat: der Fall Michael Kohlhaas
- Parallelität von Recht und Unrecht
- Die Willkür des Junkers
- Das Standesvorurteil
- Vetternwirtschaft und Korruption
- Der Gesellschaftsvertrag und seine Auflösung
- Zwischen Genugtuung und Rachsucht
- Gott als Rechtsinstanz? Justiz im „Zweikampf“
- Zwischenbilanz
- Individuum und Rechtsstaat: der Fall Michael Kohlhaas
- Familie: ein gebrechliches Element der Gesellschaft
- Marode Familienstrukturen – „Die Marquise von O...“
- „Familienrücksichten“ als sozialer Zwang
- Gestörte Kommunikation in der Familie
- Autoritätsverlust des Patriarchen
- Lieblosigkeit und familiäre Dysfunktionalität in den Novellen
- Zwischenbilanz
- Marode Familienstrukturen – „Die Marquise von O...“
- Religion: Missbrauch des christlichen Wertesystems
- Scheinheiligkeit und Fanatismus – „Das Erdbeben in Chili“
- Die Heuchelei in der Gesellschaft
- Das trügerische Idyll
- Religiöser Wahn: Demagogie und Lynchjustiz
- Wunderglaube und Bigotterie
- Zwischenbilanz
- Scheinheiligkeit und Fanatismus – „Das Erdbeben in Chili“
- Exkurs: das Vorurteil in der „Verlobung in St. Domingo“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung gesellschaftlicher Kritik in Kleists Novellen, wobei der Fokus auf dem zentralen Begriff der „unerhörten Begebenheit“ liegt. Sie untersucht die spezifischen Eigenschaften dieser Begebenheit bei Kleist und ihre Beziehung zur Gesellschaftskritik in seinen Werken.
- Die Bedeutung der „unerhörten Begebenheit“ in Kleists Novellen
- Die Gesellschaftskritik in Kleists Werken
- Die Rolle von Recht und Gerechtigkeit in Kleists Novellen
- Die Darstellung von Familie und Religion in Kleists Werken
- Die Inszenierung von Moral und sozialem Konflikt in Kleists Novellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet den Forschungsstand zur Darstellung gesellschaftlicher Phänomene in Kleists Novellen. Sie stellt den Begriff der „unerhörten Begebenheit“ als zentralen Ausgangspunkt der Arbeit vor.
Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Einordnung der „unerhörten Begebenheit“. Es analysiert die literarhistorischen Wurzeln und Forschungslage zu diesem Begriff und untersucht die spezifischen Charakteristika der Begebenheit in Kleists Werken. Dabei werden Aspekte wie Wahrscheinlichkeit und Wahrheit, der Zufall als konstitutives Element und der Konflikt zwischen Schein und Sein beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die Inszenierung der Gesellschaftskritik in Kleists Novellen. Es beleuchtet die dramatischen Elemente der Novelle und analysiert, wie Kleist Moral und Gesellschaftskritik miteinander verwebt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Thema „Justiz“ in Kleists Novellen. Es analysiert den Konflikt zwischen Individuum und Rechtsstaat am Beispiel von „Michael Kohlhaas“ und hinterfragt die Rolle von Gott als Rechtsinstanz.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Thema „Familie“ in Kleists Novellen. Es untersucht die maroden Familienstrukturen in „Die Marquise von O...“ und analysiert die Folgen von Lieblosigkeit und familiärer Dysfunktionalität in Kleists Werken.
Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Thema „Religion“ in Kleists Novellen. Es analysiert die Scheinheiligkeit und den Fanatismus in „Das Erdbeben in Chili“ und untersucht die Folgen von Wunderglaube und Bigotterie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: „unerhörte Begebenheit“, Gesellschaftskritik, Novelle, Kleist, Recht, Gerechtigkeit, Familie, Religion, Moral, Konflikt, Schein und Sein, Wahrscheinlichkeit, Zufall, Dramaturgie, Inszenierung, Sozialer Sinn.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Die 'unerhörte Begebenheit' als Element einer kritischen Inszenierung der Gesellschaft - Eine Studie zu den Novellen Kleists, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63503