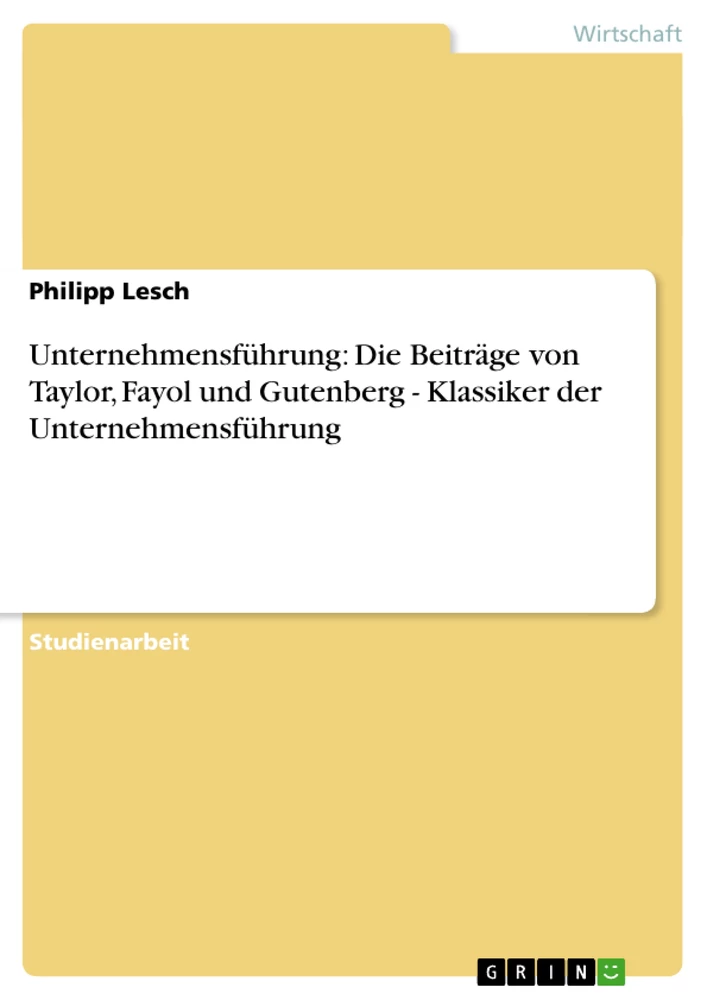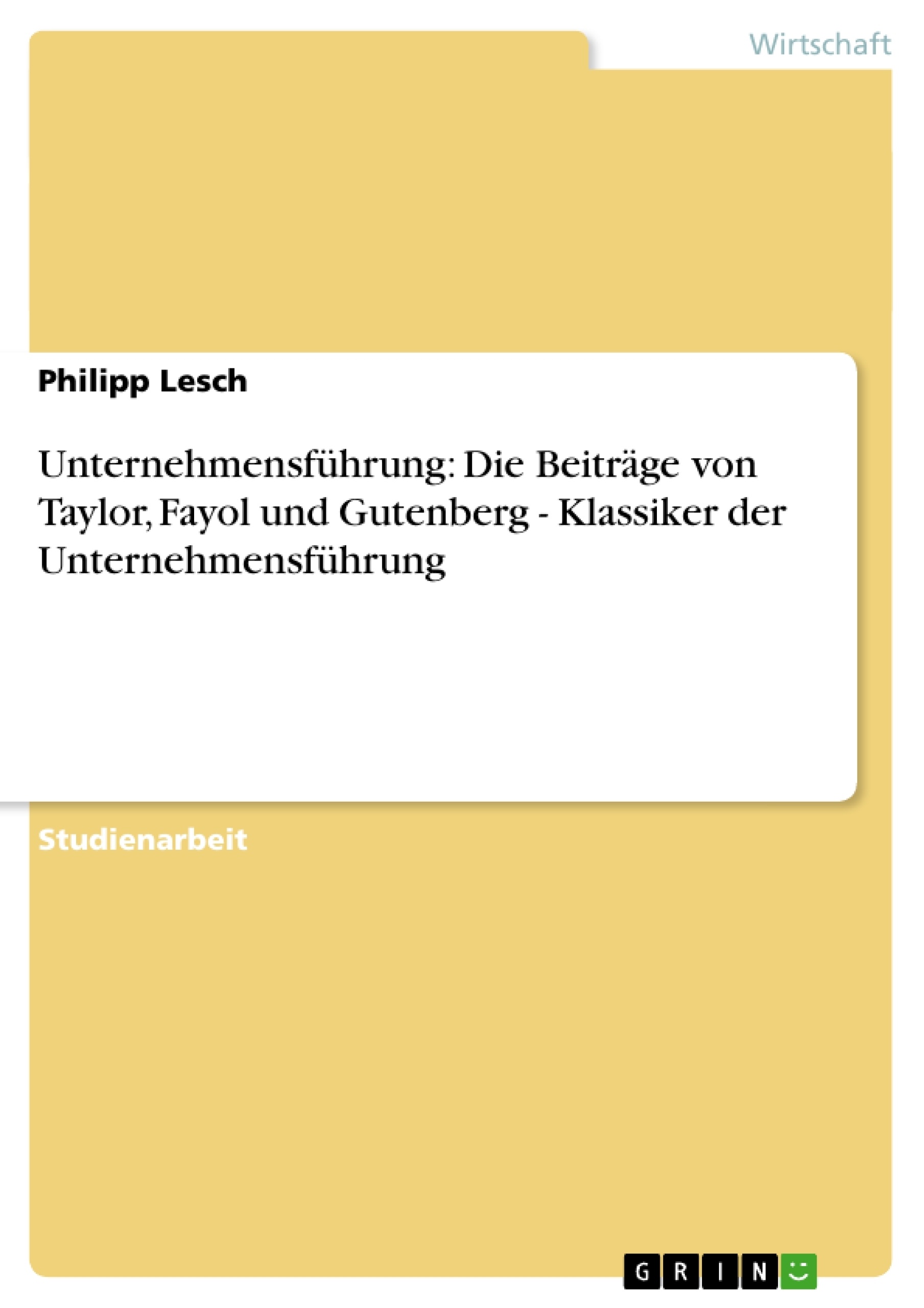Eingeleitet wird diese Arbeit mit den Worten Erich Gutenbergs:
Es
„sei an dieser Stelle ausdrücklich gesagt, daß [sic!] es nach meiner Auffassung
keine wissenschaftliche Lehre von der Unternehmensführung geben
kann. Von verantwortlicher Stelle aus weitgehende und richtige Entscheidungen
für das Unternehmen zu treffen – diese Kunst ist im Grunde weder
lehr- noch lernbar. Es gibt jedoch eine große Anzahl von Fragen der Unternehmensführung,
die einer wissenschaftlichen Behandlung zugänglich
sind.“1
Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten Antworten und Ergebnisse, die sich die
Autoren Taylor, Fayol und Gutenberg auf diese Fragen zu diesem Thema gestellt
haben und jeder auf seine Art und Weise beantwortet hat, vorzustellen.
Die Bearbeitung der drei Autoren erfolgt nach chronologischer Reihenfolge ihrer
wichtigsten Hauptwerke. Zuerst wird jeweils die Ausgangssituation dargestellt.
Danach werden ihre wichtigsten Beiträge und Leistungen vorgestellt. Zusätzlich
werden die Leistungen von Taylor und Fayol kritisch bewertet. Um Gutenbergs
Beitrag fundiert kritisieren zu können, müsste man das Gesamtwerk Gutenbergs
betrachten. Dies würde den zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen.
Folglich wird auf eine Kritik verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Frederick Winslow Taylor: Die Grundzüge wissenschaftlicher Betriebsführung
- 2.1 Bedingungsrahmen und Menschenbild der „wissenschaftlichen Betriebsführung
- 2.2 Das Ausgangsproblem und Ziel der „wissenschaftlichen Betriebsführung
- 2.3 Die Leitideen der wissenschaftlichen Betriebsführung
- 2.3.1 Das Kooperationspostulat
- 2.3.2 Das Postulat der Verwissenschaftlichung
- 2.4 Die vier Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung der Unternehmens- und Betriebsleitungen
- 2.5 Die Methodischen Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung
- 2.5.1 Die Trennung von Hand und Kopfarbeit
- 2.5.2 Die Trennung des Arbeitsprozesses von den Fertigkeiten des Arbeiters
- 2.5.3 Lückenlose, objektivierte Kontrolle
- 2.6 Die Methoden und Instrumente der wissenschaftlichen Betriebsführung
- 2.6.1 Zeitstudien
- 2.6.2 Funktionsmeistersystem
- 2.7 Kritik der „wissenschaftlichen Betriebsführung“
- 2.7.1 Nachteile
- 2.7.2 Vorteile der wissenschaftlichen Betriebsführung
- 3. Henri Fayol: Allgemeine und industrielle Verwaltung
- 3.1 Bedingungsrahmen und Menschenbild
- 3.2 Ansatzpunkte der industriellen Verwaltung
- 3.3 Die 14 Managementprinzipien von Fayol
- 3.3.1 Arbeitsteilung
- 3.3.2 Autorität und Verantwortlichkeit
- 3.3.3 Disziplin
- 3.3.4 Einheit der Auftragserteilung
- 3.3.5 Einheit der Leitung
- 3.3.6 Unterordnung des Sonderinteresses unter das Interesse der Gesamtheit
- 3.3.7 Zentralisation
- 3.3.8 Ordnung
- 3.4 Die Elemente der Verwaltung
- 3.4.1 Vorausplanung
- 3.4.2 Organisation
- 3.4.3 Auftragserteilung
- 3.4.4 Zuordnung
- 3.4.5 Kontrolle
- 3.5 Kritik Allgemeine und industrielle Verwaltung
- 4. Erich Gutenberg „Unternehmensführung“
- 4.1 Die Ausgangslage
- 4.2 Die Organisation der Führungsgruppe in der Unternehmung
- 4.2.1 Das Problem der betrieblichen Willensbildung
- 4.2.2 Das Direktional- und das Kollegialsystem
- 4.3 Führungsentscheidungen in der Unternehmung
- 4.4 Die Leitmaximen betrieblicher Betätigung
- 4.4.1 Das erwerbswirtschaftliche Prinzip
- 4.4.2 Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit
- 4.4.3 Das Prinzip zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
- 4.4.4 Die besonderen Aufgaben der Unternehmensleitung
- 4.5 Die Führungsinstrumente
- 4.5.1 Die Planung
- 4.5.2 Die Organisation
- 4.5.3 Die Kontrolle
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Beiträge von Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol und Erich Gutenberg zur Unternehmensführung. Ziel ist es, die wichtigsten Konzepte und Ansätze der drei Autoren vorzustellen und zu vergleichen, wobei der Fokus auf ihren jeweiligen Bedingungsrahmen, Menschenbild und zentralen Ideen liegt. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Taylor und Fayol wird ebenfalls vorgenommen.
- Wissenschaftliche Betriebsführung nach Taylor
- Allgemeine und industrielle Verwaltung nach Fayol
- Unternehmensführung nach Gutenberg
- Vergleich der Managementkonzepte
- Kritische Bewertung der Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit – die Präsentation der wichtigsten Beiträge von Taylor, Fayol und Gutenberg zur Unternehmensführung. Sie begründet die chronologische Reihenfolge der Darstellung und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit Taylor und Fayol an, verzichtet aber auf eine Kritik an Gutenberg aufgrund des begrenzten Umfangs.
2. Frederick Winslow Taylor: Die Grundzüge wissenschaftlicher Betriebsführung: Dieses Kapitel beleuchtet Taylors „Scientific Management“, entstanden im Kontext der industriellen Revolution und der Massenproduktion. Es beschreibt Taylors mechanistisches Menschenbild, welches den Arbeiter als potentiellen Störfaktor betrachtet und nur materielle Bedürfnisse annimmt. Taylors vier Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit, sowie die Methoden wie Zeitstudien und das Funktionsmeistersystem werden detailliert erklärt. Kritische Aspekte des Taylorismus werden ebenfalls angesprochen.
3. Henri Fayol: Allgemeine und industrielle Verwaltung: Dieses Kapitel befasst sich mit Fayols Ansatz der allgemeinen und industriellen Verwaltung. Es werden seine 14 Managementprinzipien, wie Arbeitsteilung, Autorität, Disziplin und Einheit der Leitung, vorgestellt und erklärt. Die Elemente der Verwaltung nach Fayol, Vorausplanung, Organisation, Auftragserteilung, Zuordnung und Kontrolle, bilden einen weiteren Schwerpunkt. Schließlich wird auch eine kritische Betrachtung von Fayols Theorie präsentiert.
4. Erich Gutenberg „Unternehmensführung“: Dieses Kapitel widmet sich Gutenbergs Ansatz zur Unternehmensführung. Es beschreibt die Ausgangslage, die Organisation der Führungsgruppe, das Problem der betrieblichen Willensbildung sowie die Führungsentscheidungen. Die Leitmaximen betrieblicher Betätigung, wie das erwerbswirtschaftliche Prinzip und das Prinzip der Wirtschaftlichkeit, werden erläutert. Die Führungsinstrumente Planung, Organisation und Kontrolle runden die Darstellung ab.
Schlüsselwörter
Wissenschaftliche Betriebsführung, Taylorismus, Fayolismus, Gutenberg, Unternehmensführung, Managementprinzipien, Organisation, Planung, Kontrolle, Effizienz, Menschenbild, industrielle Revolution, Massenproduktion, Wirtschaftlichkeit.
FAQs: Seminararbeit zur Unternehmensführung nach Taylor, Fayol und Gutenberg
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Beiträge von Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol und Erich Gutenberg zur Unternehmensführung. Sie vergleicht deren Konzepte und Ansätze, mit Fokus auf Bedingungsrahmen, Menschenbild und zentrale Ideen. Die Arbeit beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Taylor und Fayol.
Welche Autoren und deren Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorien von drei bedeutenden Autoren der Unternehmensführung: Frederick Winslow Taylor (Wissenschaftliche Betriebsführung), Henri Fayol (Allgemeine und industrielle Verwaltung) und Erich Gutenberg (Unternehmensführung). Ihre jeweiligen Konzepte werden vorgestellt und verglichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der wissenschaftlichen Betriebsführung nach Taylor, der allgemeinen und industriellen Verwaltung nach Fayol, der Unternehmensführung nach Gutenberg, einem Vergleich der Managementkonzepte und einer kritischen Bewertung der Ansätze von Taylor und Fayol.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Taylor's wissenschaftliche Betriebsführung, Fayol's allgemeine und industrielle Verwaltung, Gutenbergs Unternehmensführung und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt die jeweiligen Theorien detailliert, inklusive Kritikpunkte (bei Taylor und Fayol).
Was sind die zentralen Aspekte von Taylors wissenschaftlicher Betriebsführung?
Taylors Ansatz, entstanden im Kontext der industriellen Revolution, zeichnet sich durch ein mechanistisches Menschenbild, vier Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit und Methoden wie Zeitstudien und das Funktionsmeistersystem aus. Die Arbeit beleuchtet auch die Kritik an diesem Ansatz.
Welche Kernelemente beinhaltet Fayols allgemeine und industrielle Verwaltung?
Fayols Theorie umfasst 14 Managementprinzipien (z.B. Arbeitsteilung, Autorität, Disziplin, Einheit der Leitung) und die Elemente der Verwaltung: Vorausplanung, Organisation, Auftragserteilung, Zuordnung und Kontrolle. Die Arbeit beinhaltet auch eine kritische Betrachtung von Fayols Theorie.
Was sind die zentralen Punkte von Gutenbergs Ansatz zur Unternehmensführung?
Gutenbergs Ansatz befasst sich mit der Organisation der Führungsgruppe, dem Problem der betrieblichen Willensbildung, Führungsentscheidungen und Leitmaximen betrieblicher Betätigung (z.B. erwerbswirtschaftliches Prinzip, Prinzip der Wirtschaftlichkeit). Die Führungsinstrumente Planung, Organisation und Kontrolle werden ebenfalls behandelt.
Gibt es einen Vergleich der Managementkonzepte?
Ja, die Arbeit vergleicht die Managementkonzepte von Taylor, Fayol und Gutenberg, wobei die jeweiligen Bedingungsrahmen, Menschenbilder und zentralen Ideen im Fokus stehen.
Wie wird die Kritik an den Ansätzen gehandhabt?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Taylor und Fayol. Eine Kritik an Gutenberg wird aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftliche Betriebsführung, Taylorismus, Fayolismus, Gutenberg, Unternehmensführung, Managementprinzipien, Organisation, Planung, Kontrolle, Effizienz, Menschenbild, industrielle Revolution, Massenproduktion, Wirtschaftlichkeit.
- Quote paper
- Philipp Lesch (Author), 2006, Unternehmensführung: Die Beiträge von Taylor, Fayol und Gutenberg - Klassiker der Unternehmensführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/63185