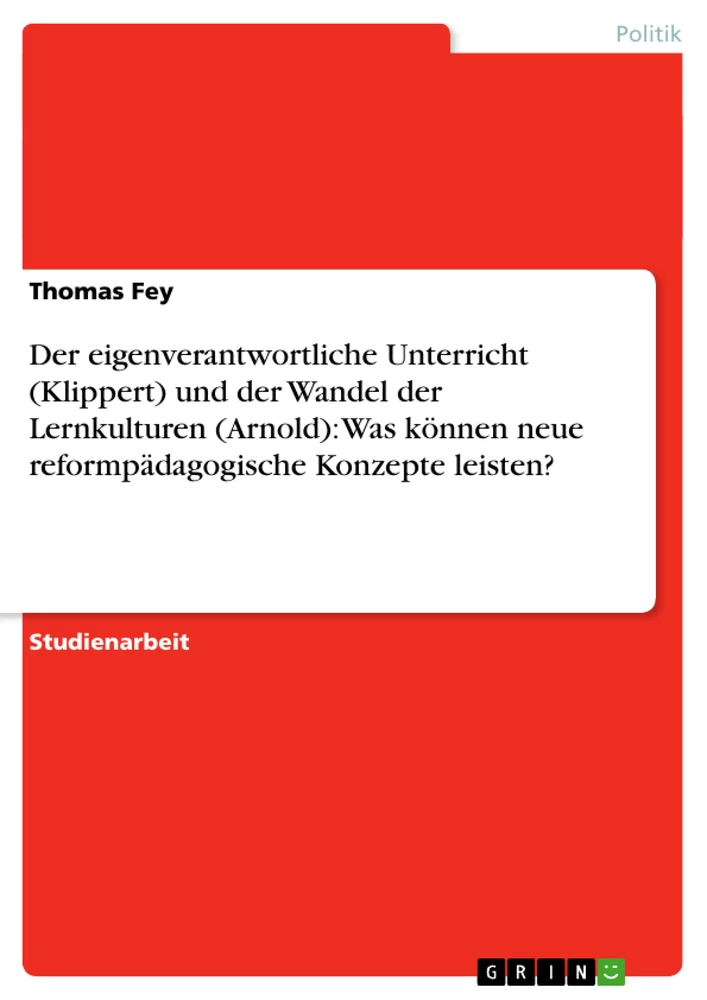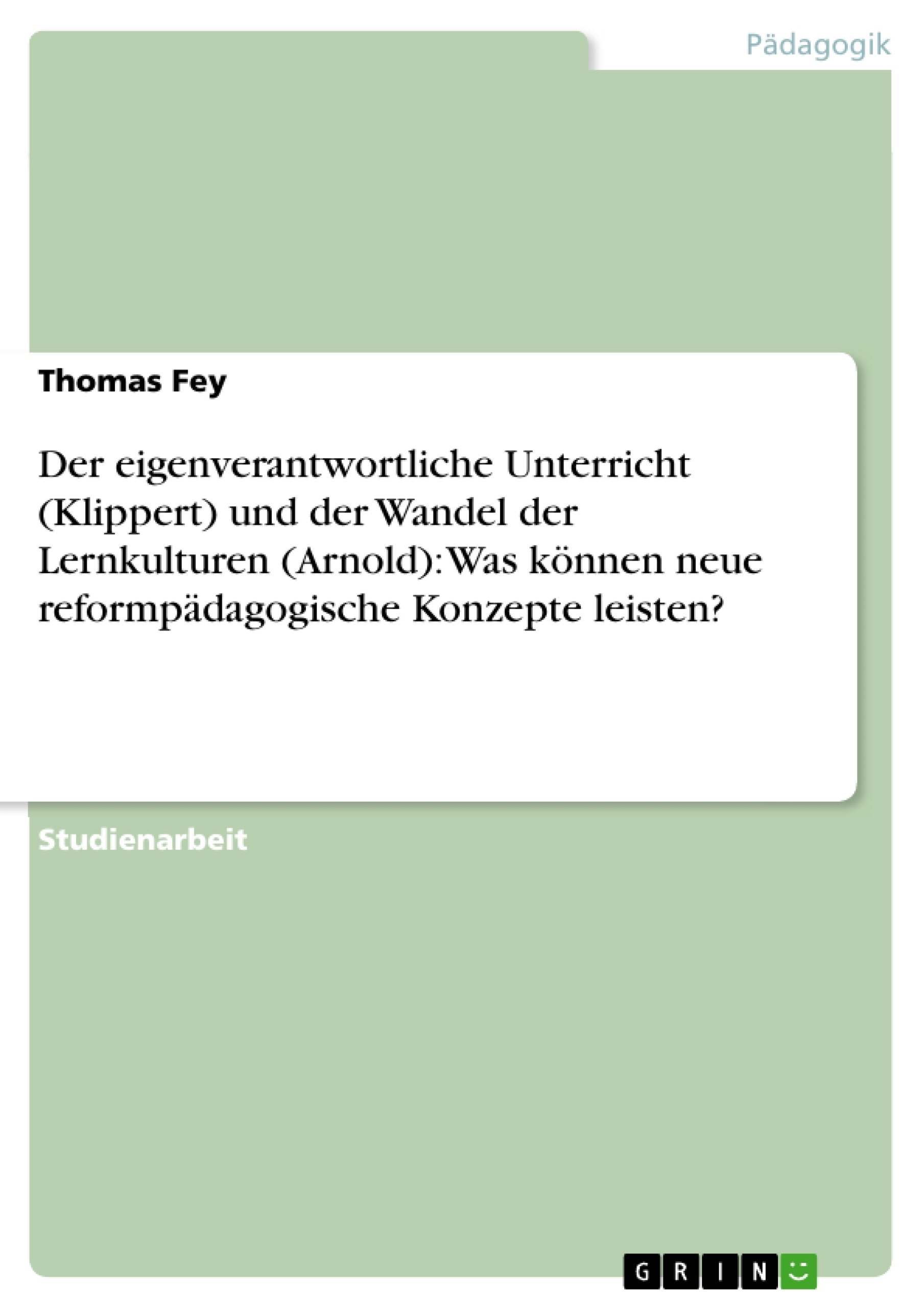Durch den Wandel in der Gesellschaft und Technologie ist es laut Rolf Arnold erforderlich, dass sich auch das Lernen in unseren Bildungseinrichtungen wandelt. Dies bedeutet, dass es immer weniger nur auf die Inhalte des Lernens ankommen wird. Wichtiger wird es sein, dass Lernen ein aktiver Prozess des Aneignens ist, den alle Menschen erfahren müssen. Nicht das Nachsprechen von Vorgetragenem (Papageiendidaktik), sondern das selbsttätige Lernen ist für die Zukunft von großer Bedeutung.
Seiner Meinung nach können Fach-, Methoden- sowie Sozialkompetenzen nicht mehr isoliert voneinander getrennt betrachtet werden, da sie eine Einheit bilden, die integrierend von jedem Individuum entwickelt werden müssen.
Hierzu muß sich die Lernkultur in den Bildungseinrichtungen ändern. Notwendig ist eine Lernkultur, die nicht selbst dementiert, was sie ermöglichen sollte. Notwendig ist ein Ende der Kultur fremdorganisierten Lernens und eine stärkere Berücksichtigung von Formen eines selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernens.
Mit diesen Grundannahmen begründet Arnold seinen Wandel der Lernkulturen. Um diesen Wandel zu beschreiben, ist es aber notwendig, die Unterscheidung zwischen der "alten" und der "neuen" Lernkultur zu machen
Danach erfolgt die Vorstellung des Dreiecks des lebendigen Lernens von Arnold, die seine neue Lernkultur begründet. Hier unterscheidet er zwischen Kopf, Herz und Hand. Inwieweit er sich dabei auf Gedanken der Reformpädagogik beruft, wird zu analysieren sein.
Schließlich erfolgt eine Analyse, ob diese Vorstellung des Lernens auch auf den Sozialkundeunterricht übertragen werden kann. Hier ist vor allem der Bezug auf das Thema Werteerziehung und Rechtsradikalismus genauer zu betrachten.
Danach erfolgt eine Zusammenfassung der im Seminar vorgestellten Methoden von Klippert in Bezug auf die von Arnold vorgestellten Thesen. Hier sollen vor allem die Umsetzungsmöglichkeiten analysiert werden. Handelt es sich um rein theoretische Konstrukte oder ist eine praktische Umsetzung möglich?? Dies soll durch das Vorstellen von Gruppenarbeiten belegt beziehungsweise widerlegt werden.
Abschließend soll geklärt werden, ob diese von Arnold publizierten Thesen wirklich neu sind oder ob es sich nicht "nur" um eine Neuauflage reformpädagogischer Ideen handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Der Wandel vom toten / mechanistischen Lernen zum lebendigen Lernen
- 3.) Das Dreieck des lebendigen Lernens
- 3.1) Der Kopf
- 3.2) Das Herz
- 3.3) Die Hand
- 3.3.1) Learn Mapping
- 3.3.2) Lernschleife
- 3.3.3) didaktisches Sechseck
- 3.3.4) offen gestaltbare Medien
- 3.3.5) Lernermethoden
- 4.) Sozialkundeunterricht – ein Paradebeispiel für die neue Lernkultur?
- 5.) Seminardurchführung und -ergebnisse
- 5.1) Arbeitsgruppe Kugellager
- 5.2) Arbeitsgruppe Fishbowl
- 6.) Zusammenfassung
- 7.) Anhang
- 8.) Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte des eigenverantwortlichen Unterrichts nach Klippert und den Wandel der Lernkulturen nach Arnold. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit neuer reformpädagogischer Konzepte zu analysieren und ihre Übertragbarkeit auf den Sozialkundeunterricht, insbesondere im Hinblick auf Werteerziehung, zu bewerten. Die praktische Umsetzbarkeit wird anhand von Seminareinheiten untersucht.
- Wandel vom mechanistischen zum lebendigen Lernen
- Das Dreieck des lebendigen Lernens (Kopf, Herz, Hand)
- Anwendbarkeit der Konzepte im Sozialkundeunterricht
- Analyse der Seminareinheiten und deren Ergebnisse
- Beziehung zu reformpädagogischen Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den notwendigen Wandel des Lernens aufgrund gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen. Sie hebt die Bedeutung von aktivem Lernen und der Integration von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse des Dreiecks des lebendigen Lernens nach Arnold und dessen Übertragbarkeit auf den Sozialkundeunterricht an, mit besonderem Fokus auf Werteerziehung und die Untersuchung der praktischen Umsetzbarkeit anhand von Seminaren.
2.) Der Wandel vom toten / mechanistischen Lernen zum lebendigen Lernen: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von passivem, mechanischem Lernen hin zu einem aktiven, selbstgesteuerten Lernprozess. Es betont die Notwendigkeit einer veränderten Lernkultur, die selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen fördert und den Lernprozess als Ganzes, inklusive des Weges, betont, im Gegensatz zu rein ergebnisorientiertem Lernen. Die Kritik an der „Papageiendidaktik“ und die Forderung nach ganzheitlichem Lernen bilden den Kern dieses Kapitels.
3.) Das Dreieck des lebendigen Lernens: Dieses Kapitel stellt das von Arnold entwickelte „Dreieck des lebendigen Lernens“ vor, das die drei Aspekte Kopf (kognitives Lernen), Herz (emotionales Lernen) und Hand (praktisches Handeln) verbindet. Es analysiert die einzelnen Komponenten und erläutert verschiedene Methoden wie Learn Mapping, Lernschleifen, das didaktische Sechseck und offen gestaltbare Medien, die die ganzheitliche Lernansatz unterstützen. Der Fokus liegt auf der Integration dieser Aspekte für ein effektiveres und nachhaltigeres Lernen.
4.) Sozialkundeunterricht – ein Paradebeispiel für die neue Lernkultur?: Dieses Kapitel untersucht die Anwendbarkeit der neuen Lernkulturkonzepte auf den Sozialkundeunterricht, insbesondere im Kontext der Werteerziehung und der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus. Es analysiert, inwieweit die von Arnold vorgeschlagenen Methoden dazu beitragen können, Werteerziehung effektiv in der Schule zu gestalten. Es wird die Frage untersucht, ob und wie die Konzepte adaptiert und eingesetzt werden können, um diesen wichtigen Bereich zu verbessern.
5.) Seminardurchführung und -ergebnisse: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung und die Ergebnisse von Seminaren, die die im vorherigen Kapitel diskutierten Konzepte praktisch umsetzen. Die Analyse der Ergebnisse von Arbeitsgruppen wie „Kugellager“ und „Fishbowl“ zeigt auf, wie gut die neuen Lernmethoden in der Praxis funktionieren und ob sie den theoretischen Ansätzen entsprechen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit der Konzepte.
Schlüsselwörter
Eigenverantwortlicher Unterricht, Wandel der Lernkulturen, Reformpädagogik, lebendiges Lernen, Werteerziehung, Sozialkundeunterricht, selbstorganisiertes Lernen, Methodenkompetenz, praktische Umsetzung, Klippert, Arnold.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Wandel der Lernkulturen im Sozialkundeunterricht
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Dokument analysiert den Wandel von mechanischem zu lebendigem Lernen, insbesondere im Kontext des Sozialkundeunterrichts. Es untersucht die Anwendbarkeit reformpädagogischer Konzepte, wie des „Dreiecks des lebendigen Lernens“ nach Arnold, und deren praktische Umsetzbarkeit in Seminareinheiten.
Welche Konzepte werden im Dokument behandelt?
Zentrale Konzepte sind der eigenverantwortliche Unterricht nach Klippert, der Wandel der Lernkultur nach Arnold, das Dreieck des lebendigen Lernens (Kopf, Herz, Hand), verschiedene Lernmethoden (Learn Mapping, Lernschleifen, didaktisches Sechseck, offen gestaltbare Medien) und deren Anwendung im Sozialkundeunterricht, insbesondere im Hinblick auf Werteerziehung.
Was ist das „Dreieck des lebendigen Lernens“?
Das „Dreieck des lebendigen Lernens“ nach Arnold verbindet drei Aspekte des Lernprozesses: den Kopf (kognitives Lernen), das Herz (emotionales Lernen) und die Hand (praktisches Handeln). Das Dokument erläutert diese Aspekte detailliert und zeigt, wie sie durch verschiedene Methoden integriert werden können.
Wie wird die praktische Umsetzbarkeit der Konzepte untersucht?
Die praktische Umsetzbarkeit wird anhand von Seminareinheiten und den Ergebnissen von Arbeitsgruppen (z.B. „Kugellager“, „Fishbowl“) analysiert. Die Ergebnisse dieser Seminare liefern Erkenntnisse zur Effektivität der neuen Lernmethoden.
Welche Rolle spielt der Sozialkundeunterricht im Dokument?
Der Sozialkundeunterricht dient als Fallbeispiel, um die Anwendbarkeit der neuen Lernkulturkonzepte zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Werteerziehung und der Auseinandersetzung mit Herausforderungen wie Rechtsradikalismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument am besten?
Schlüsselwörter sind: Eigenverantwortlicher Unterricht, Wandel der Lernkulturen, Reformpädagogik, lebendiges Lernen, Werteerziehung, Sozialkundeunterricht, selbstorganisiertes Lernen, Methodenkompetenz, praktische Umsetzung, Klippert, Arnold.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält die folgenden Kapitel: Einleitung, Wandel vom mechanistischen zum lebendigen Lernen, Das Dreieck des lebendigen Lernens, Sozialkundeunterricht – ein Paradebeispiel für die neue Lernkultur?, Seminardurchführung und -ergebnisse, Zusammenfassung, Anhang und Literaturverzeichnis.
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit neuer reformpädagogischer Konzepte zu analysieren und ihre Übertragbarkeit auf den Sozialkundeunterricht zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf Werteerziehung. Es untersucht, wie die Konzepte dazu beitragen können, aktivem und selbstgesteuertem Lernen im Sozialkundeunterricht zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Thomas Fey (Autor:in), 2001, Der eigenverantwortliche Unterricht (Klippert) und der Wandel der Lernkulturen (Arnold): Was können neue reformpädagogische Konzepte leisten?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/6207