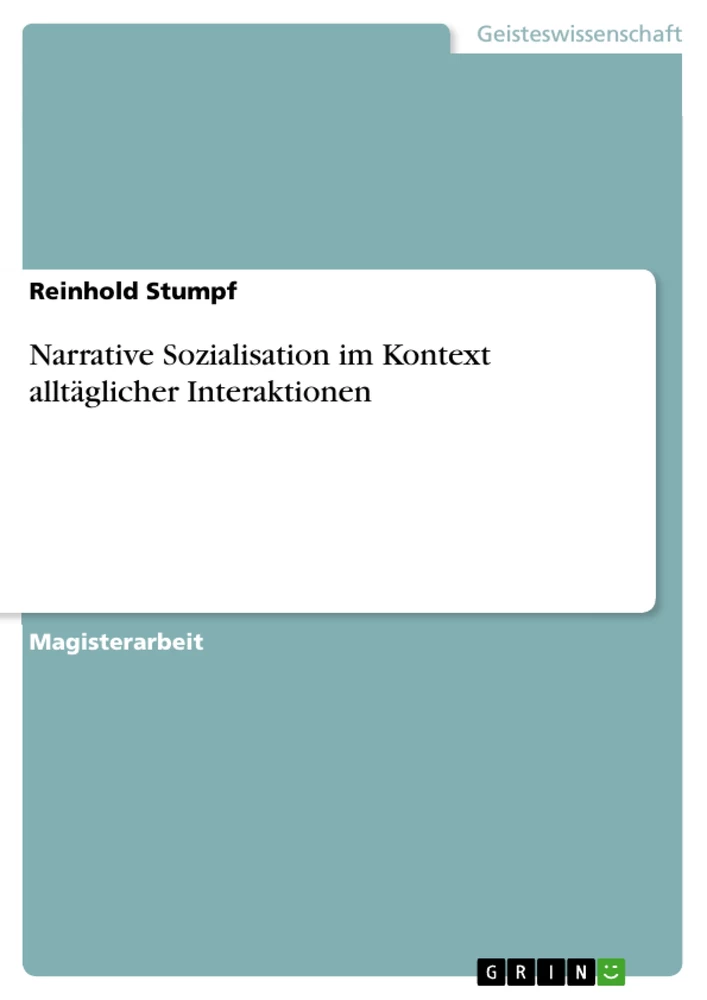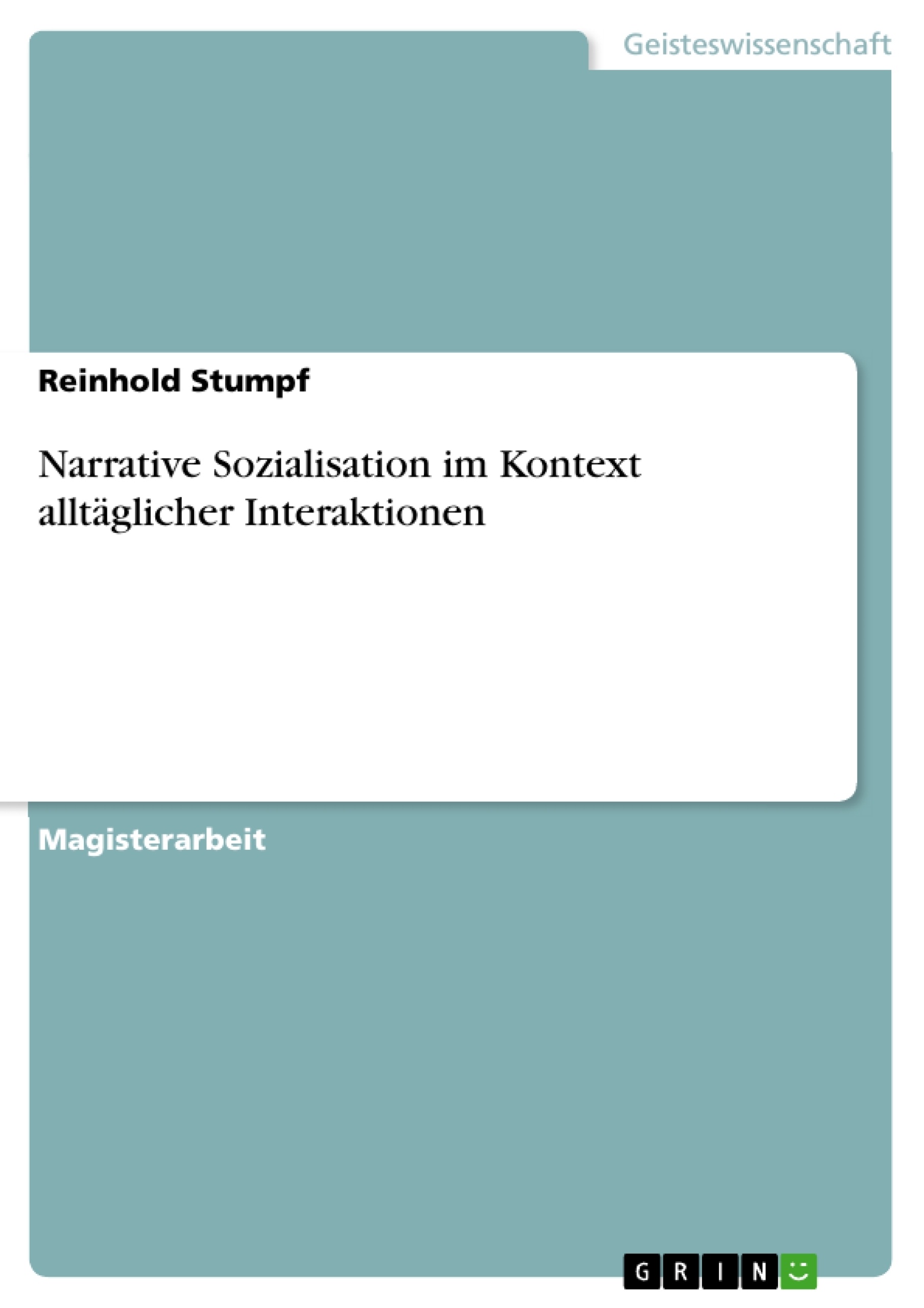In den alltäglichen Erzählungen liegt ein großes Potenzial für die Sozialisation der Individuen, und durch diese „Narrationen“ werden wichtige Sozialisationsleistungen erbracht, d.h. sie haben entscheidenden Einfluss darauf, wie aus einem Individuum ein Mitglied seiner Gesellschaft wird. Da diese nahe liegende Behauptung bisher wenig wissenschaftliche und kaum eine soziologische Bearbeitung gefunden hat, mache ich sie zur Grundthese dieser Arbeit und stütze sie anhand geeigneter theoretischer Konzepte und empirischer Untersuchungen. Die zaghaften Ansätze einer „narrativen Sozialisation“ aus verschiedenen Disziplinen (Erzählforschung, Kulturpsychologie, Entwicklungspsychologie) sollen auf diese Weise in einen soziologischen Rahmen integriert, und letztlich soll ein soziologisches Verständnis von narrativer Sozialisation etabliert werden. Der dazu notwendige rote Faden bietet sich in einem interaktiven Verständnis von Sozialisation als ständige Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft. Aus diesem Grunde interessieren vor allem Erzählungen als soziale Interaktionen und nicht medial vermittelte Geschichten. Nach einer Einführung in die Begriffswelt und einer Untersuchung der sozialen Funktionen von Narrationen werden die Sozialisationstheorien von G. H. Mead und L. S. Wygotski aufgegriffen und ihre interaktiven Konzepte auf eine "Sozialisation durch Narrationen" angewendet. Den zentralen Teil bilden J. Bruners Überlegungen zur frühkindlichen Sozialisation des Erzählens als Hineinwachsen in Sinn- und Bedeutungssysteme sowie P. J. Millers Untersuchungen von Erzählungen im familiären Umfeld und ihr daraus abgeleitetes Modell einer "Sozialisation durch sprachlichen Diskurs". Miller erklärt Erzählungen als „Methode“ von Sozialisation, und für sie ist Erzählerwerb letzlich eine Folge von Sozialisation durch Erzählen. Im Anschluss gehe ich auf Beispiele narrativer Sozialisation im Bereich Gender-Sozialisation sowie in den Instanzen der schulischen und beruflichen Sozialisation ein. Den Abschluss bilden Überlegungen zur biografischen „Lebensgeschichte“ und der Konstitution von „narrativer Identität“. Die Arbeit soll insgesamt eine soziologische Integrationsleistung der Ansätze einer narrativen Sozialisationsforschung im Kontext alltäglicher Interaktionen erbringen und stellt an die Zukunft die Forderung einer soziologischen Theorie der narrativen Sozialisation.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Danksagung
- Einleitung
- Erzählen im Alltag als soziale Interaktion
- Einführung in die begrifflichen Zusammenhänge
- Narration: Erzählung, Erzählen oder Geschichte?
- Alltägliches Erzählen
- Erzählen ist Interaktion
- Erzählen als kommunikative Gattung
- Die sozialen Funktionen des Erzählens
- Sinnkonstitution und Erfahrungsreproduktion in narrativen Interaktionen
- Sozialisation durch Interaktion – Theoretische Grundlagen
- Sozialisation und narrative Sozialisation
- Sozialisation durch symbolisch vermittelte Interaktionen (MEAD)
- Narrative Sozialisation in den Zonen der nächstfolgenden Entwicklung (WYGOTSKI)
- Sozialisation zum Erzählen - Erzählerwerb als sozialisatorische Interaktion
- Das Interaktionsmodell von HAUSENDORF/QUASTHOFF
- Narrative Sozialisation als Hineinwachsen in Sinn- und Bedeutungssysteme (BRUNER)
- Sozialisation durch Erzählen – Die sozialisatorische Wirkung von narrativen Umwelten (MILLER)
- Das Modell der Sozialisation durch sprachlichen Diskurs
- Narrative Sozialisation durch Erzählen von persönlichen Geschichten in Familieninteraktionen
- Geschichten über persönliche Erfahrungen
- Narrative Umwelten
- Praktiken des Erzählens persönlicher Geschichten
- Interkultureller Vergleich der Ergebnisse
- Narrationen als Methode von Sozialisation
- Auswirkungen auf Sozialisation und Identitätsentwicklung
- Theoretische Reflektion der Ergebnisse
- Weitere Prozesse und Instanzen narrativer Sozialisation
- Narrative Sozialisation durch das Kinderspiel
- Spielen und Erzählen
- Geschlechtspezifische Sozialisation durch das Erzählen von Geschichten mit Spielfiguren (FUCHS)
- Narrative Sozialisation in der Schule
- Narrative Sozialisation durch Unternehmenskultur
- Narrative Sozialisation durch Massenmedien
- Biografische Sozialisation und narrative Identität
- Biografische Sozialisation und die Lebensgeschichte
- Narrative Identität als Ergebnis narrativer Sozialisation
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Erzählungen auf die Sozialisation des Individuums. Sie argumentiert, dass alltägliche Erzählungen eine bedeutende Rolle im Prozess der Identitätsbildung spielen, indem sie helfen, Erfahrungen zu verarbeiten und soziale Normen und Werte zu internalisieren.
- Die Bedeutung von Erzählungen in alltäglichen sozialen Interaktionen
- Die sozialisatorischen Funktionen von Erzählungen
- Theoretische Ansätze der narrativen Sozialisation (Mead, Wygotski, Bruner, Miller)
- Der Einfluss von Erzählungen in verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule, Unternehmenskultur, Medien)
- Die Beziehung zwischen narrativer Sozialisation und biografischer Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Zusammenhang von Erzählungen und Sozialisation. Sie analysiert Erzählungen im Alltag als "kommunikative Gattungen" und zeigt die sozialen Funktionen von Erzählungen auf. Kapitel 3 behandelt die theoretischen Grundlagen der Sozialisation durch Interaktion, insbesondere die Arbeiten von Mead und Wygotski.
Kapitel 4 befasst sich mit dem "Erzählerwerb" als sozialisatorische Interaktion und stellt das Interaktionsmodell von Hausendorf/Quasthoff sowie Bruners Theorie der narrativen Sozialisation vor. In Kapitel 5 werden Millers Forschungen zum Einfluss von Erzählungen auf die Sozialisation in Familieninteraktionen betrachtet.
Kapitel 6 untersucht weitere Prozesse und Instanzen narrativer Sozialisation, wie z.B. das Kinderspiel, die Schule, die Unternehmenskultur und die Massenmedien. Abschließend wird in Kapitel 7 die Beziehung zwischen narrativer Sozialisation und biografischer Identität beleuchtet.
Schlüsselwörter
Narrative Sozialisation, Alltagsgeschichte, Erzählforschung, Sozialisationstheorie, Interaktion, Identitätsbildung, Lebensgeschichte, Familieninteraktionen, Kulturpsychologie, Entwicklungspsychologie, Mead, Wygotski, Bruner, Miller, Hausendorf/Quasthoff, Erfahrungsreproduktion, Sinnkonstitution, symbolisch vermittelte Interaktion, Zone der nächsten Entwicklung
- Quote paper
- Reinhold Stumpf (Author), 2006, Narrative Sozialisation im Kontext alltäglicher Interaktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/62068